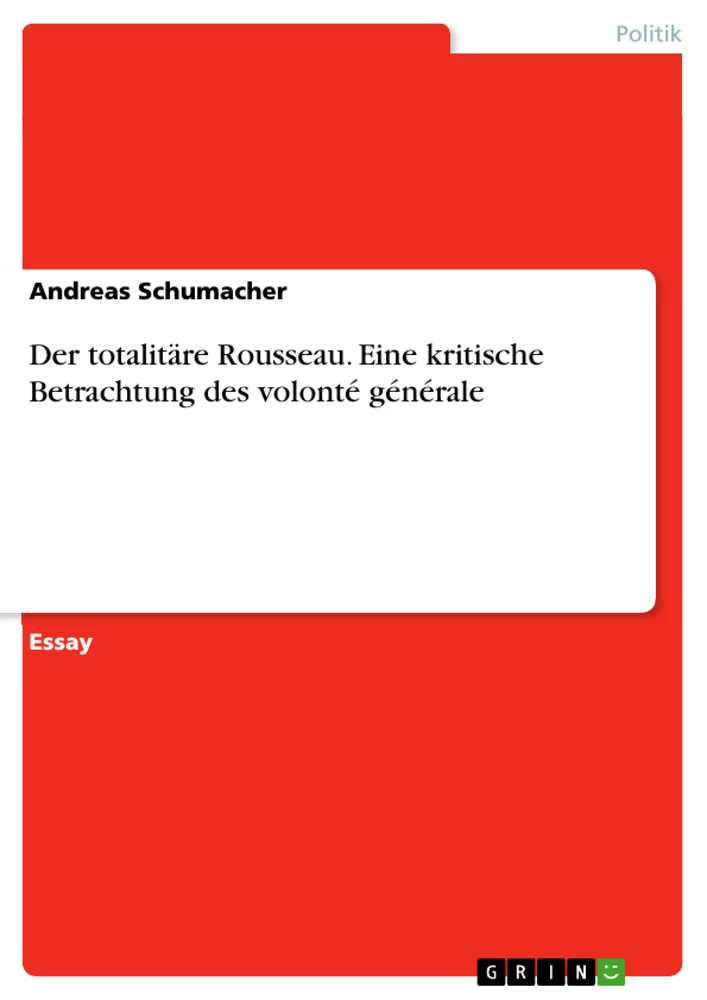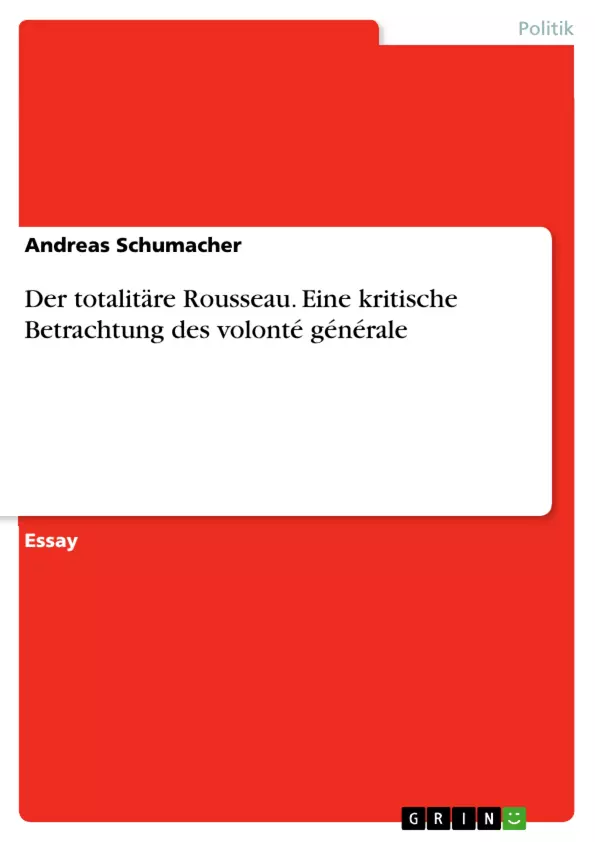Heutzutage verbinden die meisten Menschen mit dem Konzept der Demokratie die Ideale der Freiheit und Gleichheit. Dass Jean-Jacques Rousseau in seinem 1762 erschienenen Hauptwerk Du Contract Social ou Principes du Droit Politique (Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes) eine radikale Demokratietheorie entwarf, welche totalitäre Züge in sich trägt, erscheint vor diesem Hintergrund umso erstaunlicher. Es stellt sich nun die Frage, inwieweit der Staatsentwurf Rousseaus von einem totalitären Geist durchzogen ist. Um dies aufzuklären, werden im Folgenden an beispielhaften Ausschnitten einzelne Aspekte seines contract social und des damit verbundenen volonté générale kritisch hinterfragt und nach totalitären Elementen untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Gesellschaftsvertrag und der volonté générale
- Die Gleichheit der Menschen
- Der Souverän und seine Unteilbarkeit
- Die Meinungsfreiheit und die Zersplitterung von Gruppierungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert kritisch Jean-Jacques Rousseaus Staatsentwurf im "Gesellschaftsvertrag" und untersucht dessen totalitäre Züge. Die Arbeit hinterfragt, inwieweit Rousseaus Konzept des volonté générale mit den Idealen von Freiheit und Gleichheit vereinbar ist.
- Kritik am volonté générale als totalitäres Element
- Die Entindividualisierung der Gesellschaft und der Verlust individueller Freiheit
- Die Unvereinbarkeit von Rousseaus Konzept mit der Gewaltenteilung und der Repräsentation
- Die Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Gefahr der Unterdrückung von Minderheiten
- Der Utopismus und die empirische Unhaltbarkeit von Rousseaus Staatsmodell
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den totalitären Elementen in Rousseaus "Gesellschaftsvertrag". Sie betont den scheinbaren Widerspruch zwischen Rousseaus radikaler Demokratietheorie und den modernen Idealen von Freiheit und Gleichheit.
Der Gesellschaftsvertrag und der volonté générale: Dieses Kapitel analysiert Rousseaus Konzept des Gesellschaftsvertrags und den damit verbundenen volonté générale. Es wird kritisiert, dass die völlige Unterwerfung unter den Gemeinwillen, die Rousseaus Theorie impliziert, im Widerspruch zur individuellen Freiheit steht und totalitäre Züge aufweist. Die "Heiligung" der gesellschaftlichen Ordnung zu Beginn des Werkes wird als Versuch interpretiert, Kritik von vornherein zu unterbinden. Das Kapitel beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Anspruch, das Vermögen und Leben jedes Einzelnen zu schützen und gleichzeitig die vollständige Veräußerung an das Gemeinwesen zu fordern.
Die Gleichheit der Menschen: Hier wird die durch die Unterwerfung unter den volonté générale erreichte Gleichheit der Menschen behandelt. Es wird argumentiert, dass diese Gleichheit mit dem Verlust individueller Freiheit und der Entindividualisierung der Gesellschaft erkauft wird, was einen Nährboden für Totalitarismus schafft. Das Kapitel stellt die Frage, ob die Trennung von Herrschenden und Beherrschten tatsächlich die Ursache für Ungleichheit ist und kritisiert Rousseaus drastischen und übereilten Schritt hin zur vollständigen Entindividualisierung.
Der Souverän und seine Unteilbarkeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Rousseaus Ablehnung der Gewaltenteilung. Die Unteilbarkeit des Souveräns wird als "unnatürlich" und im Widerspruch zu den Prinzipien demokratischer Staaten dargestellt. Der Vergleich des Souveräns mit einem menschlichen Körper dient als Metapher für die Ablehnung jeglicher Aufteilung der Macht. Das Kapitel verweist auf die empirische Wirklichkeit, in der Staaten ohne Gewaltenteilung meist durch Unrecht, Zensur und Gewalt gekennzeichnet waren.
Die Meinungsfreiheit und die Zersplitterung von Gruppierungen: Das Kapitel untersucht die Auswirkungen von Rousseaus Denken auf die Meinungsfreiheit. Es argumentiert, dass die Unterdrückung von Gruppierungen und Parteien mit gemeinsamen Interessen einen eklatanten Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellt und die Entstehung eines echten Meinungsbildungsprozesses verhindert. Die absichtliche Zersplitterung von Interessengruppen wird als Versuch interpretiert, den volonté générale aufrechtzuerhalten, jedoch gleichzeitig als Weg in den Totalitarismus.
Schlüsselwörter
Jean-Jacques Rousseau, Gesellschaftsvertrag, volonté générale, Totalitarismus, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gewaltenteilung, Individuum, Gemeinwille, Meinungsfreiheit, Utopie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch Jean-Jacques Rousseaus Staatsentwurf im "Gesellschaftsvertrag" und untersucht dessen totalitäre Züge. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit Rousseaus Konzept des volonté générale mit den Idealen von Freiheit und Gleichheit vereinbar ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie den Gesellschaftsvertrag und den volonté générale, die Gleichheit der Menschen, den Souverän und seine Unteilbarkeit, die Meinungsfreiheit und die Zersplitterung von Gruppierungen. Es werden kritische Aspekte von Rousseaus Theorie beleuchtet, insbesondere die potenziellen totalitären Elemente.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die jeweils einen Aspekt von Rousseaus Theorie behandeln. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse und Kritik der entsprechenden Aspekte des "Gesellschaftsvertrags".
Was ist die zentrale Kritik an Rousseaus "Gesellschaftsvertrag"?
Die zentrale Kritik liegt in der potenziellen Unvereinbarkeit des volonté générale mit individuellen Freiheiten und der Gefahr des Totalitarismus. Die völlige Unterwerfung unter den Gemeinwillen wird als Widerspruch zu den Idealen von Freiheit und Gleichheit interpretiert. Die Ablehnung der Gewaltenteilung und die potenzielle Unterdrückung von Minderheiten werden ebenfalls kritisch beleuchtet.
Wie wird der volonté générale kritisiert?
Der volonté générale wird als totalitäres Element kritisiert, da die vollständige Unterwerfung unter den Gemeinwillen die individuelle Freiheit einschränkt und zur Entindividualisierung der Gesellschaft führt. Die "Heiligung" der gesellschaftlichen Ordnung wird als Versuch interpretiert, Kritik im Vorfeld zu unterbinden.
Wie wird die Gleichheit der Menschen in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit argumentiert, dass die durch den volonté générale erreichte Gleichheit mit dem Verlust individueller Freiheit erkauft wird. Die Frage, ob die Trennung von Herrschenden und Beherrschten tatsächlich die Ursache für Ungleichheit ist, wird kritisch hinterfragt. Rousseaus drastischer Schritt hin zur vollständigen Entindividualisierung wird als problematisch dargestellt.
Welche Rolle spielt die Gewaltenteilung in der Kritik?
Rousseaus Ablehnung der Gewaltenteilung wird als unnatürlich und im Widerspruch zu den Prinzipien demokratischer Staaten dargestellt. Die Unteilbarkeit des Souveräns wird als ein Faktor für die Entstehung totalitärer Strukturen gesehen, im Vergleich zu Staaten mit funktionierender Gewaltenteilung.
Wie wird die Meinungsfreiheit in Rousseaus Theorie behandelt?
Die Arbeit argumentiert, dass die Unterdrückung von Gruppierungen und Parteien mit gemeinsamen Interessen einen eklatanten Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellt. Die absichtliche Zersplitterung von Interessengruppen wird als Versuch interpretiert, den volonté générale aufrechtzuerhalten, was jedoch als Weg in den Totalitarismus gesehen wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jean-Jacques Rousseau, Gesellschaftsvertrag, volonté générale, Totalitarismus, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gewaltenteilung, Individuum, Gemeinwille, Meinungsfreiheit, Utopie.
- Citation du texte
- Andreas Schumacher (Auteur), 2015, Der totalitäre Rousseau. Eine kritische Betrachtung des volonté générale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495520