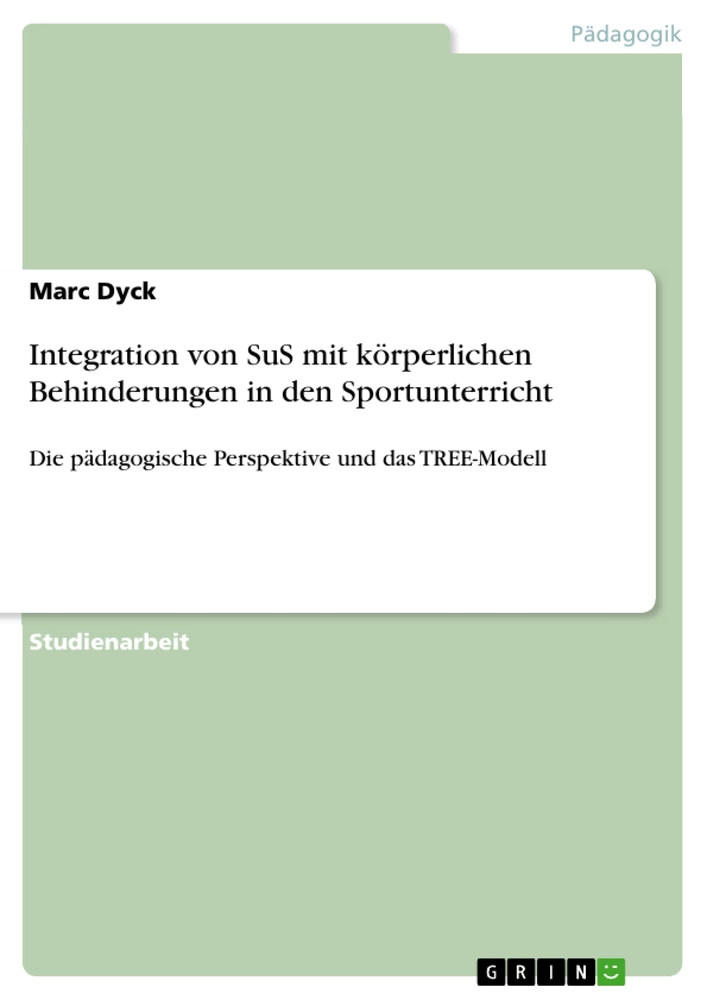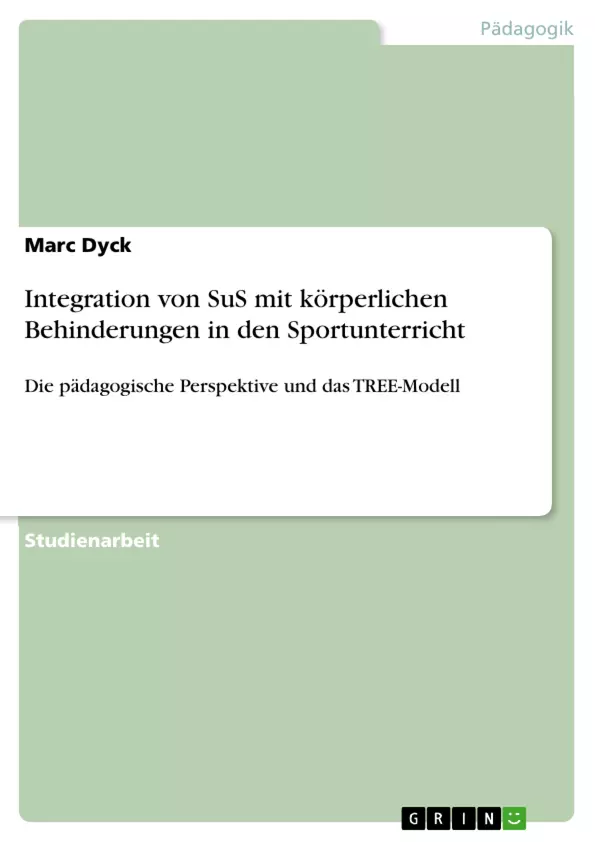Dem Sport kommt eine entscheidende Rolle für die Inklusion von Menschen mit Behinderung zu, da er zum einen die Grundlage für eine gesunde Entwicklung bildet und zum anderen den Körper als Mittel für das gesellschaftliche Leben ausbildet und fördert. Entwicklung steht somit immer in Verbindung mit Bewegung, was den Sport dazu prädestiniert eine erfolgreiche Inklusion in Schule und Gesellschaft zu schaffen. Neben der fördernden Funktion von Sport und Sportunterricht, in Bezug auf die Inklusion, kann Sportunterricht auch exkludierend auf Menschen mit Behinderung wirken: „Für viele Menschen ist der Sport durch Wettkampf und Vergleich geprägt, durch ein „Schneller, Höher, Weiter“, die wie andere Vergleichskriterien auch als objektive Maßstäbe (…) im Rangvergleich aller gegen alle gelten.“ (Reich 2014, S.14). Besonders deutlich scheinen diese objektiv, vergleichenden Maßstäbe im Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen-Leichtathletik“ zu sein. Für Menschen mit körperlichen Behinderungen sind diese festgelegten Maßstäbe meist nicht zu erreichen, was zur Teilnahmslosigkeit im und somit zur Exklusion aus dem Sportunterricht führen kann. Für den Sportunterricht in inklusiven Klassen müssen demnach andere Kriterien gefunden werden, um Leistungen von Schülerinnen und Schülern zu bewerten und generell die Teilhabe am Sportunterricht im Bereich Leichtathletik zu ermöglichen. Eine Achtung der individuellen Unterschiede ist für die Befähigung aller am Sportunterricht, daher unabdingbar. Eine differenzierende Haltung gegenüber den individuellen Fähigkeiten der SuS ist darüber hinaus Grundlage und selbstverständlich für einen erfolgreichen Unterricht an Förderschulen.
Inwiefern eine solche Differenzierung im Sportunterricht und genauer im Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen- Leichtathletik umgesetzt werden kann, soll im Verlauf des Projekts herausgestellt werden. Unter Berücksichtigung des TREE-Models soll ermittelt werden, welche Formen der Differenzierung bereits im Leichtathletikunterricht vorgenommen werden und welche Möglichkeiten bestehen, die SuS mit körperlichen Behinderungen besser in dieses Bewegungsfeld zu integrieren. Diese Möglichkeiten der Differenzierung werden anschließend in eigenen Unterrichtseinheiten getestet und auf ihre inkludierende Wirkung geprüft. Zudem wird überprüft, inwiefern die pädagogischen Perspektiven im Leichtathletikunterricht die Inklusion von SuS mit einer körperlichen Beeinträchtigung fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inklusiver Sportunterricht an deutschen Schulen
- 2.1 Bewegungsfeld: Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik
- 3. Differenzierungsmöglichkeiten für den inklusiven Leichtathletikunterricht
- 3.1 Konsequenzen für die Praxis - Das Tree-Modell
- 3.1.1 Teaching Style
- 3.1.2 Rules
- 3.1.3 Environment
- 3.1.4 Equipment
- 3.1 Konsequenzen für die Praxis - Das Tree-Modell
- 4. Forschungsmethode
- 4.1 Wahl der Forschungsmethode
- 4.2 Zeitlicher Rahmen der Untersuchung
- 4.3 Auswertung der Ergebnisse
- 5. Ergebnisdarstellung
- 5.1 Einschränkende Faktoren
- 5.1.1 Eingeschränkte Partizipation durch SuS
- 5.1.2 Eingeschränkte Partizipation durch die Unterrichtsplanung der Lehrkraft
- 5.2 Integrierende Faktoren
- 5.2.1 Wahl der pädagogischen Perspektive
- 5.2.2 Teaching Style
- 5.2.3 Rules
- 5.2.4 Environment
- 5.2.5 Equipment
- 5.1 Einschränkende Faktoren
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit körperlichen Behinderungen im Leichtathletikunterricht. Ziel ist es, pädagogische Perspektiven und das TREE-Modell zu analysieren und deren Eignung zur aktiven Integration dieser Schüler in das Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen“ zu evaluieren. Die Ergebnisse sollen praktische Handlungsempfehlungen für einen inklusiven Sportunterricht liefern.
- Inklusion im Sportunterricht und die Berücksichtigung von Menschen mit körperlichen Behinderungen
- Analyse des Bewegungsfelds „Laufen, Springen, Werfen“ hinsichtlich seiner Inklusionsfähigkeit
- Anwendung des TREE-Modells zur Differenzierung im Leichtathletikunterricht
- Die Rolle verschiedener pädagogischer Perspektiven bei der Inklusion
- Identifizierung von fördernden und hindernden Faktoren für die inklusive Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Inklusion im Sportunterricht als Ausdruck demokratischer Grundrechte und gesellschaftlicher Partizipation. Sie verdeutlicht, dass Sport ein Grundbedürfnis darstellt und für eine gesunde Entwicklung essentiell ist. Gleichzeitig wird der potenziell exkludierende Charakter von Leichtathletik aufgrund ihrer leistungsorientierten Natur angesprochen, die für Schüler mit körperlichen Behinderungen Herausforderungen mit sich bringt. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Differenzierungsmöglichkeiten zu finden, um die Teilhabe aller Schüler am Leichtathletikunterricht zu ermöglichen und das TREE-Modell in diesem Kontext zu untersuchen.
2. Inklusiver Sportunterricht an deutschen Schulen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des inklusiven Sportunterrichts in Deutschland. Es beschreibt den Wandel von anfänglicher Zurückhaltung hin zu einer zunehmenden Akzeptanz und Integration von Schülern mit Behinderungen. Besonderes Augenmerk liegt auf den didaktischen Herausforderungen, insbesondere in Bewegungsfeldern wie Leichtathletik, die stark leistungsorientiert sind. Der Perspektivwechsel von der Fertigkeits- hin zur individuellen Entwicklung der Schüler wird als zentral für einen gelungenen inklusiven Sportunterricht hervorgehoben.
2.1 Bewegungsfeld: Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik: Dieser Abschnitt analysiert das Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen“ im Hinblick auf seine Inklusionsfähigkeit. Es wird die oftmals stark auf Ergebnisse und Vergleichskriterien fokussierte Natur der Leichtathletik kritisiert, die dem Inklusionsgedanken entgegenläuft. Verschiedene pädagogische Perspektiven werden vorgeschlagen, die den Fokus vom Leistungsaspekt weg und hin zu Wahrnehmung, Bewegungserfahrungen, kooperativem Handeln und individuellen Ausdrucksformen lenken sollen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Sportunterricht, Leichtathletik, körperliche Behinderung, TREE-Modell, pädagogische Perspektiven, Differenzierung, Teilhabe, Integration, individuelle Förderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Inklusiver Leichtathletikunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit körperlichen Behinderungen im Leichtathletikunterricht an deutschen Schulen. Der Fokus liegt auf der Analyse pädagogischer Perspektiven und des TREE-Modells zur aktiven Integration dieser Schüler im Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen“.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Evaluierung der Eignung pädagogischer Perspektiven und des TREE-Modells zur Integration von Schülern mit Behinderungen. Die Arbeit soll praktische Handlungsempfehlungen für einen inklusiven Sportunterricht liefern und fördernde sowie hindernde Faktoren für die inklusive Teilhabe identifizieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Inklusion im Sportunterricht, die Berücksichtigung von Menschen mit körperlichen Behinderungen, die Analyse des Bewegungsfelds „Laufen, Springen, Werfen“ hinsichtlich seiner Inklusionsfähigkeit, die Anwendung des TREE-Modells, die Rolle verschiedener pädagogischer Perspektiven und die Identifizierung von fördernden und hindernden Faktoren für die inklusive Teilhabe.
Was ist das TREE-Modell und wie wird es angewendet?
Das TREE-Modell ist ein Differenzierungsmodell, das in dieser Arbeit auf seine Anwendbarkeit im inklusiven Leichtathletikunterricht untersucht wird. Es berücksichtigt die Faktoren Teaching Style, Rules, Environment und Equipment, um die Teilhabe aller Schüler zu ermöglichen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit beschreibt die gewählte Forschungsmethode, den zeitlichen Rahmen der Untersuchung und die Auswertung der Ergebnisse. Konkrete Details zur Methodik sind im Kapitel 4 beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse werden in Bezug auf einschränkende und integrierende Faktoren dargestellt. Eingeschränkte Partizipation wird sowohl durch Schüler als auch durch die Unterrichtsplanung der Lehrkraft analysiert. Integrierende Faktoren umfassen verschiedene pädagogische Perspektiven und die Aspekte des TREE-Modells (Teaching Style, Rules, Environment, Equipment).
Welche Schlussfolgerungen und Ausblicke werden gegeben?
Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Handlungsempfehlungen für die Praxis des inklusiven Sportunterrichts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Inklusion, Sportunterricht, Leichtathletik, körperliche Behinderung, TREE-Modell, pädagogische Perspektiven, Differenzierung, Teilhabe, Integration und individuelle Förderung.
Wie wird das Bewegungsfeld „Laufen, Springen, Werfen“ im Hinblick auf Inklusion betrachtet?
Die Arbeit kritisiert die oft leistungsorientierte Natur der Leichtathletik und schlägt alternative pädagogische Perspektiven vor, die den Fokus auf Wahrnehmung, Bewegungserfahrungen, kooperatives Handeln und individuelle Ausdrucksformen lenken.
Welche Rolle spielen pädagogische Perspektiven in der Inklusion?
Die Arbeit betont die Bedeutung verschiedener pädagogischer Perspektiven für einen erfolgreichen inklusiven Sportunterricht. Der Perspektivwechsel von der Fertigkeits- hin zur individuellen Entwicklung der Schüler wird als zentral hervorgehoben.
- Citar trabajo
- Marc Dyck (Autor), 2019, Integration von SuS mit körperlichen Behinderungen in den Sportunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495644