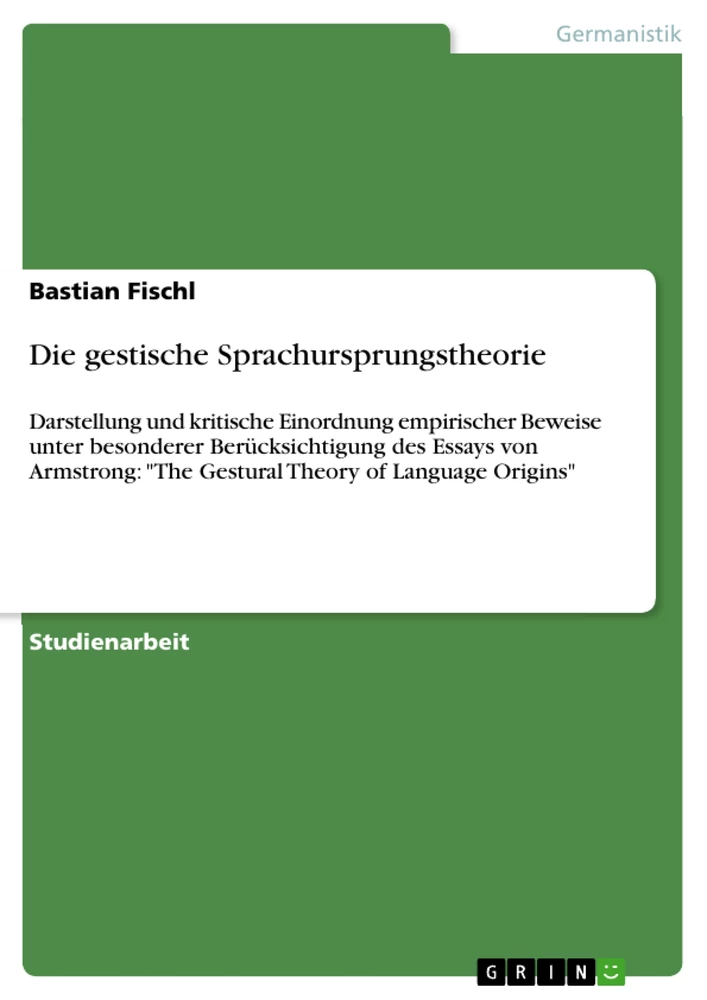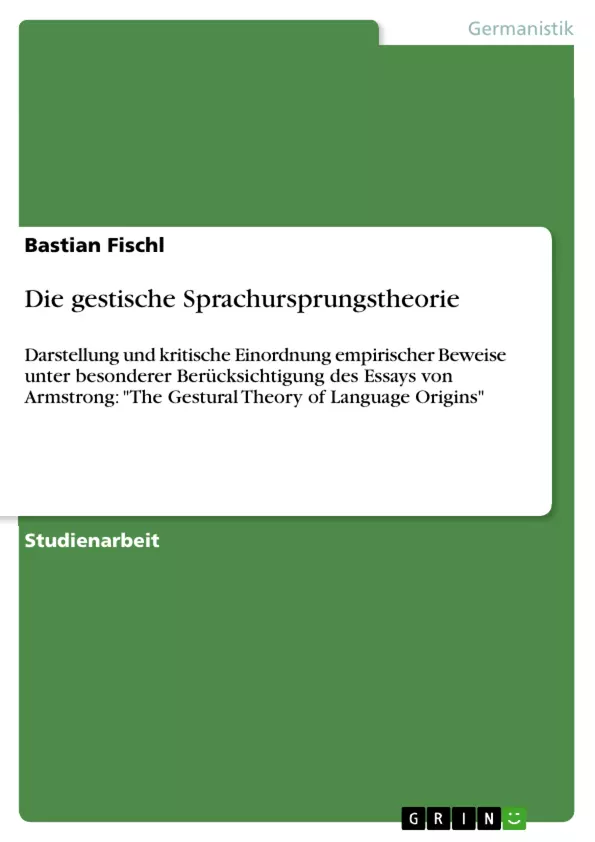Bereits frühe Sprachforscher wie Condillac, Rousseau und Herder beschäftigten sich mit den wesentlichen Grundfragen über die menschliche Sprachfähigkeit. Was ist Sprache eigentlich? Ist Sprache ein Spezifikum des Menschen? Und vor allem – was ist der tatsächliche Ursprung von Sprache? Besonders jene letzte Frage – die Frage nach dem Sprachursprung scheint auf ein wesentliches menschliches Bedürfnis abzuzielen. Der Mensch will sich in irgendeiner Weise in der Welt und zu ihr verortet wissen. Als scheinbar menschliches Spezifikum erscheint Sprache in dieser Hinsicht produktiv. Die Frage nach dem Sprachursprung wurde daher traditionell in Verbindung mit der Frage nach dem menschlichen Wesen selbst gedacht.
Spätestens mit der Auslobung des Wissenschaftspreises der Berliner Akademie der Wissenschaften im 18 Jahrhundert nimmt die Frage nach dem Sprachursprung an Fahrt auf. Das Problem wurde damals noch in Abgrenzung zu Gott gedacht. Später unter dem Einfluss der Evolutionstheorie eher in Abgrenzung zur Natur. Wo also steht der Mensch? Und was ist nun der Ursprung der Sprache?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Struktur der Beweisführung
- 2.1 Empirische Beweise
- 2.2 Die Triangel empirischer Beweise
- 2.3 Die Voraussetzungen empirischer Beweise
- 3. Beweis Aufrechter Gang
- 4. Beweis - Zeichensprache und Affen
- 5. Beweis - FoxP2
- 6. Beweis Mimese
- 6.1 Spekulativer Ansatz
- 6.2 Empirischer Ansatz
- 7. Schluss und persönliches Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gestische Sprachursprungstheorie anhand empirischer Beweise, fokussiert auf die Argumentation von Armstrong. Die Zielsetzung besteht darin, die Art der empirischen Beweise zu klären, deren Voraussetzungen zu analysieren und die Funktion der einzelnen Beweise zu erläutern. Kritische Punkte werden ebenfalls beleuchtet.
- Analyse der empirischen Beweisführung in der gestischen Sprachursprungstheorie
- Untersuchung der Voraussetzungen für die Gültigkeit empirischer Beweise
- Bewertung verschiedener Beweisansätze (archäologische Funde, Vergleich Mensch-Affe)
- Erörterung der "Triangel empirischer Beweise" nach Armstrong
- Kritisches Hinterfragen der dargestellten Beweise
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachursprungs ein und stellt die gestische Sprachursprungstheorie als einen Erklärungsansatz vor. Sie skizziert die Forschungsfrage und benennt die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen, wie die Definition empirischer Beweise im Kontext der Theorie, die Voraussetzungen dieser Beweise, die konkreten Beispiele und die damit verbundene Kritik. Die historische Auseinandersetzung mit dem Thema Sprachursprung wird kurz angerissen, um den aktuellen Forschungsstand zu verorten.
2. Struktur der Beweisführung: Dieses Kapitel beschreibt Armstrongs Struktur der Beweisführung. Er unterscheidet drei Arten: archäologische Beweise, den Vergleich von Mensch und Affe und spekulative Beweise. Der Fokus liegt auf den ersten beiden Kategorien als empirische Beweise. Archäologische Beweise werden als direkte Beweise definiert, basierend auf Fossilien und Aufzeichnungen. Der Vergleich von Mensch und Affe liefert indirekte, aber ebenfalls empirische Beweise durch die Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Die Grenzen empirischer Beweisführung vor der Erfindung dauerhafter Datenträger werden diskutiert.
2.2 Die Triangel empirischer Beweise: Dieses Kapitel erläutert Armstrongs "Triangel empirischer Beweise", ein Modell, welches die Beziehungen zwischen archäologischen Beweisen, dem Vergleich von Mensch und Affe und dem modernen Menschen veranschaulicht. Die Triangel visualisiert direkte und indirekte Relationen sowie die Rolle des gemeinsamen Vorfahren. Diese Triangel dient als organisierendes Prinzip, um die verschiedenen empirischen Beweise in Beziehung zueinander zu setzen und ihre gegenseitige Bestätigung oder Ergänzung zu verdeutlichen. Die Struktur unterstreicht den komplexen und vielschichtigen Charakter der Beweisführung.
Schlüsselwörter
Gestik, Sprachursprung, empirische Beweise, Archäologie, Primatenvergleich, Armstrong, Mimese, FoxP2, menschliche Abstammung, Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gestische Sprachursprungstheorie nach Armstrong
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die gestische Sprachursprungstheorie, insbesondere die Argumentationsweise von Armstrong, anhand empirischer Beweise. Sie analysiert die Art der Beweise, deren Voraussetzungen und die Funktion der einzelnen Beweise. Kritische Punkte werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die empirische Beweisführung in der gestischen Sprachursprungstheorie, untersucht die Voraussetzungen für die Gültigkeit empirischer Beweise, bewertet verschiedene Beweisansätze (archäologische Funde, Vergleich Mensch-Affe), erörtert Armstrongs "Triangel empirischer Beweise" und hinterfragt die dargestellten Beweise kritisch.
Welche Arten von Beweisen werden diskutiert?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von Beweisen: Archäologische Beweise (direkte Beweise basierend auf Fossilien und Aufzeichnungen), den Vergleich von Mensch und Affe (indirekte, aber empirische Beweise durch die Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden) und spekulative Beweise. Der Fokus liegt auf den empirischen Beweisen.
Was ist der "Triangel empirischer Beweise"?
Armstrongs "Triangel empirischer Beweise" ist ein Modell, das die Beziehungen zwischen archäologischen Beweisen, dem Vergleich von Mensch und Affe und dem modernen Menschen veranschaulicht. Er visualisiert direkte und indirekte Relationen sowie die Rolle des gemeinsamen Vorfahren. Dieses Modell dient dazu, die verschiedenen empirischen Beweise in Beziehung zueinander zu setzen und ihre gegenseitige Bestätigung oder Ergänzung zu verdeutlichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Struktur der Beweisführung (inkl. Unterkapiteln zu empirischen Beweisen und dem Triangel empirischer Beweise), Kapitel zu den Beweisen "Aufrechter Gang", "Zeichensprache und Affen", "FoxP2" und "Mimese" (mit spekulativen und empirischen Ansätzen) sowie einen Schluss mit persönlichem Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gestik, Sprachursprung, empirische Beweise, Archäologie, Primatenvergleich, Armstrong, Mimese, FoxP2, menschliche Abstammung, Sprachentwicklung.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Klärung der Art und Gültigkeit der empirischen Beweise in Armstrongs Argumentation zur gestischen Sprachursprungstheorie, einschließlich der Analyse ihrer Voraussetzungen und der Bewertung der einzelnen Beweisansätze.
Wie wird die historische Einordnung des Themas Sprachursprung behandelt?
Die Arbeit gibt einen kurzen Überblick über die historische Auseinandersetzung mit dem Thema Sprachursprung, um den aktuellen Forschungsstand zu verorten.
Welche Limitationen der empirischen Beweisführung werden angesprochen?
Die Arbeit diskutiert die Grenzen empirischer Beweisführung vor der Erfindung dauerhafter Datenträger.
- Citar trabajo
- Bastian Fischl (Autor), 2018, Die gestische Sprachursprungstheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496182