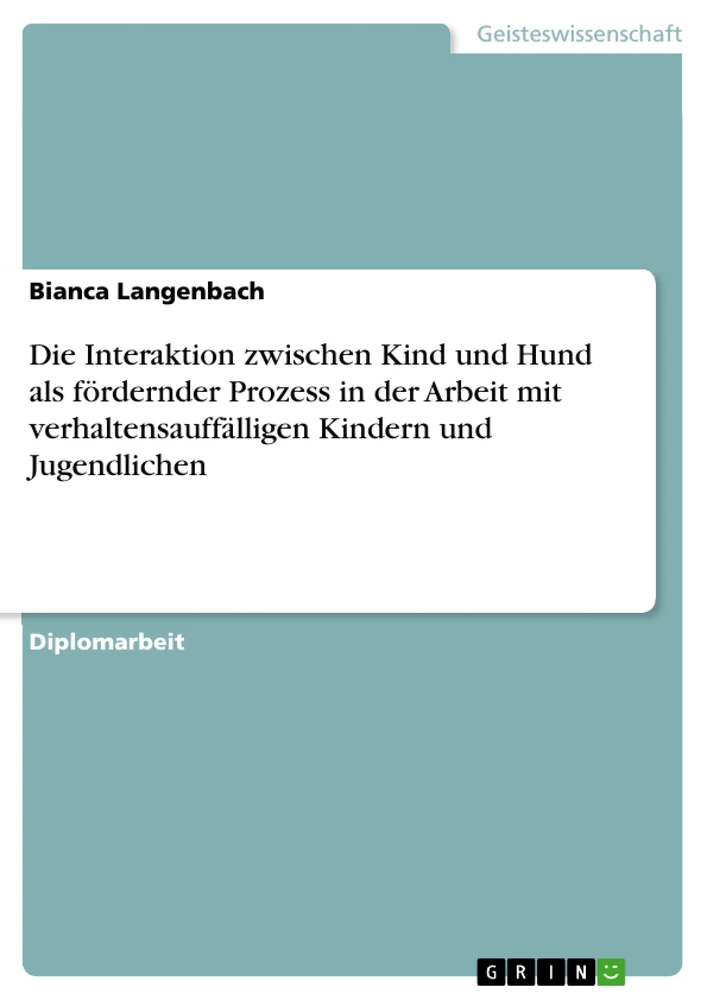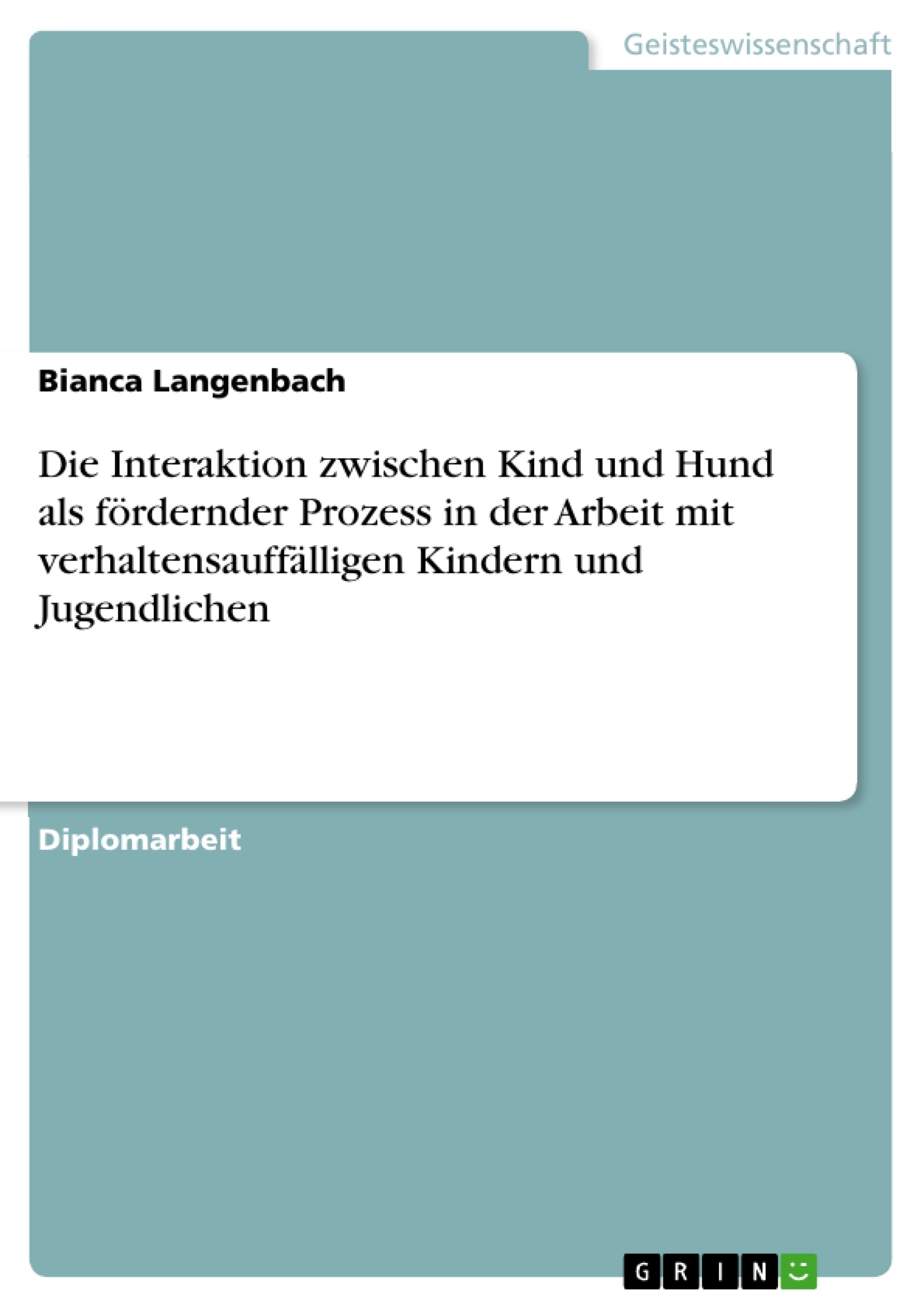Es wäre wohl nicht unbedingt zu weit gegriffen, würde man behaupten, dass das liebevolle Miteinander von Mensch und Tier sich wie ein roter Faden durch die gesamte Zeitspanne meines bisherigen Lebens hindurchzöge.
Nicht ein Jahr meiner Kindheit habe ich in Abwesenheit von Tieren in meinem unmittelbaren Lebensumfeld verlebt. Sie ermöglichten mir unzählige schöne und intensive Erlebnisse, die ich zusammenfassend als eine Erhöhung der eigenen Lebensqualität und Daseinsfreude beschreiben kann. Tiere waren für mich in allen Stationen meiner bisherigen Entwicklung Freunde, Begleiter, Tröster, liebevolle Zuhörer und Wegweiser. Besonders in schwierigen Zeiten fühlte ich mich durch sie verstanden und unterstützt.
Die Brücke von meinen persönlichen Erfahrungen hin zu therapeutisch anwendbaren Mitteln schlug sich hingegen erst während meiner Zeit als Praktikantin auf einer psychosomatischen Station einer Kinderklinik. Ich hatte nun zum ersten Mal die Aussicht auf eine Ausweitung meiner generellen Überzeugung, dass Tiere eine enorme Bereicherung für die menschliche Entwicklung darstellen können, in Hinblick auf die Arbeit mit sonst schwer erreichbaren Kindern und Jugendlichen.
Diese Erkenntnis stellte sich bei einer zufälligen Beobachtung während der gemeinsamen Freizeitgestaltung mit zwei Kindern ein, welche sich zur Behandlung auf der psychosomatischen Station befanden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Geschichte der Mensch-Tier-Beziehung
- Verbundenheit zwischen Mensch und Tier
- Entwicklung der tiergestützten Therapie und Pädagogik
- Die Interaktion zwischen Kind und Hund
- Die Kind-Hund-Beziehung
- Die Bedeutung von Hunden für Kinder
- Die psychologische Sichtweise der Kind-Hund-Beziehung
- Die Besonderheit von Hunden in der Interaktion mit Kindern
- Die Kommunikation zwischen Kind und Hund
- Voraussetzungen für die Interaktion zwischen Kind und Hund
- Der fördernde Prozess in der Kind-Hund-Interaktion
- Soziale Förderung
- Psychische Förderung
- Kognitive Förderung
- Physische Förderung
- Verhaltensänderung
- Die Kind-Hund-Beziehung
- Die Interaktion zwischen Kind und Hund in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
- Zielgruppe verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher
- Begriffsabgrenzung
- Problematik und Folgen für das verhaltensauffällige Kind
- Zielsetzung der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
- Förderung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen durch die Interaktion mit dem Hund
- Professionalität des Pädagogen in der Interaktion zwischen Kind und Hund
- Pädagogische Zielsetzung in der Kind-Hund-Interaktion
- Zielgruppe verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher
- Praxismodelle des Einsatzes der Kind-Hund-Interaktion in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
- Interaktionsmöglichkeiten/Aktivitäten
- Einzelarbeit und Gruppenarbeit
- Konzepte „hundgestützter“ Pädagogik
- Konzept der Canepädagogik
- Konzept der Kinder- und Jugendfarmen
- Grenzen beim Einsatz von Hunden in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die fördernde Wirkung der Interaktion zwischen Kind und Hund, insbesondere im Kontext der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Die Autorin möchte die positiven Effekte dieser Interaktion aufzeigen und mögliche Einsatzmodelle in der sozialpädagogischen Praxis beleuchten.
- Die Geschichte und Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung im therapeutischen und pädagogischen Kontext.
- Die Analyse der Interaktion zwischen Kind und Hund auf verschiedenen Ebenen (sozial, psychisch, kognitiv, physisch).
- Die spezifischen Herausforderungen und Chancen des Hundeeinsatzes bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen.
- Die Vorstellung verschiedener Praxismodelle und Konzepte der "hundgestützten" Pädagogik.
- Die kritische Auseinandersetzung mit Grenzen und Risiken des Einsatzes von Hunden in diesem Bereich.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt die persönlichen Erfahrungen der Autorin mit Tieren und deren positiven Einfluss auf ihre Entwicklung. Die Beobachtung einer positiven Veränderung bei verhaltensauffälligen Kindern durch den Kontakt zu einem Hund bildet den Ausgangspunkt für die Arbeit. Die Autorin hebt die Bedeutung von Tieren für die menschliche Entwicklung hervor und begründet damit die Wahl ihres Forschungsthemas.
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und skizziert den Forschungsstand und die Forschungsfrage. Sie beschreibt den Fokus auf die Interaktion zwischen Kind und Hund als fördernden Prozess bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Die Einleitung legt den methodischen Rahmen der Arbeit fest und definiert die Zielsetzung.
Geschichte der Mensch-Tier-Beziehung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung und den Wandel des Verständnisses von Tieren im Laufe der Zeit. Es werden die Ursprünge der Mensch-Tier-Bindung behandelt und die Entwicklung tiergestützter Therapie- und Pädagogik-Ansätze nachgezeichnet. Der Fokus liegt auf der zunehmenden Anerkennung der positiven Effekte der Mensch-Tier-Interaktion auf die menschliche Psyche und Entwicklung.
Die Interaktion zwischen Kind und Hund: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Interaktion zwischen Kindern und Hunden. Es werden die Besonderheiten dieser Beziehung, die verschiedenen Kommunikationsformen und die notwendigen Voraussetzungen für eine positive Interaktion untersucht. Besonders wird der fördernde Prozess in der Interaktion mit Hunden in Bezug auf soziale, psychische, kognitive und physische Entwicklung betrachtet. Die Autorin erläutert, wie der Hund als Katalysator für positive Verhaltensänderungen wirken kann.
Die Interaktion zwischen Kind und Hund in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einsatz von Hunden in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Es definiert die Zielgruppe, beschreibt die Problematik und die Zielsetzung der Arbeit mit diesen Kindern und Jugendlichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung, wie die Interaktion mit Hunden zur Förderung dieser Kinder und Jugendlichen beitragen kann und welche Rolle die Professionalität des Pädagogen dabei spielt. Es werden pädagogische Zielsetzungen im Kontext der Kind-Hund-Interaktion definiert.
Praxismodelle des Einsatzes der Kind-Hund-Interaktion in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Praxismodelle und Konzepte des Einsatzes von Hunden in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Es werden konkrete Interaktionsmöglichkeiten und -aktivitäten, die Eignung von Einzel- und Gruppenarbeit sowie Konzepte wie die Canepädagogik und die Arbeit auf Kinder- und Jugendfarmen detailliert dargestellt und bewertet.
Grenzen beim Einsatz von Hunden in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel widmet sich kritisch den Grenzen und Herausforderungen beim Einsatz von Hunden in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Es werden potentielle Risiken und Schwierigkeiten im Umgang mit Hunden in diesem Kontext angesprochen und Maßnahmen zur Risikominimierung und zur Gewährleistung eines verantwortungsvollen und sicheren Einsatzes diskutiert.
Schlüsselwörter
Kind-Hund-Interaktion, tiergestützte Pädagogik, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, soziale Förderung, psychische Förderung, kognitive Förderung, physische Förderung, Verhaltensänderung, Canepädagogik, Kinder- und Jugendfarmen, Professionalität, Praxismodelle.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Fördernde Wirkung der Interaktion zwischen Kind und Hund bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die positive Wirkung der Interaktion zwischen Kind und Hund, insbesondere bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Es wird analysiert, wie diese Interaktion die soziale, psychische, kognitive und physische Entwicklung fördert und zu Verhaltensänderungen beitragen kann.
Welche Aspekte der Kind-Hund-Interaktion werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der Mensch-Tier-Beziehung, die Besonderheiten der Kind-Hund-Kommunikation, die Voraussetzungen für eine positive Interaktion und den fördernden Prozess auf verschiedenen Ebenen. Es werden konkrete Interaktionsmöglichkeiten und Aktivitäten sowie verschiedene Praxismodelle und Konzepte der "hundgestützten" Pädagogik vorgestellt.
Welche Zielgruppe steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Hauptzielgruppe sind verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Die Arbeit beschreibt die Problematik dieser Gruppe und die Zielsetzung der Arbeit mit ihnen. Es wird untersucht, wie der Einsatz von Hunden zur Förderung dieser Kinder und Jugendlichen beitragen kann.
Welche Praxismodelle werden vorgestellt?
Die Diplomarbeit präsentiert verschiedene Praxismodelle und Konzepte, darunter die Canepädagogik und den Einsatz von Hunden auf Kinder- und Jugendfarmen. Es wird die Eignung von Einzel- und Gruppenarbeit im Kontext der Kind-Hund-Interaktion diskutiert.
Welche Grenzen und Risiken werden angesprochen?
Die Arbeit geht kritisch auf potenzielle Grenzen und Risiken des Hundeeinsatzes bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen ein. Es werden Maßnahmen zur Risikominimierung und zur Gewährleistung eines verantwortungsvollen und sicheren Einsatzes diskutiert.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Einleitung der Diplomarbeit legt den methodischen Rahmen fest und definiert die Zielsetzung der Forschungsarbeit. Die genauen methodischen Ansätze sind im Text detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kind-Hund-Interaktion, tiergestützte Pädagogik, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, soziale Förderung, psychische Förderung, kognitive Förderung, physische Förderung, Verhaltensänderung, Canepädagogik, Kinder- und Jugendfarmen, Professionalität, Praxismodelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Einleitung, Geschichte der Mensch-Tier-Beziehung, Die Interaktion zwischen Kind und Hund, Die Interaktion zwischen Kind und Hund in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, Praxismodelle des Einsatzes der Kind-Hund-Interaktion, Grenzen beim Einsatz von Hunden und Zusammenfassung und Ausblick.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Im HTML-Dokument befindet sich ein Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel", der jedes Kapitel kurz beschreibt und dessen Inhalt zusammenfasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin?
Die Autorin möchte die positive Wirkung der Interaktion zwischen Kind und Hund auf verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche aufzeigen und mögliche Einsatzmodelle in der sozialpädagogischen Praxis beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Sozialpädagogin Bianca Langenbach (Autor:in), 2005, Die Interaktion zwischen Kind und Hund als fördernder Prozess in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49642