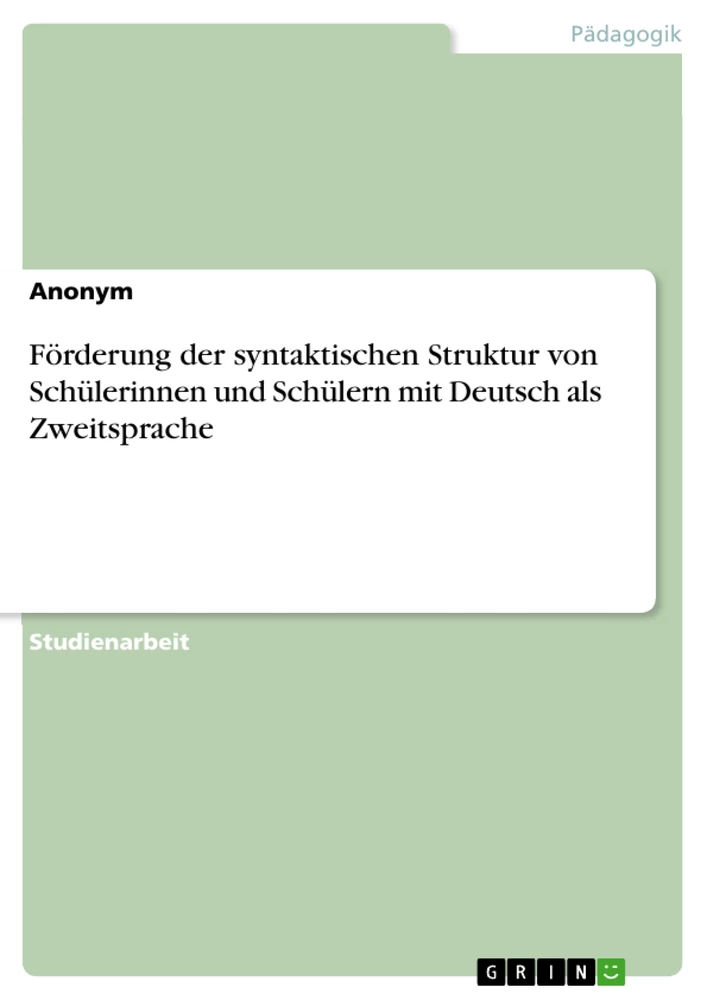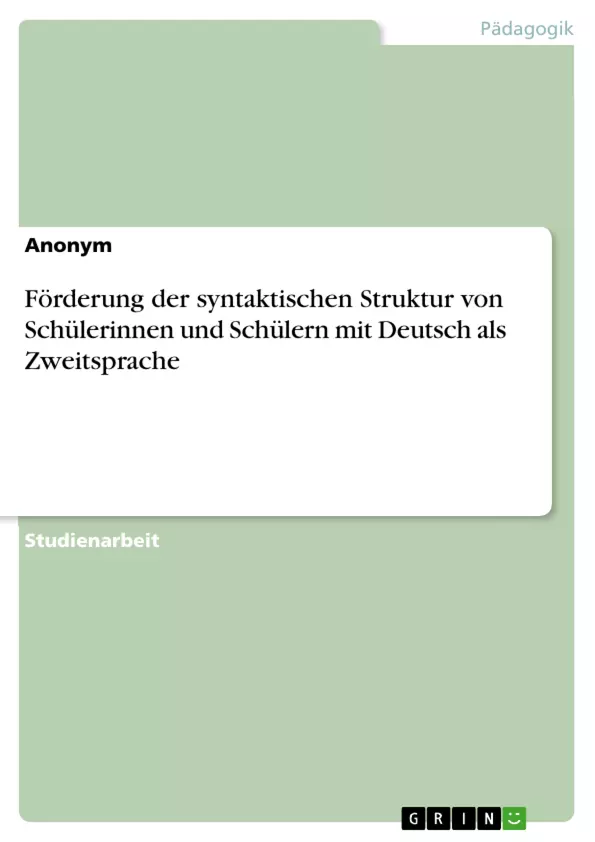Die sprachlichen Fähigkeiten der Schüler geraten immer mehr in den Fokus der bildungsdidaktischen Debatten. Der Bildungserfolg der Schüler ist stark von ihren sprachlichen Kompetenzen abhängig. Dies haben insbesondere Bildungsstudienvergleiche wie PISA und IGLU belegt. Schüler mit Migrationshintergrund weisen deutlich schlechtere sprachliche Kompetenzen auf als Schüler ohne Migrationshintergrund. Dadurch sind sie in ihren Bildungschancen benachteiligt, weshalb sie einer Hürde für ihre Bildungskarriere gegenüberstehen. Die sprachlichen Barrieren führen dazu, dass ihre Chancen auf eine qualifizierte Ausbildung erheblich eingeschränkt werden.
Insbesondere Hauptschulen, die einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund vorweisen, haben immer wieder mit den sprachlichen Defiziten der Schüler zu kämpfen, weshalb standardisierte Diagnoseverfahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit diesen Verfahren wird zunächst die Ermittlung der Deutschkenntnisse der Schüler ermittelt. Danach folgt mit der Sprachstanderhebung der Schüler, je nach Bedarf, eine individuelle Förderung, um ihre Defizite im Sprachgebrauch zu beheben. Da meine Praxisschule eine Integrationsklasse für geflüchtete Schüler eingerichtet hatte, kommt es regelmäßig dazu, dass die Schüler mit Migrationshintergrund nach Erlangung der Grundkenntnisse in den Regelklassen aufgenommen werden. Da aber ihre Sprachkenntnisse trotzdem teilweise sehr beschränkt sind, ergab sich für mich die Gelegenheit, mit ausgewählten Schülern ein Förderprogramm durchzuführen. Ein Prä- und Posttest sollte den Nutzen des durchgeführten Förderprogramms verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1. Theoretischer Hintergrund
- 2.2. Fragestellung und Hypothese
- 3. Methode und Durchführung
- 4. Ergebnisse und Diskussion
- 5. Reflexion
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Studienprojekt befasst sich mit der Förderung der syntaktischen Strukturen von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache. Das Projekt untersucht, ob eine gezielte Förderung zu einem Kompetenzzuwachs in diesem Bereich führen kann.
- Sprachliche Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- Förderung der syntaktischen Struktur im Deutschunterricht
- Einsatz von Diagnoseverfahren zur Ermittlung des Sprachstandes
- Individuelle Förderung und Berücksichtigung der individuellen Erwerbsstufe
- Bedeutung von Prä- und Posttests zur Evaluation des Förderprogramms
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt das Problem der sprachlichen Defizite von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund dar und betont die Bedeutung individueller Sprachförderung. Das Projekt beschreibt die Notwendigkeit von Diagnoseverfahren, die den Sprachstand von Schülern erfassen und so eine gezielte Förderung ermöglichen.
2. Theorie
2.1. Theoretischer Hintergrund
Dieses Kapitel behandelt den theoretischen Hintergrund der Sprachförderung, insbesondere die Bedeutung von „informellen“ Verfahren wie dem Screening Verfahren zur Ermittlung der Sprachkenntnisse und Lernvoraussetzungen. Es diskutiert den Einfluss der generativen Grammatik auf den Zweitspracherwerb und die Bedeutung der syntaktischen Erscheinungen, insbesondere der Verbstellung im Deutschen. Das Kapitel stellt die Profilanalyse nach Grießhaber vor, ein Verfahren zur Ermittlung des syntaktischen Profils und des Förderbedarfs in der Zweitsprache.
2.2. Fragestellung und Hypothese
Dieser Abschnitt formuliert die Forschungsfrage und die Hypothese des Projekts. Die Frage lautet, ob eine gezielte Förderung der syntaktischen Strukturen von Schülern mit Migrationshintergrund zu einem Kompetenzzuwachs führen kann. Die Hypothese geht davon aus, dass eine solche Förderung tatsächlich zu einem positiven Effekt führt.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, syntaktische Struktur, Sprachförderung, Migrationshintergrund, Diagnoseverfahren, Profilanalyse, Grießhaber, Prätest, Posttest, Kompetenzzuwachs.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Sprachkenntnisse bei Schülern mit DaZ ermittelt?
Durch standardisierte Diagnoseverfahren wie die Profilanalyse nach Grießhaber, die den syntaktischen Entwicklungsstand erfasst.
Warum ist die Verbstellung im Deutschen so wichtig?
Die Erwerbsstufen der deutschen Syntax orientieren sich maßgeblich an der Stellung des Verbs (z. B. Subjekt-Verb-Objekt vs. Inversion).
Was ist ein Prä- und Posttest?
Ein Prätest misst den Kenntnisstand vor einer Fördermaßnahme, ein Posttest danach, um den Kompetenzzuwachs zu evaluieren.
Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund beim Bildungserfolg?
Bildungsstudien wie PISA zeigen, dass sprachliche Barrieren oft zu Benachteiligungen in der Ausbildungskarriere führen.
Was ist generative Grammatik?
Ein theoretischer Ansatz, der untersucht, wie Menschen universelle sprachliche Strukturen erwerben und anwenden.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Förderung der syntaktischen Struktur von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497174