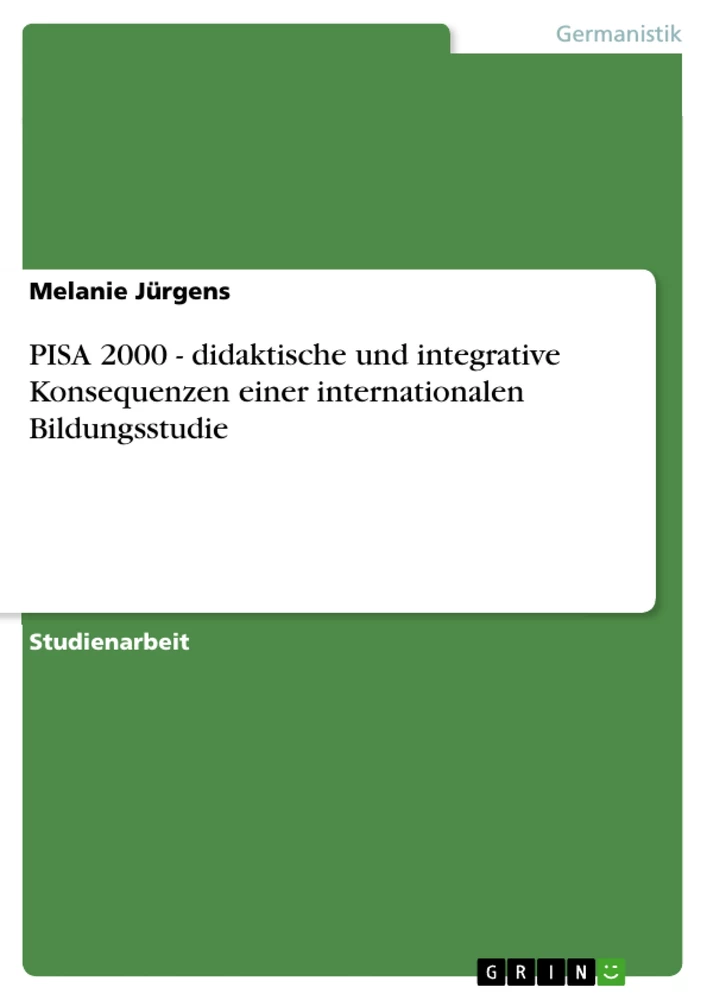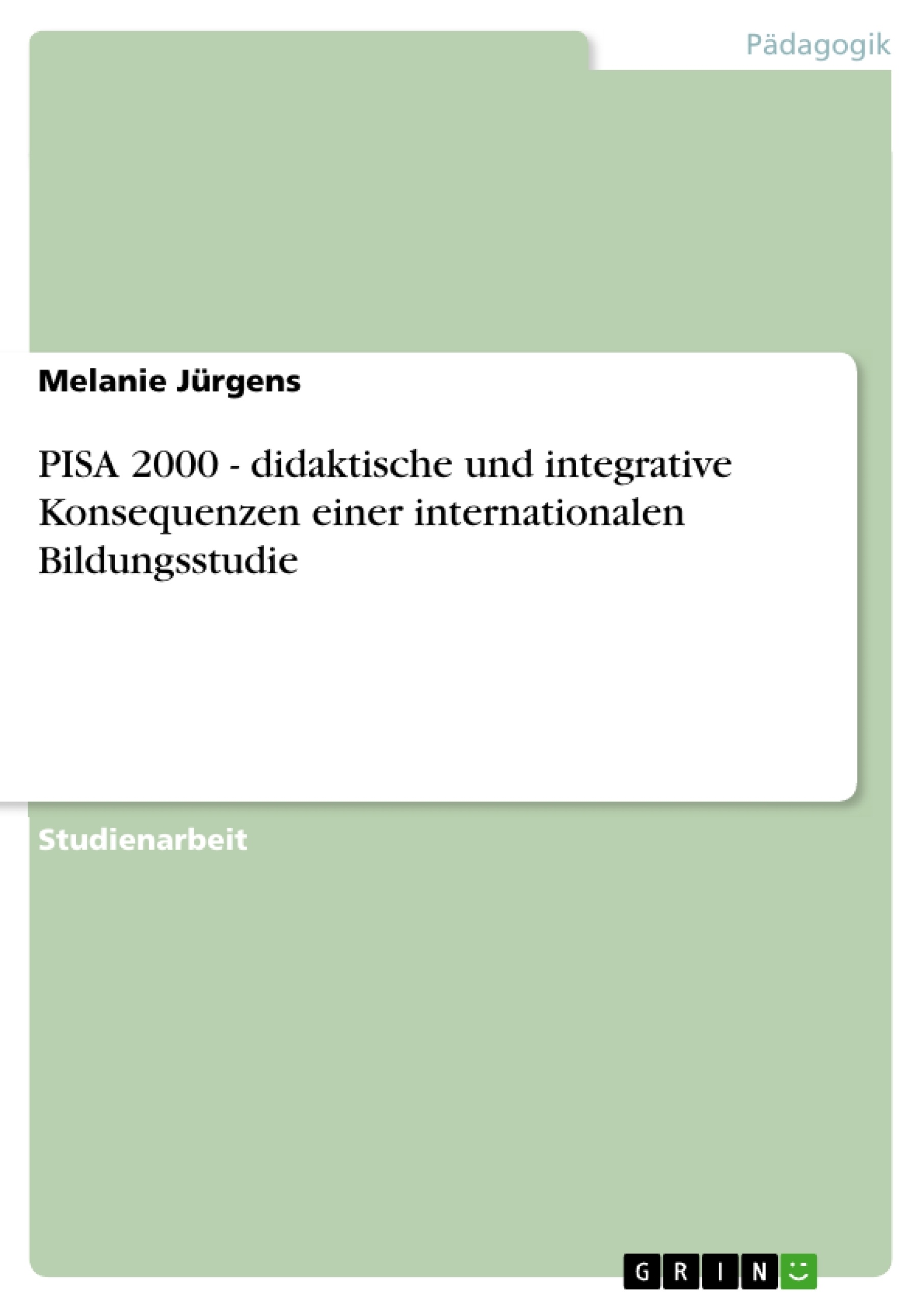I. Einleitung
Die PISA-Studie ist die größte und anspruchsvollste internationale Schulstudie der Bildungsgeschichte. Auftraggeber ist die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung); Teilnehmer sind 32 Staaten, davon sind 28 Mitgliedsstaaten der OECD. PISA steht für Programme for International Student Assessment - ein Programm, das den teilnehmenden Ländern Indikatoren zur Verfügung stellen soll, die Auskunft über ihre Ressourcenausstattung, die Effizienz ihrer Bildungssysteme sowie die Kompetenzen 15-jähriger Schüler geben sollen. Das Zauberwort der PISA-Studie ist Anschlußfähigkeit. Es geht in erster Linie um die Erfassung von Basiskompetenzen. PISA versucht demnach keineswegs, den Horizont moderner Allgemeinbildung zu vermessen oder auch nur die Umrisse eines internationalen Kerncurriculums nachzuzeichnen. Im Hintergrund der internationalen Rahmenkonzeption von PISA steht das angelsächsische Literacy-Konzept, das heißt, daß die PISA-Studie nicht die Beherrschung des im Curriculum vorgesehenen Lehrstoffs abfragt, sondern vor allem wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten, die man im Erwachsenenleben benötigt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Beherrschung von Prozessen, dem Verständnis von Konzepten sowie der Fähigkeit, innerhalb eines Bereiches mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Desweiteren ist auch die Untersuchung von fächerübergreifenden Kompetenzen integraler Bestandteil von PISA.
Der Schwerpunkt des ersten PISA-Durchgangs war die Lesekompetenz. Lesekompetenz im Sinne PISAs bedeutet, geschriebene Texte unterschiedlicher Art zu verstehen, über sie zu reflektieren, sie zu bewerten, sie in einen größeren Zusammenhang einordnen zu können sowie für verschiedene Zwecke sachgerecht zu nutzen. Neben der Lesekompetenz wurden auch die mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung und fächerübergreifende Kompetenzen (bei PISA 2000: selbstreguliertes Lernen) getestet. Meines Erachtens ist jedoch die Lesekompetenz das Musterbeispiel für eine fächerübergreifende Schlüsselqualifikation, durch deren Bewältigung auch die beiden anderen getesteten Kompetenzen (Mathematik und Naturwissenschaften) besser gemeistert werden können. Die PISA-Ergebnisse deuten auch auf eine positive Korrelation der Basiskompetenzen hin, was ein Zeichen dafür sein könnte, daß Lesekompetenz der Statthalter für andere basale Kompetenzen ist.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der PISA-Ergebnisse
- III. Mögliche didaktische Konsequenzen der PISA-Studie für den Unterricht an deutschen Schulen
- IV. Schulische Integration sowie schulische Leistung von ausländischen Kindern in Deutschland
- V. Beispiel eines Integrationsversuches ausländischer Kinder in den deutschen Schulalltag
- VI. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ergebnisse der internationalen Bildungsstudie PISA 2000. Ziel ist es, die wichtigsten Erkenntnisse der Studie für die deutsche Bildungslandschaft zu bewerten und mögliche didaktische Konsequenzen zu identifizieren. Des Weiteren werden die Herausforderungen und Chancen der Integration ausländischer Kinder in das deutsche Schulsystem im Kontext der PISA-Ergebnisse beleuchtet.
- Die Bedeutung von Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation
- Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Bildungsniveau
- Didaktische Konsequenzen der PISA-Ergebnisse für den Unterricht
- Integration von ausländischen Kindern in das deutsche Schulsystem
- Fächerübergreifende Kompetenzen und Problemlösefähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die PISA-Studie wird vorgestellt und ihre Ziele und Methodik erläutert. Die Bedeutung von Lesekompetenz als Grundlage für erfolgreiches Lernen wird hervorgehoben.
II. Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der PISA-Ergebnisse
Die wichtigsten Ergebnisse der PISA-Studie werden zusammengefasst, insbesondere die Ergebnisse zum Lesekompetenz-Niveau deutscher Schüler.
III. Mögliche didaktische Konsequenzen der PISA-Studie für den Unterricht an deutschen Schulen
Es werden didaktische Ansätze und Strategien diskutiert, die sich aus den PISA-Ergebnissen ableiten lassen, um die Lesekompetenz und das Lernen an deutschen Schulen zu verbessern.
IV. Schulische Integration sowie schulische Leistung von ausländischen Kindern in Deutschland
Die Herausforderungen und Chancen der Integration von ausländischen Kindern in das deutsche Schulsystem werden im Lichte der PISA-Ergebnisse beleuchtet.
V. Beispiel eines Integrationsversuches ausländischer Kinder in den deutschen Schulalltag
Ein konkretes Beispiel für einen Integrationsversuch von ausländischen Kindern in den deutschen Schulalltag wird vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
PISA, Lesekompetenz, Bildungsstudie, Schulsystem, Integration, Didaktik, Sozioökonomischer Status, Internationale Vergleichsstudien, Schülerleistung, Fremdsprachen, Interkulturelle Kompetenz, Unterrichtsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet PISA?
PISA steht für „Programme for International Student Assessment“ und ist eine internationale Studie der OECD zur Messung der Kompetenzen 15-jähriger Schüler.
Warum ist Lesekompetenz so zentral in der PISA-Studie?
Lesekompetenz gilt als fächerübergreifende Schlüsselqualifikation. Wer Texte nicht versteht, kann auch mathematische oder naturwissenschaftliche Aufgaben schlechter lösen.
Welchen Einfluss hat der sozioökonomische Status auf die Bildung?
PISA 2000 zeigte einen starken Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den schulischen Leistungen, was besonders in Deutschland zu Diskussionen führte.
Welche didaktischen Konsequenzen ergeben sich aus PISA?
Gefordert werden eine stärkere individuelle Förderung, die Vermittlung von Basiskompetenzen (Literacy-Konzept) und eine Verbesserung der Integration ausländischer Kinder.
Was ist das „Literacy-Konzept“?
Es beschreibt die Fähigkeit, Wissen und Fähigkeiten in realen Lebenssituationen anzuwenden, statt lediglich auswendig gelernten Lehrstoff wiederzugeben.
- Citation du texte
- Melanie Jürgens (Auteur), 2002, PISA 2000 - didaktische und integrative Konsequenzen einer internationalen Bildungsstudie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4986