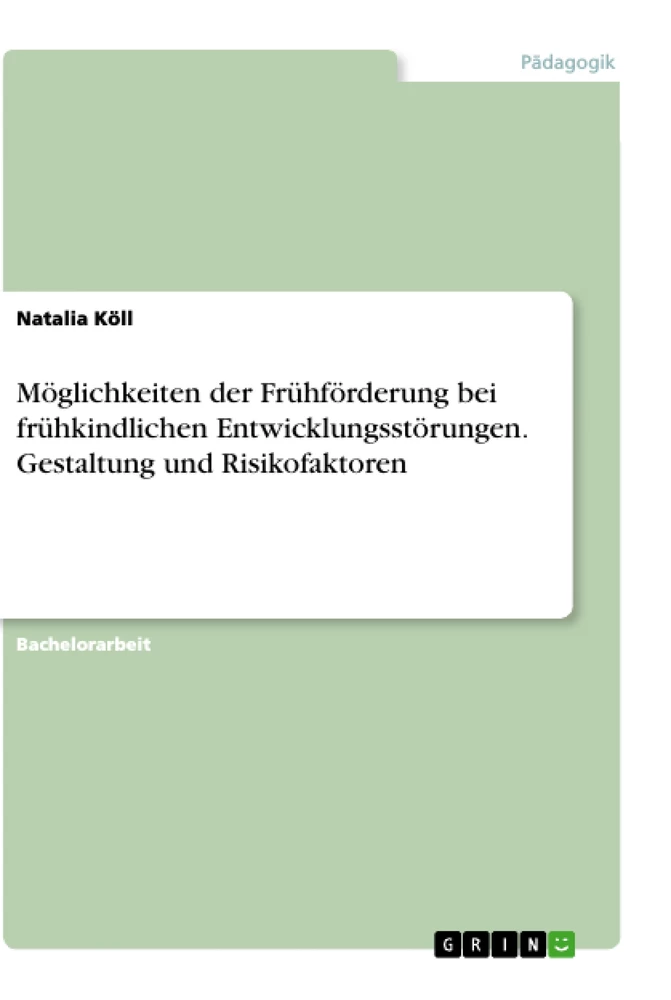In dieser Arbeit wird untersucht, welche Risikofaktoren die sozioemotionale Entwciklung im frühesten Kindesalter beeinflussen. Zudem wird überprüft, wie man im Falle einer Risikobelastung die kindliche Entwicklung durch Frühförderung unterstützen kann.
Eine Vielzahl von Faktoren nimmt Einfluss auf die Entwicklungsrichtung ei nes Kindes. Besonders in den ersten drei Lebensjahren spielt jedoch die primäre Sozialisierungsinstanz – die Familie – die größte Rolle. Durch Bindungstraumatisierungen, wie zum Beispiel Trennungserlebnissen oder Regulationsstörungen in der Eltern-Kind-Beziehung, wird das Bindungssystem langfristig in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt verschiedene psychoanalytische und pädagogische Maßnahmen, bei einem solchen Risiko die Entwicklung des Kindes und die Eltern-Kind-Beziehung bestmöglich zu unterstützen. Dazu zählt unter anderem die Frühförderung.
Um eine theoretische Grundlage für die Arbeit zu bilden, werden für ein besseres Verständnis zunächst folgende Begriffe definiert und näher erläutert: sozioemotionale Entwicklung und Bindung. Die zwei einführenden Kapitel geben einen Einblick in vorherrschende entwicklungspsychologische und bindungstheoretische Konzepte und Erkenntnisse. Es werden grundlegende Entwicklungsschritte von der Geburt an bis zum dritten Lebensjahr erklärt, unter anderem anhand der Entwicklungsmodelle von Sigmund Freud und Erik Erikson sowie der Bindungstheorie nach John Bowlby. Im Kernbereich werden laut Literaturrecherche vorrangige Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung genannt. Anschließend wird ein Überblick über den Aufbau, das Angebot und die Arbeitsweise der Frühförderung gegeben. Es werden verschiedene Interventions- und Präventionsmaßnahmen thematisiert, welche die Entwicklung unter Risikobelastungen fördern können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die sozioemotionale Entwicklung der frühen Kindheit
- 2.1 Psychoanalytische Entwicklungsmodelle
- 3. Die Bindungstheorie
- 3.1 Grundlegende Konzepte und Modelle der Bindungstheorie
- 3.2 Bindungsstörung und -traumatisierung
- 3.3 Bindung und Psychoanalyse
- 4. Risiken der frühkindlichen Entwicklung
- 4.1 Interne Risikobelastungen
- 4.2 Externe Risikobelastungen
- 4.3 Frühkindliche Störungen
- 5. Frühförderung
- 5.1 Geschichte und rechtliche Basis
- 5.2 Definition und Zielsetzung
- 5.3 Grundlagen der Frühförderung
- 5.4 Angebote der Frühförderung
- 5.5 Psychoanalytisch-pädagogische Frühförderung
- 5.6 Ausgewählte Programme
- 5.7 Wirksamkeit und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Faktoren, welche die sozioemotionale Entwicklung im frühen Kindesalter beeinflussen und erörtert die Rolle der Frühförderung bei Risikobelastungen. Die Arbeit stützt sich auf aktuelle entwicklungspsychologische und bindungstheoretische Erkenntnisse und beleuchtet die Auswirkungen von Bindungserfahrungen und frühen Traumatisierungen auf die Entwicklung des Kindes.
- Sozioemotionale Entwicklung in der frühen Kindheit
- Bindungstheorie und deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung
- Risikofaktoren der frühkindlichen Entwicklung
- Frühförderung und ihre Bedeutung bei Risikobelastungen
- Psychoanalytisch-pädagogische Ansätze in der Frühförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage der Arbeit definiert. Anschließend werden die sozioemotionale Entwicklung und die Bindungstheorie als theoretische Grundlagen erläutert. Dabei werden zentrale Entwicklungsmodelle und Konzepte vorgestellt, die das Verständnis der frühen Kindheit und ihrer Besonderheiten fördern. Das dritte Kapitel widmet sich den Risiken der frühkindlichen Entwicklung, wobei interne und externe Risikofaktoren sowie frühkindliche Störungen thematisiert werden. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen von Bindungstraumatisierungen und Regulationsstörungen auf die Entwicklung des Kindes. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frühförderung und ihren unterschiedlichen Formen, wobei die Geschichte, die rechtlichen Grundlagen, die Ziele und die Arbeitsweise der Frühförderung im Zentrum stehen. Zudem werden verschiedene Interventions- und Präventionsmaßnahmen vorgestellt, die die Entwicklung unter Risikobelastungen fördern können. Der Schwerpunkt liegt auf der psychoanalytisch-pädagogischen Frühförderung und ausgewählten Programmen, die in der Praxis Anwendung finden. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion der Wirksamkeit und Kritik an der Frühförderung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der frühkindlichen Entwicklung, der sozioemotionalen Entwicklung, der Bindungstheorie, den Risiken der frühen Kindheit, der Frühförderung und psychoanalytisch-pädagogischen Ansätzen. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Bindung, Bindungsstörung, Traumatisierung, Risikofaktoren, Frühförderung, psychoanalytische Pädagogik, Entwicklungsmodelle, Intervention, Prävention und frühkindliche Entwicklungsstörungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie in der Frühförderung?
Die Bindungstheorie nach John Bowlby zeigt, dass eine sichere Bindung die Basis für eine gesunde sozioemotionale Entwicklung ist, während Bindungsstörungen langfristige Risiken bergen.
Was sind interne und externe Risikobelastungen für Kinder?
Interne Risiken können Regulationsstörungen des Kindes sein, externe Risiken umfassen familiäre Belastungen, Trennungserlebnisse oder traumatische Bindungserfahrungen.
Was ist das Ziel der Frühförderung?
Ziel ist es, kindliche Entwicklungsstörungen frühzeitig zu erkennen und durch pädagogische sowie therapeutische Maßnahmen die Entwicklung und die Eltern-Kind-Beziehung zu unterstützen.
Was unterscheidet die psychoanalytisch-pädagogische Frühförderung?
Dieser Ansatz legt besonderen Wert auf die unbewussten Prozesse in der Eltern-Kind-Interaktion und versucht, tieferliegende Bindungstraumatisierungen zu bearbeiten.
Wie wirksam ist Frühförderung bei Entwicklungsstörungen?
Studien belegen die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen, betonen jedoch, dass die Unterstützung so früh wie möglich (idealerweise in den ersten drei Lebensjahren) einsetzen sollte.
- Quote paper
- Natalia Köll (Author), 2017, Möglichkeiten der Frühförderung bei frühkindlichen Entwicklungsstörungen. Gestaltung und Risikofaktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498707