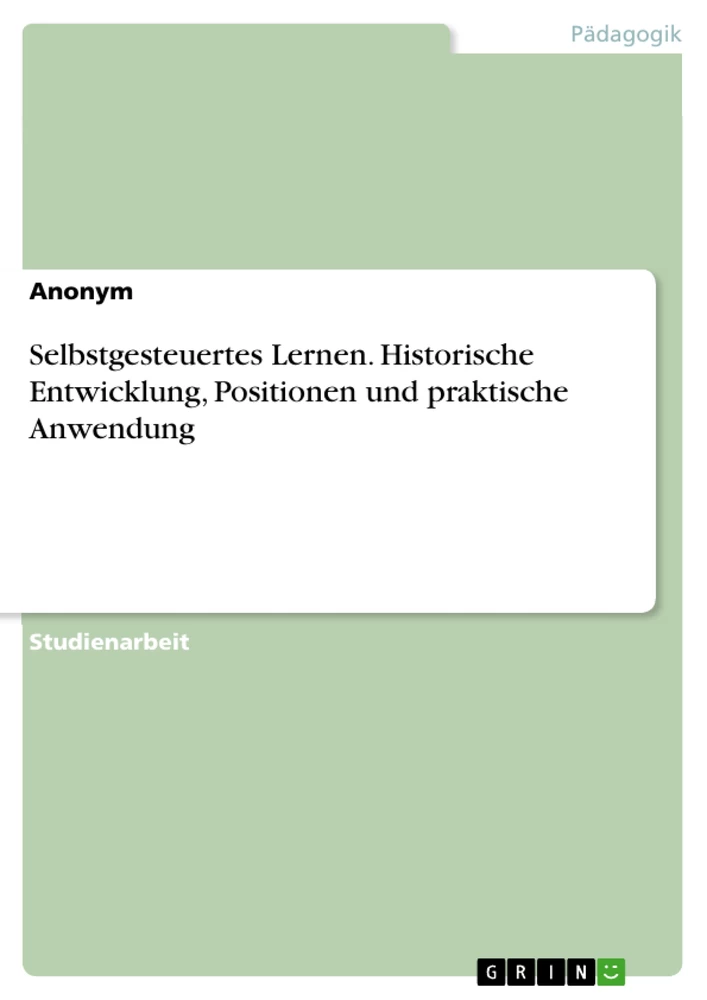Das Konzept des Selbstgesteuerten Lernens, was laut Konrad und Traub seine Ursprünge bereits in der Reformpädagogik fand, entwickelte sich im Zusammenhang von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen sowie einer zunehmenden
Differenzierung und den damit gestiegenen Ansprüchen an den Menschen zu einem relevanten Feld in der modernen Pädagogik. Das Interesse Elemente des Selbstgesteuerten Lernens im Unterricht zu verankern, ist seit den 1970er Jahren gestiegen.
Verschiedene Autoren haben sich seit dem mit unterschiedlichen Ansätzen und Ideen zu dem Thema beschäftigt. Auch gibt es bereits Angebote im Rahmen von Schulen, Universitäten oder dem außerschulischen Bereich, bei denen selbstgesteuertes Lernen im Vordergrund steht.
Es muss beachtet werden, dass verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um Elemente des selbstgesteuerten Lernens erfolgreich in das Lehr-Lerngeschehen zu implementieren. Zudem gibt es unterschiedliche Fördermethoden, die dabei helfen sollen, Selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrundinformationen Selbstgesteuertes Lernen
- Definition Selbstgesteuertes Lernen
- Ursprünge und Begründungsargumente für SGL
- Eigenes Beispiel
- Die Technologische und konstruktivistische Postion
- Förderung des selbstgesteuerten Lernens
- Förderung SGL im Unterricht
- Grundsätze der Förderung von SGL
- Förderansätze
- Direkte und indirekte Förderungsansätze
- Fördermethoden „kooperatives Lernen“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Selbstgesteuerten Lernens (SGL) und beleuchtet seine historische Entwicklung, Definition, die Rolle der Technologie und des Konstruktivismus sowie Förderansätze für SGL im Unterricht.
- Definition und Entwicklung des Konzepts des Selbstgesteuerten Lernens
- Zusammenhang zwischen SGL und der technologischen sowie konstruktivistischen Perspektive
- Förderung von SGL im Unterricht und die damit verbundenen Prinzipien
- Verschiedene Ansätze zur Förderung von Selbstgesteuertem Lernen
- Beispiele für Fördermethoden im Bereich des kooperativen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Selbstgesteuertes Lernen ein und erläutert seine Bedeutung in der modernen Pädagogik. Sie stellt die historische Entwicklung des Konzepts dar und verdeutlicht das wachsende Interesse an der Integration von SGL-Elementen in verschiedene Bildungsumgebungen.
Das Kapitel „Hintergrundinformationen Selbstgesteuertes Lernen“ befasst sich mit der Definition des Begriffs „Selbstgesteuertes Lernen“ und stellt verschiedene Definitionsversuche von Autoren wie Weinert und Knowles vor. Darüber hinaus werden die Ursprünge und Begründungsargumente für SGL aus gesellschaftlicher, lernpsychologischer und bildungstheoretischer Perspektive beleuchtet.
Im Kapitel „Die Technologische und konstruktivistische Postion“ werden die beiden Perspektiven in Bezug auf Selbstgesteuertes Lernen gegenübergestellt und die Notwendigkeit eines integrativen Ansatzes betont.
Das Kapitel „Förderung des selbstgesteuerten Lernens“ befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten, um Elemente des Selbstgesteuerten Lernens erfolgreich in den Unterricht zu integrieren. Hier werden die Grundsätze und Voraussetzungen für die Förderung von SGL im Unterricht beleuchtet.
Das Kapitel „Förderansätze“ geht auf verschiedene Ansätze zur Förderung von Selbstgesteuertem Lernen ein. Es werden direkte und indirekte Förderungsansätze sowie konkrete Fördermethoden im Bereich des kooperativen Lernens vorgestellt.
Schlüsselwörter
Selbstgesteuertes Lernen, SGL, Definition, Ursprünge, Begründungsargumente, technologische Perspektive, konstruktivistische Perspektive, Förderung, Unterricht, Grundsätze, direkte Förderansätze, indirekte Förderansätze, kooperatives Lernen, Fördermethoden, Blitzlicht-Methode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von selbstgesteuertem Lernen (SGL)?
SGL ist ein Prozess, bei dem Lernende die Initiative ergreifen, ihre Lernbedürfnisse feststellen, Ziele formulieren und Ressourcen sowie Strategien für den Lernerfolg selbst wählen.
Wo liegen die historischen Ursprünge des selbstgesteuerten Lernens?
Die Wurzeln liegen bereits in der Reformpädagogik. Seit den 1970er Jahren gewann das Konzept durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse massiv an Bedeutung.
Was ist der Unterschied zwischen direkter und indirekter Förderung?
Direkte Förderung vermittelt Lernstrategien explizit, während indirekte Förderung durch die Gestaltung der Lernumgebung und Aufgabenstellungen das selbstständige Lernen anregt.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus beim SGL?
Aus konstruktivistischer Sicht ist Lernen ein aktiver, individueller Konstruktionsprozess. SGL bietet den notwendigen Freiraum für diesen eigenverantwortlichen Wissensaufbau.
Was sind Beispiele für kooperative Fördermethoden?
Ein Beispiel ist die Blitzlicht-Methode, die den Austausch in der Gruppe fördert und gleichzeitig die individuelle Reflexion des Lernstandes unterstützt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Selbstgesteuertes Lernen. Historische Entwicklung, Positionen und praktische Anwendung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501376