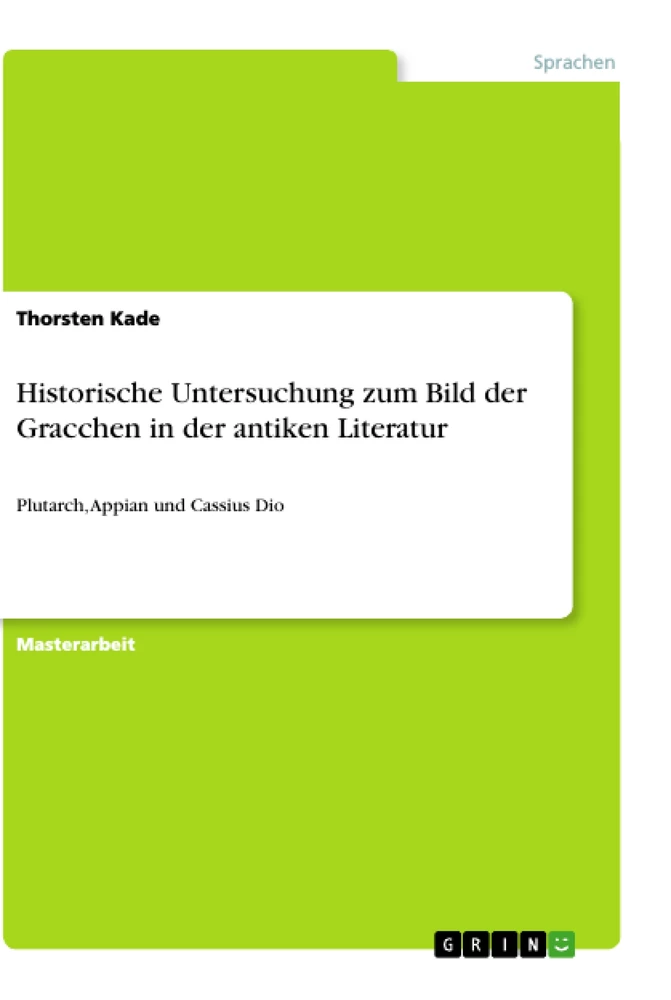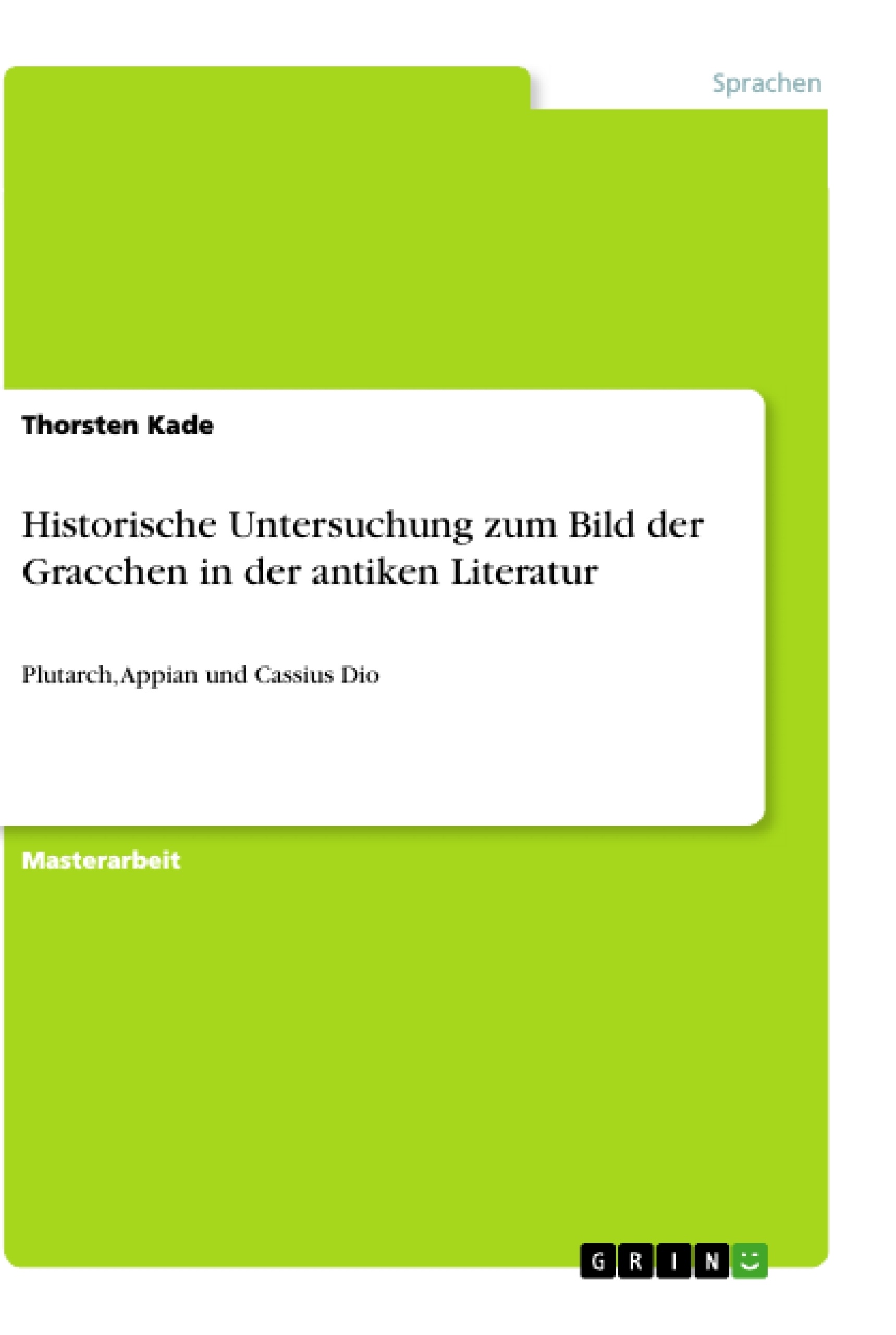Das Ziel dieser Arbeit liegt nicht darin, das Ackergesetz genauer zu untersuchen, sondern darin, das überlieferte Bild des Tiberius und Gaius Gracchus unter Zuhilfenahme der antiken Literatur von Plutarch, Appian und Cassius Dio zu beleuchten.
Die Krise der römischen Republik wurde zweifelsohne durch die enormen Gebietserweiterungen im Mittelmeerraum und im Speziellen durch die punischen Kriege im 2. Jahrhundert v.Chr. in ihrer Intensität beschleunigt. Die notwendigen Reformen in der Heeres- und Agrarverfassung wurden durch die enorme Belastung noch zwingender. Die immense Inanspruchnahme "der bäuerlichen Bevölkerung Italiens mit Kriegsdienst entzog der Landwirtschaft Arbeitskräfte, und unter Umständen konnte eine bäuerliche Familie in den Ruin gestürzt werden - wenn ein junger Familienvater […] mehrere Jahre hintereinander Legionär war".
Die Zeit ist somit durch die kriegerische Expansion, aber auch durch die notwendig gewordenen landwirtschaftlichen Neuordnungen zu charakterisieren, wobei mit den Zerstörungen auf römisches Territorium wiederrum eine agrarische Stagnation verknüpft werden kann. In diesem Zeitraum, welcher in erster Linie durch Krisen dokumentiert ist, betreten die Brüder Tiberius und Gaius Gracchus die politische Bühne Roms. Beide greifen dementsprechend in einer Zeit in die römische Politik ein, welche als entscheidender Wendepunkt in die römische Geschichte eingehen sollte und die Zäsur von der mittleren zur späten Republik kennzeichnet.
Diese Epoche beschrieb bereits Theodor Mommsen, als ein bedeutender Vertreter der älteren Altertumswissenschaft, als die Zeit, in welcher die römische Revolution begann. Die Auseinandersetzungen rund um das Sempronische Ackergesetz waren hierbei ein zentraler Bestandteil, welcher eine Kette von Ereignissen auslöste und langjährige Konflikte, die in Bürgerkriegen mündeten, begründete. Eine Entwicklung die durch die Konstituierung des Prinzipats durch Augustus und den Untergang der römischen Republik im Jahre 27. v.Chr. ihren Abschluss fand. Ist der Ausdruck der Revolution zwar in der neueren Forschung äußerst umstritten, zeigt dieser Ausschnitt dennoch, welches große Interesse seitens der Forschung den beiden Brüdern und ihrem politischen Wirken bereits über viele Jahrzehnte gewidmet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Beurteilung der Quellenlage
- Römische Primärquellen
- Untersuchung der Quellen
- Plutarch
- Autorenvita
- Tiberius Gracchus und Gaius Gracchus
- Zu Person, Charakterzügen und familiärem Umgang
- Einfluss Cornelias auf die Politik der Söhne
- Politisches Wirken und öffentliche Meinung zu Tiberius Gracchus
- Politisches Wirken und öffentliche Meinung zu Gaius Gracchus
- Zusammenfassung
- Appian
- Autorenvita
- Tiberius Gracchus und Gaius Gracchus
- Zu Person, Charakterzügen und familiärem Umgang
- Einfluss Cornelias auf die Politik der Söhne
- Politisches Wirken und öffentliche Meinung zu Tiberius Gracchus
- Politisches Wirken und öffentliche Meinung zu Gaius Gracchus
- Zusammenfassung
- Cassius Dio
- Autorenvita
- Tiberius Gracchus und Gaius Gracchus
- Zu Person, Charakterzügen und familiärem Umgang
- Einfluss Cornelias auf die Politik der Söhne
- Politisches Wirken und öffentliche Meinung zu Tiberius Gracchus
- Politisches Wirken und öffentliche Meinung zu Gaius Gracchus
- Zusammenfassung
- Plutarch
- Vergleich der Darstellungen von Plutarch, Appian und Cassius Dio
- Herleitung möglicher Motive der Autoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Darstellung der Brüder Tiberius und Gaius Gracchus in der antiken Literatur, insbesondere anhand der Werke von Plutarch, Appian und Cassius Dio. Die Arbeit zielt darauf ab, das überlieferte Bild der Gracchen zu analysieren und Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den drei Quellen zu identifizieren.
- Das Bild der Gracchen in den Werken von Plutarch, Appian und Cassius Dio
- Vergleich der Darstellung der Gracchen in den drei Quellen
- Mögliche Motive der Autoren bei der Darstellung der Gracchen
- Analyse der Unterschiede in der Darstellung der Gracchen
- Interpretation der unterschiedlichen Perspektiven auf die Gracchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die historische Situation der späten römischen Republik und die Bedeutung der Gracchen in diesem Kontext beschreibt. Anschließend beleuchtet das Kapitel "Quellenlage" die verfügbaren Quellen zur Geschichte der Gracchen und diskutiert deren Aussagekraft.
Das Kernstück der Arbeit besteht in der Untersuchung der drei antiken Autoren Plutarch, Appian und Cassius Dio. Für jeden Autor werden die Autorenvita, die Darstellung von Tiberius und Gaius Gracchus und deren politisches Wirken analysiert. Die Untersuchung fokussiert dabei auf die Darstellung der Person und des Charakters der Gracchen sowie auf den Einfluss ihrer Mutter Cornelia auf ihre politische Entwicklung.
Im Vergleich der drei Darstellungen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Gracchen herausgearbeitet. Die Arbeit schließt mit einer Analyse möglicher Motive der Autoren bei der Darstellung der Gracchen und ihren Reformvorhaben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der römischen Republik, wie der Agrarfrage, der politischen Instabilität und den sozialen Spannungen, die im 2. Jahrhundert v.Chr. die römische Gesellschaft prägten. Die Arbeit analysiert die Darstellung der Gracchen als wichtige Persönlichkeiten dieser Epoche und beleuchtet den Einfluss der antiken Quellen Plutarch, Appian und Cassius Dio auf unser heutiges Bild von den Brüdern Gracchus. Wichtige Schlüsselwörter sind daher: römische Republik, Gracchen, Plutarch, Appian, Cassius Dio, Agrarpolitik, soziale Spannungen, politische Instabilität, historische Quellenanalyse.
- Citation du texte
- Thorsten Kade (Auteur), 2017, Historische Untersuchung zum Bild der Gracchen in der antiken Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501377