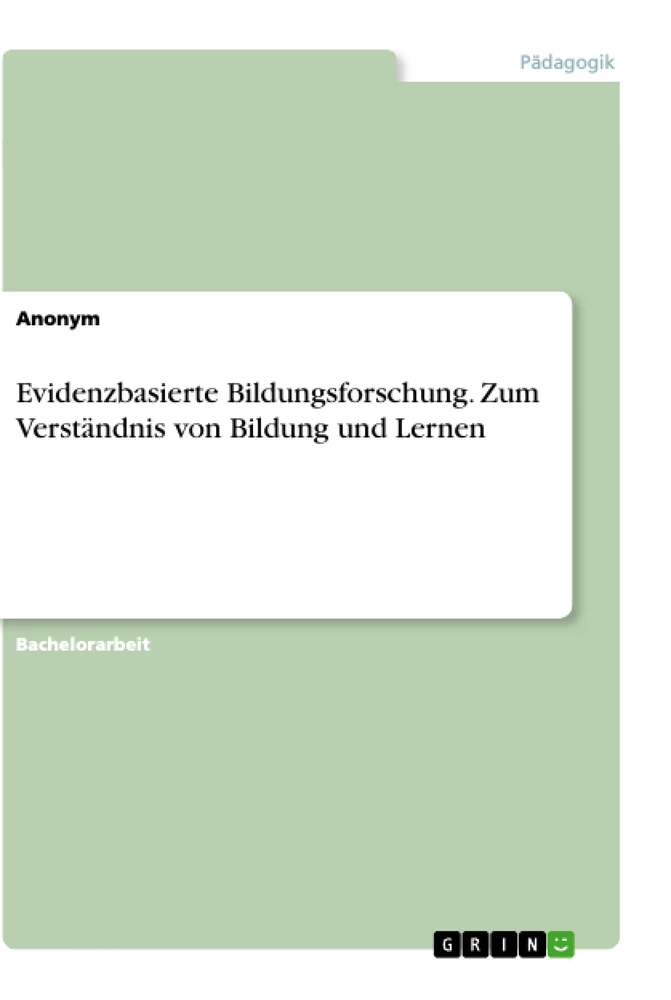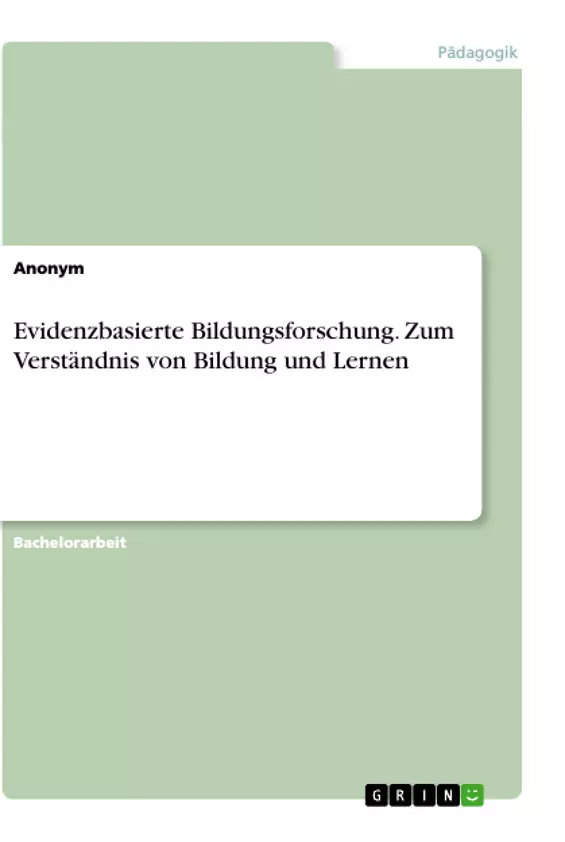Diese Arbeit untersucht das Bildungs- und Lernverständnis der evidenzbasierten Bildungsforschung und zwar ausgehend von der Arbeitshypothese, dass der evidenzbasierten Bildungsforschung ein ökonomisches und technokratisches Bildungs- und Lernverständnis zugrunde liegt, was dazu führt, dass vor allem inklusive Werte, im Sinne einer Anerkennung und Würdigung von Heterogenität, verloren gehen und informelle Lernwege nicht berücksichtigt werden. Diese vermeintliche Verengung des Verständnisses von Bildung und Lernen wird in einem Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und des gesellschaftlichen Wandels hin zur neoliberalen Technokratie gesehen.
Die evidenzbasierte Bildungsforschung hat in den letzten Jahren besonders in Deutschland an Bedeutung gewonnen und ist heute ein anerkanntes Paradigma der Erziehungswissenschaften, das zudem eine enorme Praxisrelevanz bekommen hat, da seine Forschungsergebnisse von der Bildungspolitik bevorzugt zu der Bearbeitung von tagespolitischen Fragen herangezogen werden. Nicht nur in der wissenschaftlichen Diskussion, sondern auch in öffentlichen Debatten kam der Studie Lernen sichtbar machen von dem neuseeländischen Professor John Hattie besondere Aufmerksamkeit zu, was vor allem auf die außerordentlich große Datenbasis und die praxisrelevanten Ergebnisse zurückzuführen ist. Dabei wird sich zumindest auf bildungspolitischer Ebene mit dem der Forschung zugrunde liegenden Verständnis von Bildung und Lernen kaum auseinandergesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neoliberalismus
- Evidenzbasierte Bildungsforschung
- Entwicklung der evidenzbasierten Bildungsforschung
- Evidenz
- Methoden
- Die Studie „Lernen sichtbar machen“ von John Hattie
- Vorgehen
- Methoden
- Bildungs- und Lernverständnis
- Modell des sichtbaren Lehrens und Lernens
- Ökonomisch-technokratisches Bildungs- und Lernverständnis
- Wissenschaftsverständnis
- Die Trennung von Zielen und Mitteln
- Expertenherrschaft
- Außensteuerung
- Alternativlosigkeit
- Schlussfolgerung
- Folgen eines ökonomisch-technokratisch verengten Bildungs- und Lernverständnisses
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Bildungs- und Lernverständnis der evidenzbasierten Bildungsforschung. Die zentrale These lautet, dass die evidenzbasierte Bildungsforschung von einem ökonomischen und technokratischen Bildungs- und Lernverständnis geprägt ist. Diese Verengung des Verständnisses von Bildung und Lernen wird im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung hin zur neoliberalen Technokratie betrachtet.
- Der Einfluss des Neoliberalismus auf das Bildungssystem
- Das Verständnis von Bildung und Lernen in der evidenzbasierten Bildungsforschung
- Die Kritik am ökonomisch-technokratischen Bildungs- und Lernverständnis
- Die Folgen für den Bildungsbereich und die Sonderpädagogik
- Die Bedeutung informeller Lernwege und inklusive Werte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die zentrale Arbeitshypothese. Das zweite Kapitel widmet sich dem Neoliberalismus und seinen Auswirkungen auf gesellschaftliche Transformationsprozesse. Im dritten Kapitel wird die evidenzbasierte Bildungsforschung vorgestellt, ihre Entwicklung und ihre Bedeutung für das Bildungswesen. Das vierte Kapitel präsentiert die Studie „Lernen sichtbar machen“ von John Hattie und seine Ergebnisse. Der fünfte Abschnitt beleuchtet das Wissenschaftsverständnis der evidenzbasierten Forschung und analysiert die Charakteristika ökonomischer und technokratischer Diskurse. Abschließend werden die Folgen eines ökonomisch-technokratischen Bildungs- und Lernverständnisses für den Bildungsbereich und die Sonderpädagogik betrachtet.
Schlüsselwörter
Evidenzbasierte Bildungsforschung, Neoliberalismus, Technokratie, Bildungs- und Lernverständnis, Ökonomisierung, Inklusion, Sonderpädagogik, Studie „Lernen sichtbar machen“, John Hattie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist evidenzbasierte Bildungsforschung?
Es ist ein Forschungsparadigma, das Bildungsentscheidungen auf empirisch belegte Forschungsergebnisse (Evidenz) stützen will, oft durch Meta-Analysen.
Was wird an der Studie von John Hattie kritisiert?
Die Arbeit kritisiert, dass Hatties Studie „Lernen sichtbar machen“ einem technokratischen Bildungsbegriff folgt, der informelle Lernwege und inklusive Werte vernachlässigt.
Was bedeutet „Ökonomisierung der Bildung“?
Es beschreibt den Trend, Bildung primär nach Effizienz, Messbarkeit und wirtschaftlicher Verwertbarkeit zu beurteilen, was oft mit neoliberalen Strategien einhergeht.
Welche Rolle spielt der Neoliberalismus in der Bildungsforschung?
Der Neoliberalismus fördert eine „Expertenherrschaft“ und Außensteuerung, bei der Bildung als Mittel zur Erreichung ökonomischer Ziele gesehen wird.
Warum gehen inklusive Werte verloren?
Durch die Fokussierung auf messbare Standards und Durchschnittswerte wird die individuelle Heterogenität und Wertschätzung von Vielfalt oft zweitrangig.
Was ist die zentrale Arbeitshypothese der Untersuchung?
Dass der evidenzbasierten Bildungsforschung ein verengtes, technokratisches Lernverständnis zugrunde liegt, das gesellschaftlichen Wandel hin zur neoliberalen Technokratie widerspiegelt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Evidenzbasierte Bildungsforschung. Zum Verständnis von Bildung und Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501615