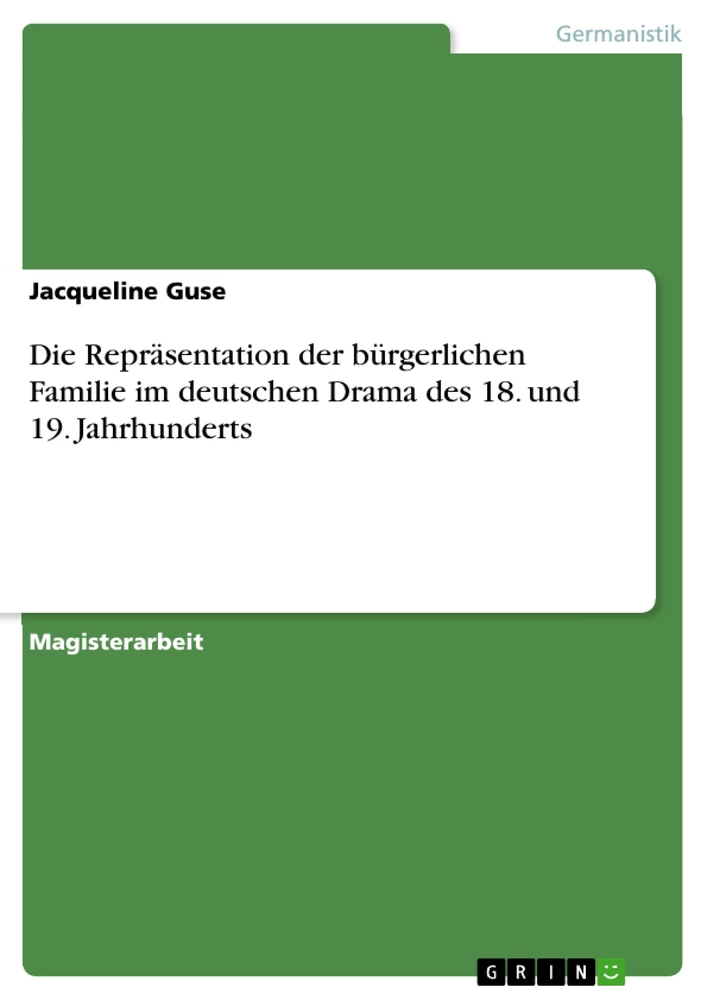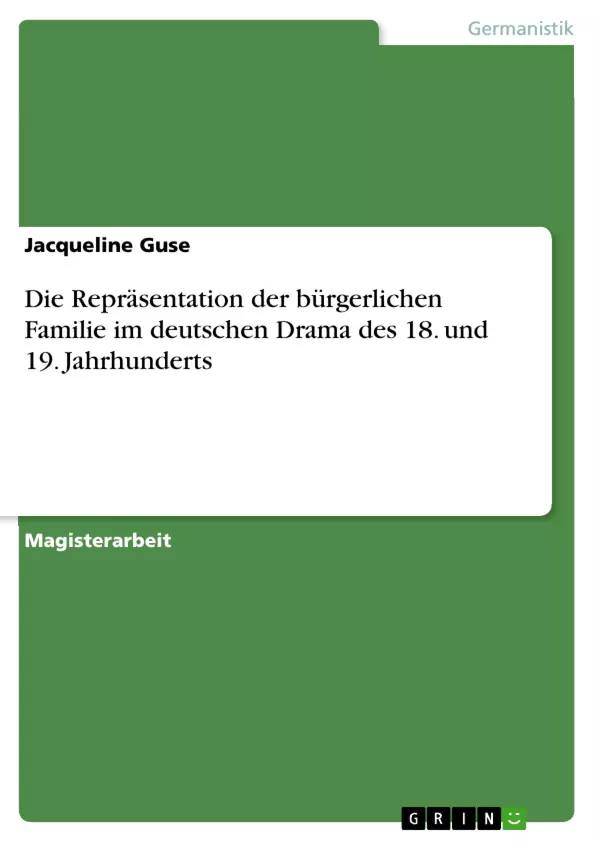In der vorliegenden Arbeit soll die Repräsentation der bürgerlichen Familie im deutschen Drama des 18. und 19. Jahrhunderts untersucht werden. Die ausgewählten Dramen sind „Miss Sara Sampson“ (1755) und „Emilia Galotti“ (1772) von Ephraim Gotthold Lessing, „Kabale und Liebe“ (1782) von Friedrich Schiller sowie „Maria Magdalene“ (1844) von Friedrich Hebbel.
Alle vier Dramen zählen zur Gattung des bürgerlichen Trauerspiels, deren Anfang „Miss Sara Sampson“ und deren Ende „Maria Magdalene“ markiert. Einerseits wurden die oben genannten Trauerspiele ausgesucht, weil sie als die bekanntesten und bedeutendsten der insgesamt über 40 Werke der Gattung gelten, andererseits, weil sie über verschiedene Epochen hinaus gemeinsame Merkmale wie die Vater-Tochter-Dyade aufweisen, die einen Vergleich der Dramen interessant machen.
Das Adjektiv „bürgerlich“ im Titel der Arbeit ist mehrdeutig. Im bürgerlichen Trauerspiel bezeichnet es primär den Stand und die Gesinnung der Protagonisten. Bis zum Ende der 70er Jahre wurde der Familie im Trauerspiel wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Erst Seebas Aufsatz „Das Bild der Familie bei Lessing“ rückte das Thema in den Blickpunkt der Forschung (vgl. Seeba, 1977). Seeba behauptet, dass die Familie bei Lessing nicht Gegenstand der Darstellung, sondern nur ein dramaturgisches Medium ist, um das Mitleid der Zuschauer zu steigern. Er beruft sich auf das 14. Stück der Hamburgischen Dramaturgie, in dem Lessing mit einem Zitat von Jean François Marmontel erklärt, dass nicht Könige oder Fürsten, sondern allein der „bloße“ Mensch als Vater, Mutter, Sohn oder Tochter rühre (vgl. Seeba, 1977: 312f.).
Im Gegensatz zu Seeba, der die Familie nur als „mitleiderregende(s) Symbol allgemein-menschlicher Verhältnisse“ sieht, zeigen die neueren Arbeiten von Karin A. Wurst (1988), Günter Saße (1988; 1996), Ulrike Horstenkamp-Strake (1995) und Christoph Lorey (1992), dass die Katastrophe in der bürgerlichen Familie selbst begründet ist (Seeba, 1977: 316). Im Zentrum der vier Trauerspiele steht die Vater-Tochter-Beziehung. Die Töchter sind im heiratsfähigen Alter, so dass der Wechsel von der Herkunfts- in die Zeugungsfamilie unmittelbar bevorsteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Entwicklung der bürgerlichen Familie im 18. und 19. Jahrhundert
- 2. Von Lessing bis Hebbel: das bürgerliche Trauerspiel
- 3. Miss Sara Sampson
- 3.1. Einführung
- 3.2. Sir William: der selbstlos liebende Vater?
- 3.3. Sara und Mellefont: mehr Frust als Lust
- 3.4. Saras Doppelmoral
- 3.5. Sara: eine Akrobatin der Tugend?
- 3.6. Saradas Opfer der Selbsttäuschung
- 4. Emilia Galotti
- 4.1. Einführung
- 4.2. Die Eltern Galotti: Gegensätze wie Stadt und Land
- 4.3. Emilia und Appiani: eine „vernünftige“ Liebe
- 4.4. Erziehung zur Unmündigkeit
- 4.5. Emilia- das Opfer der Tugend
- 5. Kabale und Liebe
- 5.1. Einführung
- 5.2. Miller und „Dessen Frau“: Eltern- statt Geschlechterliebe
- 5.3. Miller und Louise: Liebe bis zur Leidenschaft
- 5.4. Louise und Ferdinand: mehr Leid als Liebe
- 5.5. Louise das Opfer der Liebe
- 6. Maria Magdalene
- 6.1. Einführung
- 6.2. Meister Anton: „ein borstiger Igel“
- 6.3. Die Mutter: keine Hilfe für Klara
- 6.4. Karl: Aufbruch zu neuen Ufern?
- 6.5. Klaras Passionsweg
- 6.6. Klara das Opfer des Vaters
- 7. Die Familien im Vergleich
- 7.1. Einführung
- 7.2. Die Väter
- 7.2.1. „O, der rauhen Tugend!“: die Moral der Väter
- 7.2.2. Von heiß bis kalt: die Liebe der Väter
- 7.3. Vater unser..": die Töchter
- 7.4. Vergessen und verstorben: die Mütter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Repräsentation der bürgerlichen Familie im deutschen Drama des 18. und 19. Jahrhunderts und beleuchtet die Interaktion von Vater, Mutter, Tochter und Liebhaber. Ziel ist es, die Geschlechterrollen, Autoritätsstrukturen, Wertkomplexe und das individuelle Familienbewusstsein in den ausgewählten Werken von Lessing, Schiller und Hebbel zu untersuchen. Die Arbeit stellt die These auf, dass die Familie im bürgerlichen Trauerspiel nicht als ideales Modell menschlichen Zusammenlebens, sondern als Abbild des repressiven Staatssystems dargestellt wird.
- Entwicklung der bürgerlichen Familie im 18. und 19. Jahrhundert
- Die Vater-Tochter-Dyade im bürgerlichen Trauerspiel
- Die Rolle der Familie als Vehikel des sozialen Konflikts
- Die Interaktion von Geschlechterrollen und Autoritätsstrukturen
- Das Verhältnis von Familienkonvention und individueller Autonomie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einordnung der bürgerlichen Familie in den historischen Kontext des 18. und 19. Jahrhunderts und beleuchtet die Entstehung der emotionalisierten Kleinfamilie. Im zweiten Kapitel wird die Gattung des bürgerlichen Trauerspiels definiert und vom heroischen Drama abgegrenzt. Die folgenden Kapitel analysieren jeweils ein Trauerspiel:
- Kapitel 3: "Miss Sara Sampson" von Lessing: Die Analyse konzentriert sich auf die Vater-Tochter-Beziehung und die problematische Rolle von Saras Doppelmoral.
- Kapitel 4: "Emilia Galotti" von Lessing: Hier wird der Konflikt zwischen Emilia und ihrem Vater im Kontext der Erziehung zur Unmündigkeit beleuchtet.
- Kapitel 5: "Kabale und Liebe" von Schiller: Die Analyse untersucht das Verhältnis von Liebe, Leidenschaft und Familienkonvention im Kontext der Beziehung zwischen Louise und Ferdinand.
- Kapitel 6: "Maria Magdalene" von Hebbel: Die Analyse fokussiert auf die zerrüttete Vater-Tochter-Beziehung und Klaras Passionsweg.
Das letzte Kapitel vergleicht die Ergebnisse der Einzelanalysen und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Familienstrukturen der ausgewählten Werke.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der bürgerlichen Familie, dem bürgerlichen Trauerspiel, der Vater-Tochter-Beziehung, Geschlechterrollen, Autoritätsstrukturen, Familienkonvention und individueller Autonomie. Sie beleuchtet die Repräsentation dieser Themen in den Werken von Lessing, Schiller und Hebbel und stellt die These auf, dass die Familie in diesen Werken als ein repressives System dargestellt wird, das die Selbstbestimmung des Einzelnen behindert.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet das bürgerliche Trauerspiel des 18. und 19. Jahrhunderts?
Es stellt nicht mehr Könige, sondern Bürgerliche in den Mittelpunkt. Zentrale Themen sind familiäre Konflikte, Moral und der Gegensatz zwischen bürgerlicher Tugend und adliger Willkür.
Was ist die „Vater-Tochter-Dyade“?
Dies beschreibt die enge und oft problematische Beziehung zwischen Vater und Tochter in Dramen wie „Emilia Galotti“ oder „Kabale und Liebe“, die oft im Zentrum der tragischen Katastrophe steht.
Welche Rolle spielen die Mütter in diesen Dramen?
Mütter sind in diesen Werken oft abwesend, verstorben oder spielen eine untergeordnete Rolle, was die autoritäre Stellung des Vaters innerhalb der Familie betont.
Wieso wird die Familie im Drama oft als repressiv dargestellt?
Die Familie spiegelt oft die autoritären Strukturen des Staates wider. Die Forderung nach absoluter Tugend und Gehorsam behindert die individuelle Autonomie der Kinder, besonders der Töchter.
Welche Werke werden in der Arbeit verglichen?
Analysiert werden „Miss Sara Sampson“ und „Emilia Galotti“ von Lessing, „Kabale und Liebe“ von Schiller sowie „Maria Magdalene“ von Friedrich Hebbel.
- Quote paper
- Jacqueline Guse (Author), 2005, Die Repräsentation der bürgerlichen Familie im deutschen Drama des 18. und 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50181