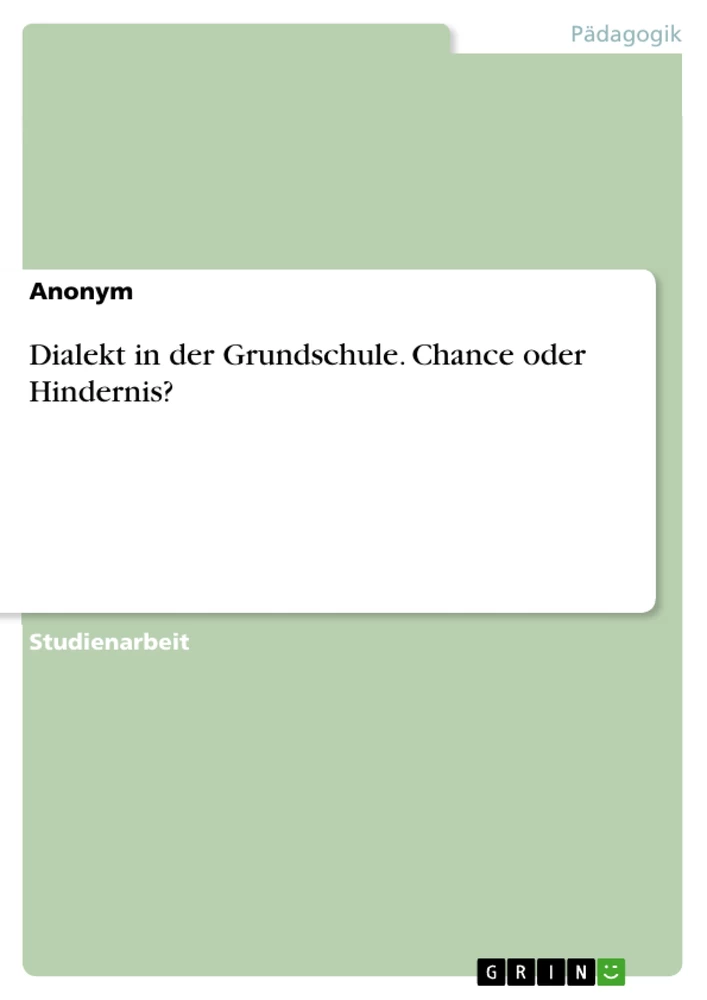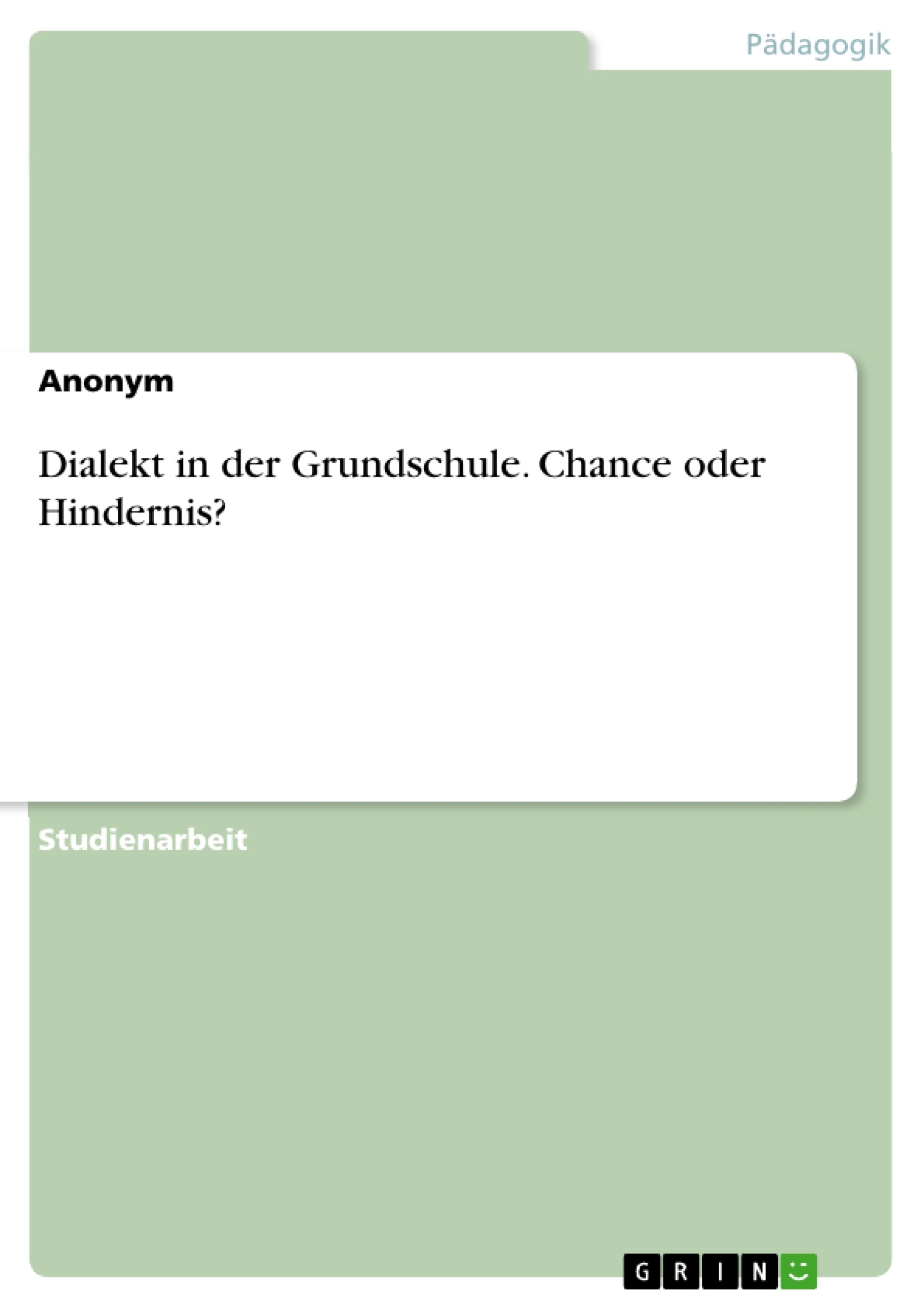In dieser Hausarbeit soll die Frage geklärt werden, ob Dialekt für Grundschüler eher eine Chance oder ein Hindernis darstellt. Dabei werden zunächst die Begriffe Dialekt und Standardsprache definiert und voneinander abgegrenzt. Weiterhin wird der historische Kontext näher erläutert und auf die Entstehung der Standardsprache eingegangen. Die sprachlichen Variationen werden nachfolgend unterschieden und genauer erklärt. Um die Fragestellung der Arbeit besser beantworten zu können, werden die kommunikativen Funktionen des Dialekts im Unterricht definiert. Danach befasst sich die Arbeit mit dem Dialekt bei Grundschülern. Dabei wird besonders auf mögliche Chancen und Risiken eingegangen sowie die Dialektthematik im Bildungsplan Baden-Württemberg 2016. Abschließend wird gezeigt, wie man diese Erkenntnisse im Unterricht umsetzen kann.
Seit einigen Jahren ist die Dialektthematik wieder in den Vordergrund gerückt. Das Bundesland Bayern hat im Jahr 2015 eine Handreichung an alle Schulen und Lehrkräfte verteilt, in welcher das Bayrische Staatsministerium für Unterricht und Kultus unter anderem Unterrichtsmaterial und Aufsätze zum Thema "Dialekt" ausgearbeitet hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Ziel der Arbeit
- Was ist ein Dialekt?
- Abgrenzung von Dialekt und Hochsprache
- Der Weg vom Dialekt zur Standardsprache
- Sprachliche Variation
- Kommunikative Funktionen des Dialekts im Unterricht
- Rolle von Dialekten in Schulen
- Chancen und Risiken für Grundschüler mit Dialekt
- Dialekt im Bildungsplan Baden-Württemberg
- Möglichkeit der Integration des Themas „Dialekt“ in den Deutschunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Dialekt im Grundschulkontext und befasst sich mit der Frage, ob Dialekt für Grundschüler eher eine Chance oder ein Hindernis darstellt. Die Arbeit befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von Dialekt und Hochsprache, beleuchtet die historische Entwicklung der Standardsprache und analysiert die sprachlichen Variationen, die im Unterricht relevant sind.
- Definition und Abgrenzung von Dialekt und Hochsprache
- Die historische Entwicklung der Standardsprache
- Die Rolle von Dialekt im Bildungsplan Baden-Württemberg
- Chancen und Risiken von Dialekt für Grundschüler
- Die Integration des Themas „Dialekt“ in den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel, „Einleitung“, erläutert die Ausgangssituation und das Ziel der Arbeit, die Beantwortung der Frage, ob Dialekt in der Grundschule eine Chance oder ein Hindernis darstellt. Im zweiten Kapitel, „Was ist ein Dialekt?“, werden die Begriffe „Dialekt“ und „Hochsprache“ definiert und voneinander abgegrenzt. Es wird die historische Entwicklung der Standardsprache beleuchtet und die sprachlichen Variationen werden erklärt. Außerdem werden die kommunikativen Funktionen des Dialekts im Unterricht analysiert. Das dritte Kapitel, „Rolle von Dialekten in Schulen“, befasst sich mit den Chancen und Risiken von Dialekt für Grundschüler. Das Kapitel analysiert die Einbindung des Themas „Dialekt“ im Bildungsplan Baden-Württemberg und zeigt Möglichkeiten für die Integration in den Deutschunterricht auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Dialekt, Hochsprache, Sprachvariation, Standardsprache, Bildungsplan Baden-Württemberg, Chancen und Risiken von Dialekt für Grundschüler, Integration von Dialekt im Deutschunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Ist Dialekt in der Schule ein Hindernis für den Lernerfolg?
Die Arbeit untersucht sowohl Risiken (wie Schwierigkeiten beim Erlernen der Standardsprache) als auch Chancen (wie kognitive Flexibilität) und kommt zu einem differenzierten Ergebnis.
Was sagt der Bildungsplan Baden-Württemberg 2016 zum Thema Dialekt?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Vorgaben des Bildungsplans, der den Umgang mit sprachlicher Variation und die Wertschätzung regionaler Dialekte thematisiert.
Wie kann Dialekt in den Deutschunterricht integriert werden?
Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Dialekte als Reflexionsgegenstand über Sprache genutzt werden können, um das Bewusstsein für Standardsprache und Sprachvariationen zu schärfen.
Was ist der Unterschied zwischen Dialekt und Standardsprache?
Die Arbeit definiert Dialekt als regional begrenzte Sprachvarietät, während die Standardsprache (Hochsprache) eine überregionale, normierte Form darstellt, die sich historisch aus Dialekten entwickelt hat.
Welche kommunikativen Funktionen hat Dialekt im Unterricht?
Dialekt kann im Klassenzimmer Nähe und Identität stiften, sollte aber klar von der geforderten Bildungssprache abgegrenzt werden, um die Ausdrucksfähigkeit der Schüler nicht einzuschränken.
Warum ist das Thema aktuell wieder in den Fokus gerückt?
Initiativen wie die Handreichung des bayerischen Kultusministeriums von 2015 zeigen ein neues Interesse daran, Dialekte als kulturelles Erbe und Ressource in der Schule zu begreifen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Dialekt in der Grundschule. Chance oder Hindernis?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502238