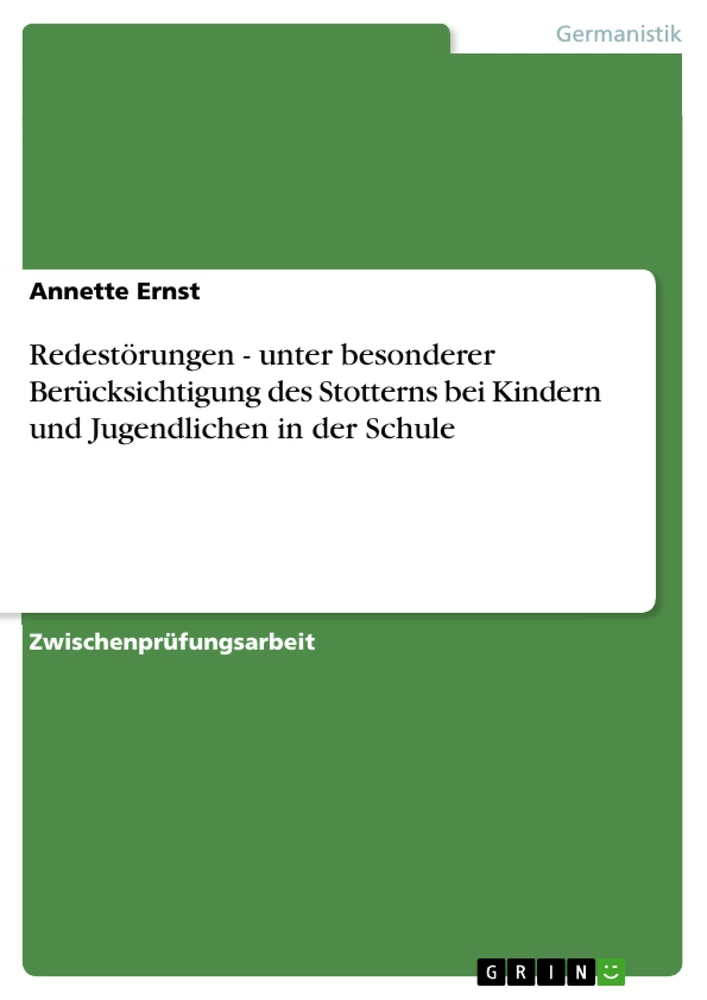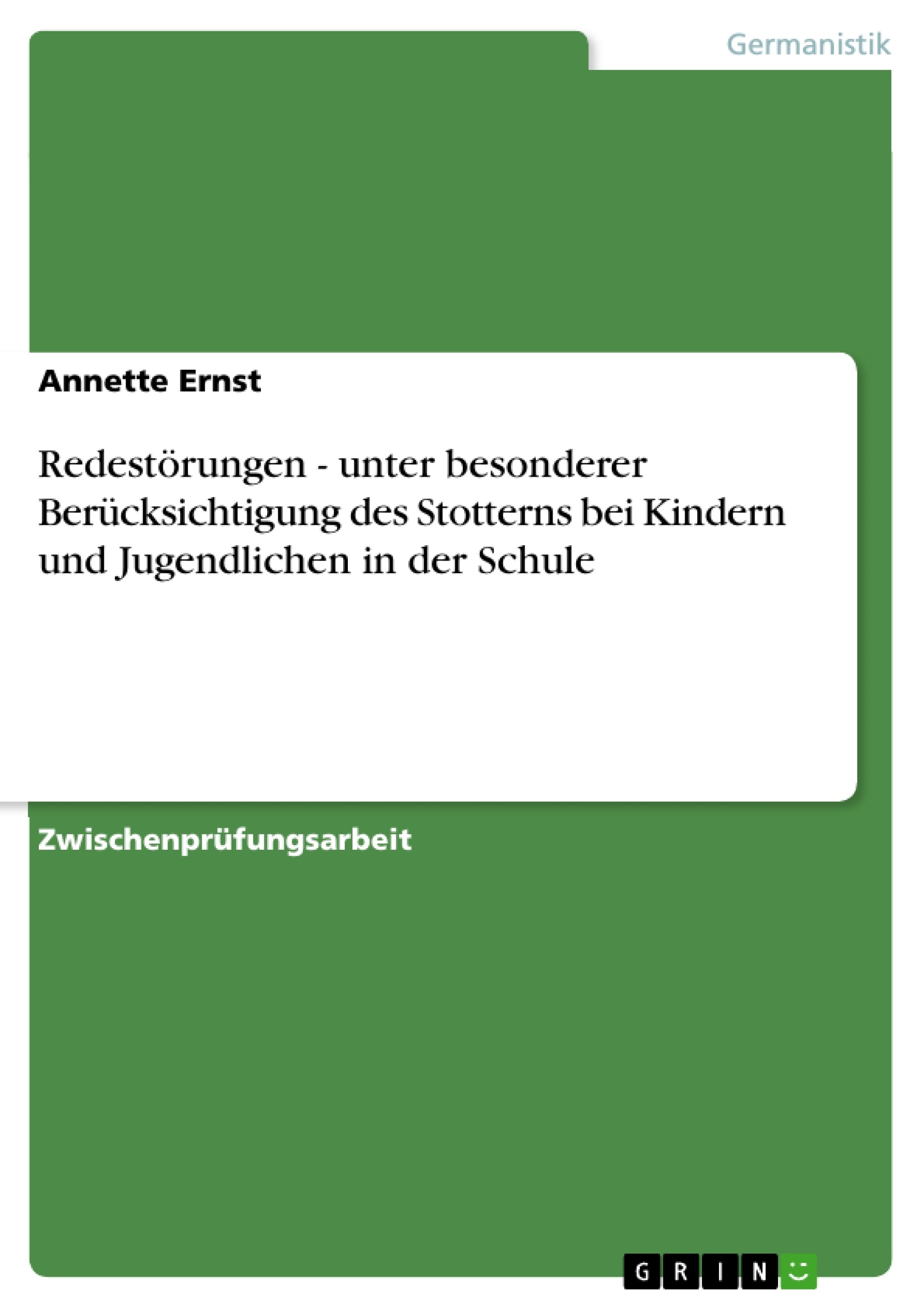„Leben heißt kommunizieren“. Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen, das sich durch Sprache von anderen Lebewesen abgrenzt. Sprache und Sprechen sind grundlegende notwendige Bedingungen des kommunikativen Handelns zwischen den Menschen. Jedes Individuum empfindet Freude beim Sprechen, die sich zuletzt auch dadurch ausdrückt, dass sich immer mehr und neuere Formen der Kommunikation im Alltagsleben durchsetzen, sei es die Nutzung einer Telefon-Flatrate oder der zunehmende Handygebrauch, der mit Inklusivminuten immer attraktiver wird. Obwohl die meisten Menschen das Sprechen fehlerfrei produzieren, gibt es dennoch Störungen der Redefähigkeit, die das Sprachvermögen einschränken und die Kommunikation belasten. Dadurch kann es vorkommen, das die motivatorische Freude an Sprechaktionen vermindert wird, der Betroffene sich selbst zurückzieht und die Störung somit bestehen bleibt. Besonders Kinder benötigen die zwischenmenschliche Interaktion für den Spracherwerb und sind durch Redestörungen, falls sie sich manifestieren, stark beeinträchtigt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Redestörungen
- 1.1 Definition des Begriffes Redeunflüssigkeit
- 1.2 Sprechangst
- 1.3 Mutismus
- 1.4 Poltern
- 1.5 Stottern
- 2. Stottern im Schulalter
- 2.1 Bedingungshintergründe
- 2.2 Spezifizierung des Erscheinungsbildes bzw. Formen der Redeunflüssigkeit
- 2.2.1 Entwicklungsbedingte, normale Redeunflüssigkeit
- 2.2.2 Auffällige Redeunflüssigkeit
- 2.2.3 Beginnendes Stottern
- 2.2.4 Manifestes Stottern
- 2.3 Besonderheiten des Stotterns im Jugendalter
- 3. Zum Umgang mit Redeunflüssigkeiten im Schulalltag
- III. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die verschiedenen Formen von Redestörungen, insbesondere das Stottern im Schulalter. Sie analysiert die Ursachen und Erscheinungsformen des Stotterns sowie die Herausforderungen, die betroffenen Kindern und Jugendlichen im Schulalltag begegnen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Redestörungen
- Analyse des Stotterns im Schulalter
- Einflussfaktoren auf das Stottern
- Umgang mit Stottern im Schulalltag
- Fördernde Maßnahmen für betroffene Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Redestörungen ein und erläutert die Bedeutung der Sprache für den Menschen. Sie stellt verschiedene Formen von Redestörungen vor, darunter Sprechangst, Mutismus, Poltern und Stottern.
Kapitel 1.1 definiert den Begriff der Redeunflüssigkeit und stellt die verschiedenen Formen und Ausprägungen dieser Störung vor. Kapitel 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 befassen sich mit den Störungsbildern Sprechangst, Mutismus, Poltern und Stottern.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Stottern im Schulalter. Hier werden die Bedingungshintergründe des Stotterns, die verschiedenen Formen des Stotterns und die Besonderheiten des Stotterns im Jugendalter analysiert.
Schlüsselwörter
Redestörung, Redeunflüssigkeit, Stottern, Sprechangst, Mutismus, Poltern, Schulalter, Jugendalter, Bedingungshintergründe, Erscheinungsbild, Förderung, Schulalltag, Umgang mit Redestörungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Redestörung und Redeunflüssigkeit?
Redeunflüssigkeit kann entwicklungsbedingt normal sein, während eine Redestörung (wie Stottern oder Poltern) das Sprachvermögen und die Kommunikation dauerhaft belastet.
Welche Formen von Redestörungen gibt es bei Kindern?
Zu den häufigsten Formen gehören Stottern, Poltern, Mutismus und Sprechangst.
Was sind die Merkmale von manifestem Stottern?
Manifestes Stottern ist durch deutliche Blockaden, Wiederholungen von Lauten oder Dehnungen gekennzeichnet, die oft mit Vermeidungsverhalten einhergehen.
Wie wirkt sich Stottern auf den Schulalltag aus?
Betroffene Schüler ziehen sich oft aus der Kommunikation zurück, was die motivatorische Freude am Sprechen mindert und soziale Interaktionen erschwert.
Was ist Poltern im Gegensatz zum Stottern?
Poltern ist durch ein überhastetes Sprechtempo und eine undeutliche Artikulation geprägt, während beim Stottern der Sprechfluss durch Unterbrechungen gestört ist.
Wie können Lehrer stotternde Schüler unterstützen?
Durch einen geduldigen Umgang, das Vermeiden von Zeitdruck und gezielte fördernde Maßnahmen im Unterricht kann die Sprechangst reduziert werden.
- Citation du texte
- Annette Ernst (Auteur), 2005, Redestörungen - unter besonderer Berücksichtigung des Stotterns bei Kindern und Jugendlichen in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50224