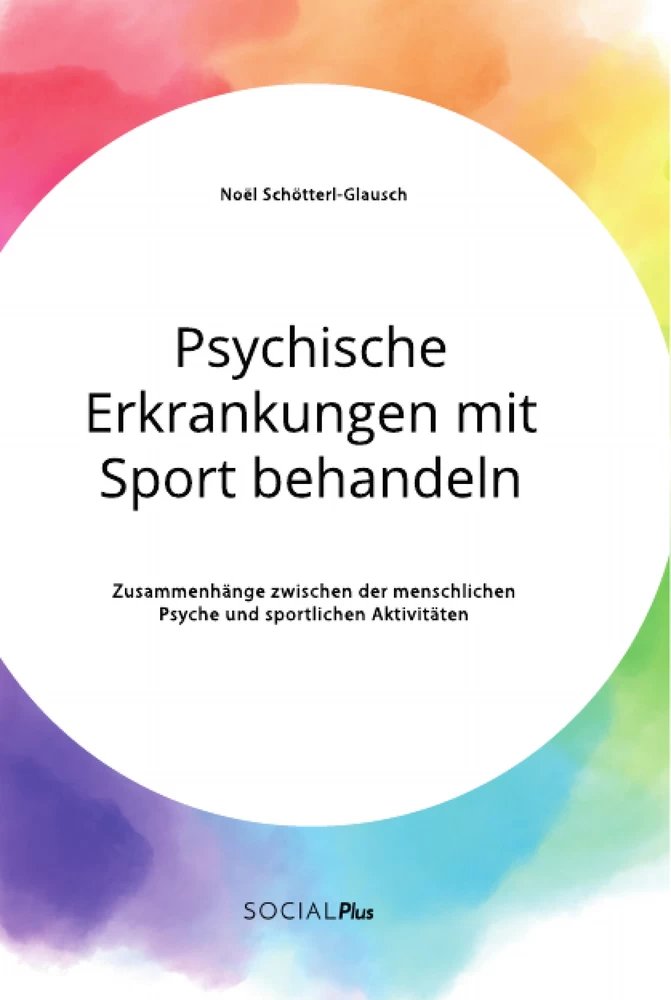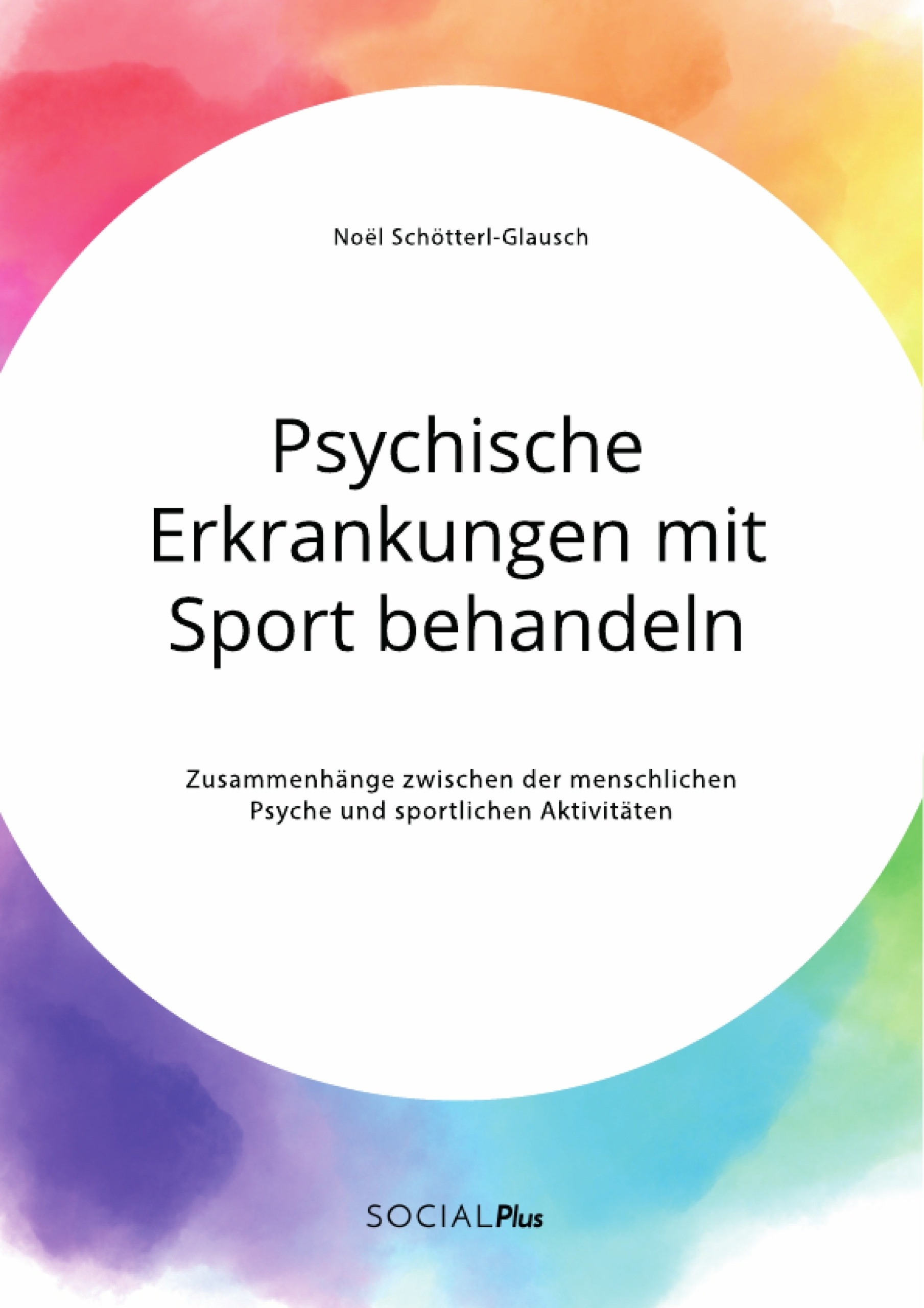Sport kann auf die Persönlichkeit des Menschen einwirken und sein Denken und Fühlen verändern. Es ist möglich, sportliche Aktivitäten bewusst zu nutzen, um das Verhalten von Individuen zu ändern. Kann dieser Effekt auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen nutzbar gemacht werden?
Wie wirkt sich Sport auf den Verstand aus und welche Bedeutung hat er für die Identität des Menschen? Kann er bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen helfen? Welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten sind vorstellbar?
Noël Schötterl-Glausch untersucht die Zusammenhänge zwischen Sport und der menschlichen Psyche. Er geht dabei speziell auf die gesundheitsfördernden Auswirkungen ein und erläutert, inwiefern Sport die Sozialarbeit mit psychisch Erkrankten unterstützen kann. Sein Buch richtet sich an die Soziale Arbeit und die Gesundheitsmedizin.
Aus dem Inhalt:
- Psychologie;
- Verstand;
- Gefühl;
- Lebensqualität;
- Stress;
- Genesung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Sport?
- Körperliche Betätigung, Leistung und Regeneration
- Motive
- Was ist Gesundheit?
- Das biomedizinische Modell
- Das Modell der Salutogenese nach Aaron Antonovsky
- Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
- Was ist eine psychische Erkrankung?
- Das Vulnerabilität-Stress-Modell
- Spezifische psychische Erkrankungen
- Sport als Ressource für Menschen mit psychischer Erkrankung
- Der biologische Aspekt
- Stress und Sport
- Psychosoziale Ressourcen in Bezug zum Gesundheitskonzept der ICF und zum Salutogenesemodell
- Sport in der Behandlung spezifischer psychischer Erkrankungen
- Die Rolle der Sozialen Arbeit
- Zuständigkeit
- Methodik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und psychischen Erkrankungen. Ziel ist es, die Wirkungsweisen von Sport auf die Psyche herauszuarbeiten und diese mit verschiedenen psychischen Erkrankungen in Verbindung zu setzen. Die Arbeit stützt sich auf bereits veröffentlichte Studien und beleuchtet die praktische Anwendung von Sport in der Sozialen Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen.
- Der Einfluss von Sport auf die menschliche Psyche
- Sport als Behandlungsressource bei psychischen Erkrankungen
- Biologische und psychosoziale Aspekte des Zusammenspiels von Sport und Psyche
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Anwendung von Sport bei psychischen Erkrankungen
- Konkrete Anwendungsmöglichkeiten von Sport in der therapeutischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Sport für die Psyche. Sie verweist auf die lange Geschichte des Sports und die Entwicklung der Sportpsychologie. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Zusammenspiels von Sport und psychischen Erkrankungen und deren Nutzen in der Behandlung. Die Arbeit wird als Untersuchung der konkreten Wirkungsweisen von Sport auf die Psyche und deren Verbindung zu psychischen Erkrankungen vorgestellt, unter Einbeziehung bereits bestehender Studien. Die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext wird ebenfalls angesprochen.
Was ist Sport?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Sport" und beleuchtet verschiedene Aspekte wie körperliche Betätigung, Leistung, Regeneration und die dahinterliegenden Motive. Es liefert ein grundlegendes Verständnis von Sport als umfassendes Konzept, das weit über reine körperliche Aktivität hinausgeht und motivationale und leistungsbezogene Komponenten beinhaltet. Die verschiedenen Facetten des Sports werden differenziert dargestellt, um einen soliden Hintergrund für die spätere Analyse des Zusammenhangs von Sport und psychischer Gesundheit zu schaffen.
Was ist Gesundheit?: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Gesundheitsmodellen, darunter das biomedizinische Modell und das Salutogenesemodell nach Antonovsky. Es integriert auch die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), um ein umfassendes Bild von Gesundheit und Krankheit zu liefern. Der Vergleich verschiedener Modelle verdeutlicht die Komplexität des Gesundheitsbegriffs und legt die Grundlage für das Verständnis psychischer Erkrankungen im Kontext der gesamten menschlichen Funktionsfähigkeit.
Was ist eine psychische Erkrankung?: Dieses Kapitel definiert psychische Erkrankungen und erläutert das Vulnerabilität-Stress-Modell. Es werden spezifische psychische Erkrankungen vorgestellt und deren Charakteristika beschrieben. Das Kapitel liefert ein detailliertes Verständnis verschiedener psychischer Erkrankungen und deren Entstehung, wobei das Vulnerabilität-Stress-Modell den Kontext von individuellen Prädispositionen und Umweltfaktoren beleuchtet. Die Beschreibung spezifischer Erkrankungen dient als Grundlage für die spätere Betrachtung des Einsatzes von Sport in der Behandlung.
Sport als Ressource für Menschen mit psychischer Erkrankung: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung von Sport bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es beleuchtet biologische Aspekte, den Einfluss von Sport auf Stress, psychosoziale Ressourcen im Kontext von ICF und Salutogenese, sowie den Einsatz von Sport in der Behandlung spezifischer psychischer Erkrankungen. Der Kapitelüberblick betont den Mehrwert von Sport als Ressource, indem verschiedene Wirkungsmechanismen und deren Relevanz für die Behandlung von psychischen Erkrankungen detailliert erläutert werden. Die Einbeziehung von ICF und Salutogenese unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz.
Die Rolle der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen durch Sport. Es behandelt die Zuständigkeiten und die methodischen Ansätze der Sozialen Arbeit in diesem Bereich. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und den konkreten Möglichkeiten, wie Soziale Arbeit Sport in ihre therapeutischen Interventionen integrieren kann, um das Wohlbefinden und die Selbstwirksamkeit Betroffener zu fördern. Die Analyse der Zuständigkeiten und Methodik beleuchtet die Interaktion verschiedener Akteure und die Rolle der Sozialen Arbeit in einem multiprofessionellen Kontext.
Schlüsselwörter
Sport, psychische Erkrankungen, Sportpsychologie, Salutogenese, ICF, Soziale Arbeit, Vulnerabilität-Stress-Modell, Behandlung, Ressourcen, psychosoziale Faktoren, biologische Aspekte, Stressmanagement.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Sport und psychische Erkrankungen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und psychischen Erkrankungen. Sie beleuchtet die Wirkungsweisen von Sport auf die Psyche und deren Verbindung zu verschiedenen psychischen Erkrankungen. Die Arbeit betrachtet auch die praktische Anwendung von Sport in der Sozialen Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Einfluss von Sport auf die menschliche Psyche; Sport als Behandlungsressource bei psychischen Erkrankungen; Biologische und psychosoziale Aspekte des Zusammenspiels von Sport und Psyche; Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Anwendung von Sport bei psychischen Erkrankungen; Konkrete Anwendungsmöglichkeiten von Sport in der therapeutischen Praxis. Die Arbeit stützt sich auf bereits veröffentlichte Studien.
Welche Gesundheitsmodelle werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Gesundheitsmodelle, darunter das biomedizinische Modell und das Salutogenesemodell nach Aaron Antonovsky. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) wird ebenfalls integriert, um ein umfassendes Bild von Gesundheit und Krankheit zu liefern.
Wie wird der Begriff "Sport" definiert?
Das Kapitel "Was ist Sport?" definiert den Begriff "Sport" und beleuchtet Aspekte wie körperliche Betätigung, Leistung, Regeneration und die dahinterliegenden Motive. Es liefert ein grundlegendes Verständnis von Sport als umfassendes Konzept, das weit über reine körperliche Aktivität hinausgeht.
Wie werden psychische Erkrankungen definiert und erklärt?
Die Arbeit definiert psychische Erkrankungen und erläutert das Vulnerabilität-Stress-Modell. Spezifische psychische Erkrankungen werden vorgestellt und deren Charakteristika beschrieben. Das Vulnerabilität-Stress-Modell beleuchtet den Kontext von individuellen Prädispositionen und Umweltfaktoren.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen durch Sport. Sie behandelt die Zuständigkeiten und methodischen Ansätze der Sozialen Arbeit und zeigt konkrete Möglichkeiten, wie Soziale Arbeit Sport in ihre therapeutischen Interventionen integrieren kann.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Was ist Sport?, Was ist Gesundheit?, Was ist eine psychische Erkrankung?, Sport als Ressource für Menschen mit psychischer Erkrankung, Die Rolle der Sozialen Arbeit und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Sport, psychische Erkrankungen, Sportpsychologie, Salutogenese, ICF, Soziale Arbeit, Vulnerabilität-Stress-Modell, Behandlung, Ressourcen, psychosoziale Faktoren, biologische Aspekte, Stressmanagement.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und psychischen Erkrankungen zu untersuchen, die Wirkungsweisen von Sport auf die Psyche herauszuarbeiten und diese mit verschiedenen psychischen Erkrankungen in Verbindung zu setzen. Die praktische Anwendung von Sport in der Sozialen Arbeit wird beleuchtet.
Wo findet man weitere Informationen?
Die vollständige Bachelorarbeit enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln und den behandelten Themen. Sie bietet eine umfassende Analyse des Zusammenhangs zwischen Sport und psychischen Erkrankungen.
- Citation du texte
- Noël Schötterl-Glausch (Auteur), 2020, Psychische Erkrankungen mit Sport behandeln. Zusammenhänge zwischen der menschlichen Psyche und sportlichen Aktivitäten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502568