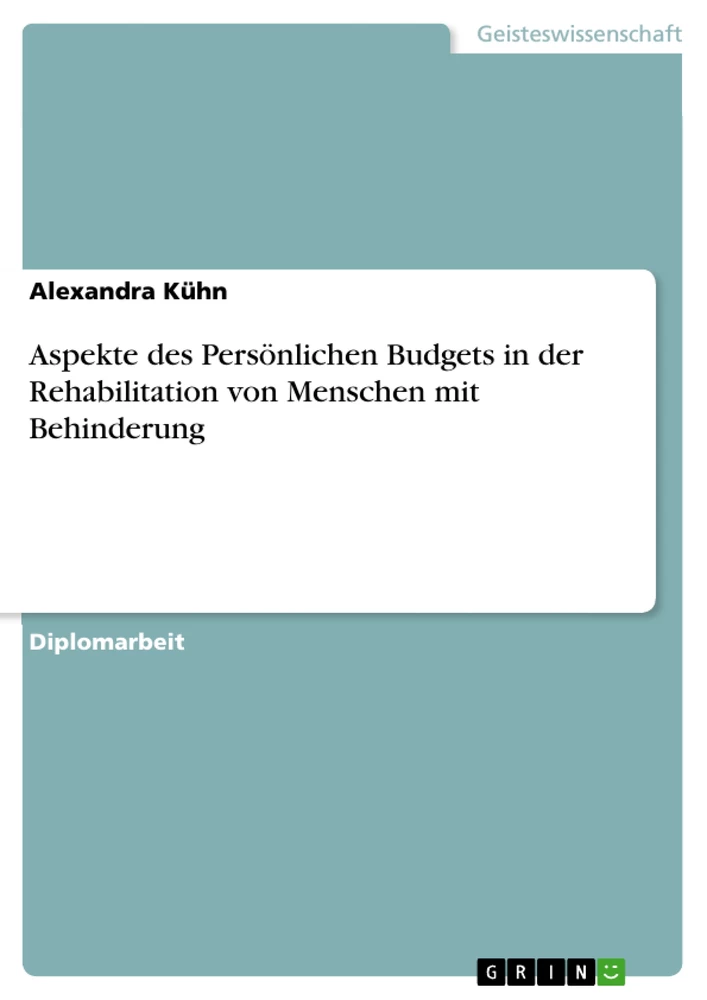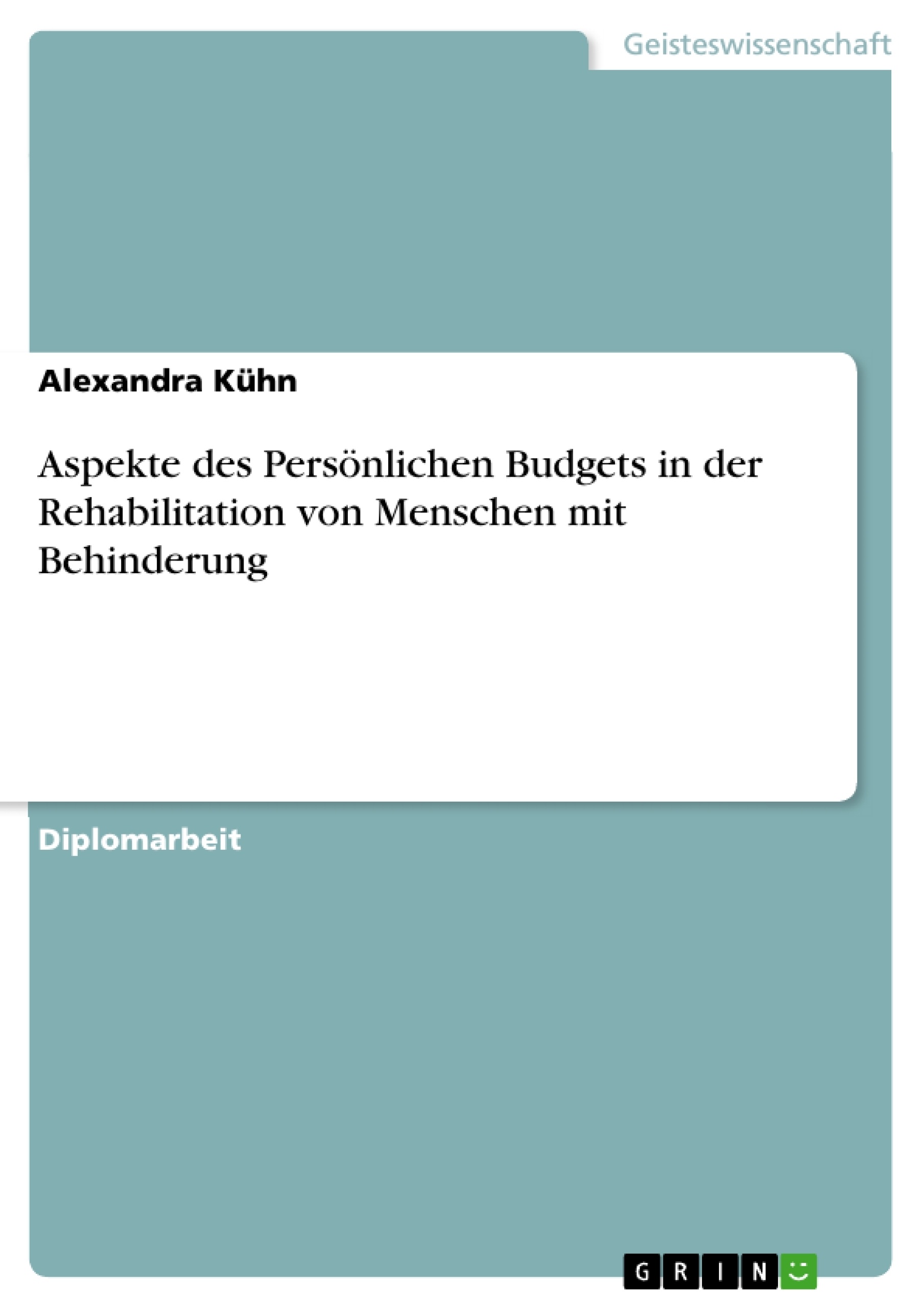Selbstbestimmung, Nutzerorientierung und Normalisierung sind einige der in den letzten Jahrzehnten geprägten Schlagworte der Behindertenpolitik.
„Im Mittelpunkt der politischen Anstrengungen stehen nicht mehr die Fürsorge und die Versorgung von behinderten Menschen, sondern ihre selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Beseitigung der Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen“ (Deutscher Bundestag 1999, S. 1).
Zur Bewältigung ihres Alltags benötigen Menschen mit Behinderung Unterstützung, Assistenz, Begleitung und Förderung unter individuellen Aspekten. Diese Hilfeleistungen werden vornehmlich von stationären oder teilstationären Einrichtungen erbracht und von den Sozialleistungsträgern finanziert.
In Deutschland wurde im Jahr 2001 durch das SGB IX erstmals der Begriff des Persönlichen Budgets (PB) eingeführt. Es wurde die Möglichkeit eröffnet, Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung durch Geld, anstelle von Sachleistungen zu erbringen. Dabei wird das bisherige Sachleistungsprinzip, das heißt der Leistungsträger bekommt Geld vom Staat und erbringt die Leistung am Betroffenen, aufgespalten. Der Betroffene soll nun dieses Geld persönlich erhalten, um damit seine Hilfeleistungen selbstbestimmt organisieren zu können.
Hier stellt sich die Frage nach den Grenzen dieses Ansatzes: Wer unterstützt die Menschen, die sei es durch körperliche Behinderungen, geistige oder psychische Beeinträchtigungen nicht selbständig in der Lage sind, ihre notwendigen Hilfeleistungen zu organisieren?
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es, diese Frage aus zwei Perspektiven zu beantworten: Die erste umfasst die Analyse, welche Unterstützung oder Beratungsleistungen Menschen mit Behinderungen benötigen, um das PB in Anspruch nehmen zu können, die zweite ist: wie das Beratungs- und Unterstützungsangebot aussieht und ob es verändert werden muss, damit das PB ein Erfolg für alle Menschen mit Behinderungen wird.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Einordnung der Begrifflichkeiten
- 1. Persönliches Budget
- 2. Rehabilitation
- 3. Behinderung
- 4. Selbstbestimmung
- III Eckpunkte des Persönlichen Budgets
- 1. Geschichtliche Entwicklung
- 2. Rechtliche Grundlagen
- 3. Ziele
- 4. Veränderungen im Sozialleistungssystem
- IV Umsetzung des Persönlichen Budgets
- 1. Das Persönliche Budget im Ausland
- 1.1 Niederlande
- 1.2 Großbritannien
- 1.3 Schweden
- 2. Modellprojekte in Deutschland
- 2.1 Allgemeiner Überblick
- 2.2 Rheinland Pfalz
- 2.3 Niedersachsen
- 3. Trägerübergreifende Projekte
- 3.1 Ziele
- 3.2 Leistungen
- 3.3 Erste Ergebnisse
- 4. Pflegebudgets
- 4.1 Ziele
- 4.2 Erste Erfahrungen aus den Modellprojekten
- V Aspekte der Beratung und Unterstützung
- 1. Grundgedanken zur Beratung und Unterstützung
- 1.1 Zur Bedeutung von Beratung und Unterstützung
- 1.2 Empowerment
- 1.3 Case-Management
- 1.4 Unterstützungsmanagement
- 2. Formen der Unterstützung und Beratung
- 2.1 Persönliche Assistenz
- 2.2 Unabhängige Beratung/Peer Counseling
- 2.3 Budgetassistenz
- 2.4 Beratungsfunktion der Leistungsträger und -anbieter
- 3. Beratung und Unterstützung in den Modellregionen
- 3.1 Rheinland Pfalz
- 3.2 Niedersachsen
- 3.3 Sonstige Modellprojekte
- 3.4 Trägerübergreifende Modellprojekte
- VI Empirischer Teil zur Beratung und Unterstützung
- 1. Methode und Gang der Untersuchung
- 1.1 Auswahl der Erhebungs- und Analysemethoden
- 1.2 Planung und Durchführung der Datenerhebung
- 1.3 Ablaufmodell der Inhaltsanalyse nach MAYRING
- 1.4 Theoriegeleitete Fragestellung und Festlegung des Datenmaterials
- 1.5 Festlegung der Analyseeinheiten und -schritte
- 2. Ergebnisse aus dem Datenmaterial
- 2.1 Ergebnisse der Zusammenfassung
- 2.2 Beratungsbedarf bezüglich des Persönlichen Budgets
- 2.3 Unterstützungsbedarf bezüglich des Persönlichen Budgets
- 2.4 Aspekte einer Budgetassistenz
- 2.5 Auswirkungen des Persönlichen Budgets
- 3. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- 3.1 Inhaltliche Strukturierung
- 3.2 Überprüfung des Kategoriensystems
- 3.3 Theorie- Praxis- Vergleich
- 3.4 Abschließende Interpretation
- VII Fazit
- 1. Chancen und Grenzen des Persönlichen Budgets
- 2. Handlungsvorschläge für die Sozialarbeit
- 3. Ausblick
- 4. Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Persönlichen Budget als Instrument zur Förderung von Selbstbestimmung in der Rehabilitation von Menschen mit Behinderung. Sie analysiert die Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen und die Ziele des Persönlichen Budgets sowie die Umsetzung in Modellprojekten in Deutschland.
- Rehabilitation und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung
- Das Persönliche Budget als Instrument der Selbstbestimmung und Teilhabe
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Ziele des Persönlichen Budgets
- Umsetzung des Persönlichen Budgets in Modellprojekten in Deutschland
- Bedeutung von Beratung und Unterstützung im Kontext des Persönlichen Budgets
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema des Persönlichen Budgets als Instrument zur Förderung von Selbstbestimmung in der Rehabilitation von Menschen mit Behinderung vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Einordnung der Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel erläutert die Kernaussagen der Begriffe Persönliches Budget, Rehabilitation, Behinderung und Selbstbestimmung im Kontext der Arbeit.
- Eckpunkte des Persönlichen Budgets: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen, die Ziele sowie die Veränderungen im Sozialleistungssystem im Kontext des Persönlichen Budgets.
- Umsetzung des Persönlichen Budgets: Dieses Kapitel analysiert die Umsetzung des Persönlichen Budgets in verschiedenen Ländern, insbesondere in Deutschland. Es beschreibt Modellprojekte, Trägerübergreifende Projekte und Pflegebudgets sowie deren Ziele und Ergebnisse.
- Aspekte der Beratung und Unterstützung: Dieses Kapitel fokussiert auf die Bedeutung von Beratung und Unterstützung im Rahmen des Persönlichen Budgets und betrachtet verschiedene Formen der Unterstützung, wie persönliche Assistenz, Budgetassistenz und Beratungsfunktionen von Leistungsträgern.
- Empirischer Teil zur Beratung und Unterstützung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Beratung und Unterstützung im Kontext des Persönlichen Budgets. Es werden Methoden und Ergebnisse der Datenerhebung und -analyse vorgestellt und die Ergebnisse interpretiert.
Schlüsselwörter
Persönliches Budget, Rehabilitation, Behinderung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Empowerment, Beratung, Unterstützung, Modellprojekte, Trägerübergreifende Projekte, Budgetassistenz, Case-Management, Unterstützungsmanagement.
- Quote paper
- Alexandra Kühn (Author), 2005, Aspekte des Persönlichen Budgets in der Rehabilitation von Menschen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50300