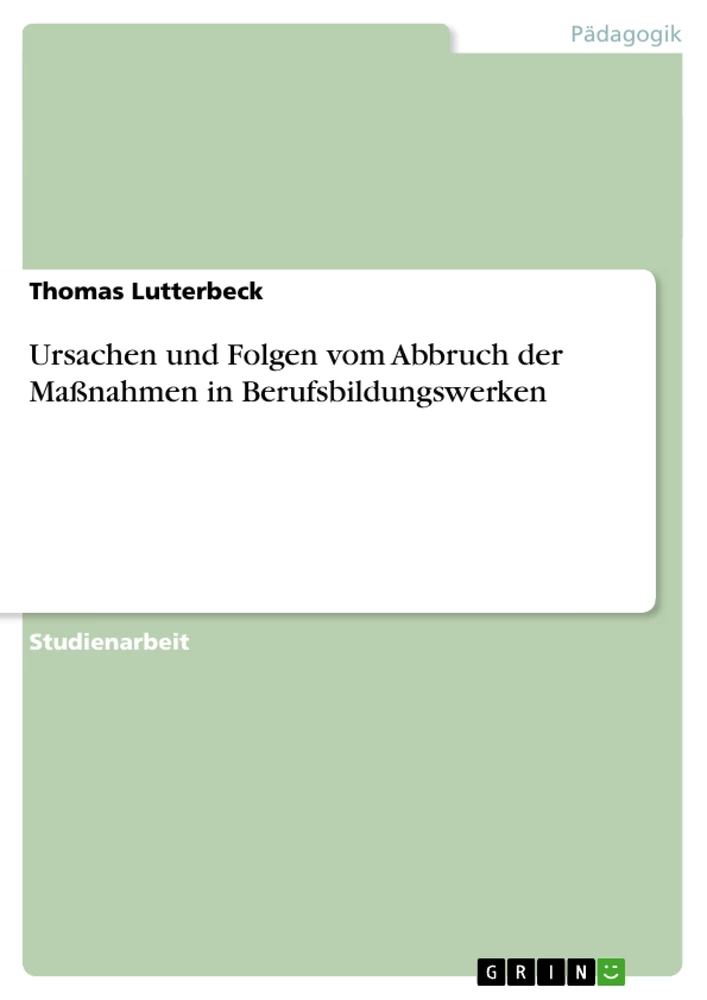Als Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation dienen deutschlandweit 52 Berufsbildungswerke dazu, Menschen mit Behinderungen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Die Berufsbildungswerke gliedern sich in Berufsschule und praktische Ausbildung nach dem dualen System in der Bundesrepublik Deutschland. Teilweise stehen noch Wohnmöglichkeiten, Freizeitangebote, begleitende Dienste sowie Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen zur Verfügung.
Es gibt aber auch Teilnehmer, die nicht bis zum vorgesehenen Ende der Ausbildung gelangen, weil sie aus verschiedenen Gründen abbrechen müssen bzw. wollen.
Nach der Einleitung folgt im Hauptteil eine Vorstellung von fünf Analysen, aus welchen wichtige Informationen zum Thema der Abbrecherproblematik zu suchen sind. Die Analysen bzw. Studien beziehen sich teilweise auf die ganze Bundesrepublik, teilweise auf die neuen Bundesländer. Es geht zeitlich betrachtet in den verschiedenen Analysen um die Jahre 1995 bis 2002.
Nach der Zusammenfassung und Darstellung der Analysen wird durch ein Interview mit einem Mitarbeiter eines Berufskollegs im Berufsbildungswerk Dortmund ein praktischer Bezug hergestellt und eine persönliche Einschätzung der Problematik aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Thema
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Hypothesen
- 2. Untersuchung
- 2.1 Texte 1-5
- 2.1.1 Text 1:
- 2.1.2 Text 2:
- 2.1.3 Text 3:
- 2.1.4 Text 4:
- 2.1.5 Text 5:
- 2.2 Zusammenfassung
- 2.3 Hypothesenüberprüfung
- 3. Schluss
- 3.1 Möglichkeiten und Chancen
- 3.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Problematik des Abbrechens von Ausbildungen in Berufsbildungswerken. Ziel ist es, Ursachen und Folgen dieses Abbrechergeschehens zu analysieren und mögliche Verbesserungen aufzuzeigen. Dazu werden verschiedene Studien und ein Interview ausgewertet.
- Ursachen für Ausbildungsabbrüche in Berufsbildungswerken
- Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und Ausbildungsabbrüchen
- Auswirkungen von Ausbildungsabbrüchen auf die Betroffenen
- Analyse verschiedener Studien zur Abbrecherproblematik
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausbildungssituation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Ausbildungsabbruchs in deutschen Berufsbildungswerken ein. Sie beschreibt die Berufsbildungswerke als Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen und definiert die verwendeten Begriffe "Teilnehmer" und "Maßnahme". Die Problemstellung benennt die hohe Abbrecherquote und die Notwendigkeit ihrer Untersuchung. Die Arbeit formuliert Hypothesen, die den Zusammenhang zwischen Abbrüchen und Sozialisation, Lernfähigkeit/Eignung und Wunschberuf thematisieren. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Auswertung von fünf Analysen, ein Interview und die Überprüfung der Hypothesen umfasst.
2. Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert fünf Studien und ein Interview, um die Ursachen und Folgen von Ausbildungsabbrüchen zu belegen. Text 1 analysiert Daten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) von 2001/2002 und zeigt eine hohe Abbrecherquote von 24,4% auf, wobei die Gründe hauptsächlich in fehlender Motivation, Sozialverhalten und medizinischen/psychischen Problemen liegen. Text 2, basierend auf der Reha-Statistik St 37, unterscheidet drei Abbruchtypen: Konfliktlösung, veränderte Handlungsalternativen und vorläufiger Ausbildungsverzicht. Text 3 untersucht den Zusammenhang zwischen familiären Verhältnissen und Ausbildungsabbrüchen anhand eines Elternfragebogens. Die weiteren Texte (2.1.4 und 2.1.5 fehlen im vorliegenden Auszug) ergänzen vermutlich diese Analysen mit weiteren Daten und Perspektiven. Das Kapitel mündet in einer Zusammenfassung der Ergebnisse und der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen.
Schlüsselwörter
Berufsbildungswerke, berufliche Rehabilitation, Ausbildungsabbruch, Abbrecherquote, Sozialisation, Lernfähigkeit, Wunschberuf, Motivation, familiäre Situation, medizinische Gründe, psychische Probleme, Konfliktlösung, Handlungsalternativen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse von Ausbildungsabbrüchen in Berufsbildungswerken
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Problematik des Abbrechens von Ausbildungen in Berufsbildungswerken. Sie analysiert die Ursachen und Folgen dieses Abbrechergeschehens und zeigt mögliche Verbesserungen auf. Die Analyse basiert auf verschiedenen Studien und einem Interview.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Ursachen und Folgen von Ausbildungsabbrüchen in Berufsbildungswerken zu analysieren und daraus resultierende Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. Es soll der Zusammenhang zwischen Abbrüchen und sozialen Faktoren, Lernfähigkeit/Eignung und Wunschberuf untersucht werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Ursachen für Ausbildungsabbrüche, den Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und Ausbildungsabbrüchen, die Auswirkungen von Ausbildungsabbrüchen auf die Betroffenen, die Analyse verschiedener Studien zur Abbrecherproblematik und Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausbildungssituation.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert fünf Studien und ein Interview. Eine Studie basiert auf Daten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) von 2001/2002. Eine weitere Studie nutzt die Reha-Statistik St 37. Eine dritte Studie untersucht den Zusammenhang zwischen familiären Verhältnissen und Ausbildungsabbrüchen mittels eines Elternfragebogens. Die genauen Details der restlichen zwei Studien und des Interviews sind im vorliegenden Auszug nicht enthalten.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Analyse der BAG BBW-Daten von 2001/2002 zeigt eine hohe Abbrecherquote von 24,4% auf, wobei die Hauptgründe in fehlender Motivation, Sozialverhalten und medizinischen/psychischen Problemen liegen. Die Reha-Statistik St 37 unterscheidet drei Abbruchtypen: Konfliktlösung, veränderte Handlungsalternativen und vorläufiger Ausbildungsverzicht. Weitere Ergebnisse aus den restlichen Studien und dem Interview werden im vorliegenden Auszug nicht detailliert dargestellt, sondern nur zusammengefasst.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Einleitung (mit Thema, Problemstellung und Hypothesen), Untersuchung (mit Analyse von fünf Studien und einem Interview sowie Zusammenfassung der Ergebnisse und Hypothesenüberprüfung) und Schluss (mit Möglichkeiten und Chancen sowie Ausblick).
Welche Hypothesen werden aufgestellt und geprüft?
Die Arbeit formuliert Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Ausbildungsabbrüchen und Sozialisation, Lernfähigkeit/Eignung und Wunschberuf. Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt im Kapitel "Untersuchung". Die genauen Hypothesen sind im vorliegenden Auszug nicht detailliert aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berufsbildungswerke, berufliche Rehabilitation, Ausbildungsabbruch, Abbrecherquote, Sozialisation, Lernfähigkeit, Wunschberuf, Motivation, familiäre Situation, medizinische Gründe, psychische Probleme, Konfliktlösung, Handlungsalternativen.
- Citation du texte
- Thomas Lutterbeck (Auteur), 2006, Ursachen und Folgen vom Abbruch der Maßnahmen in Berufsbildungswerken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50319