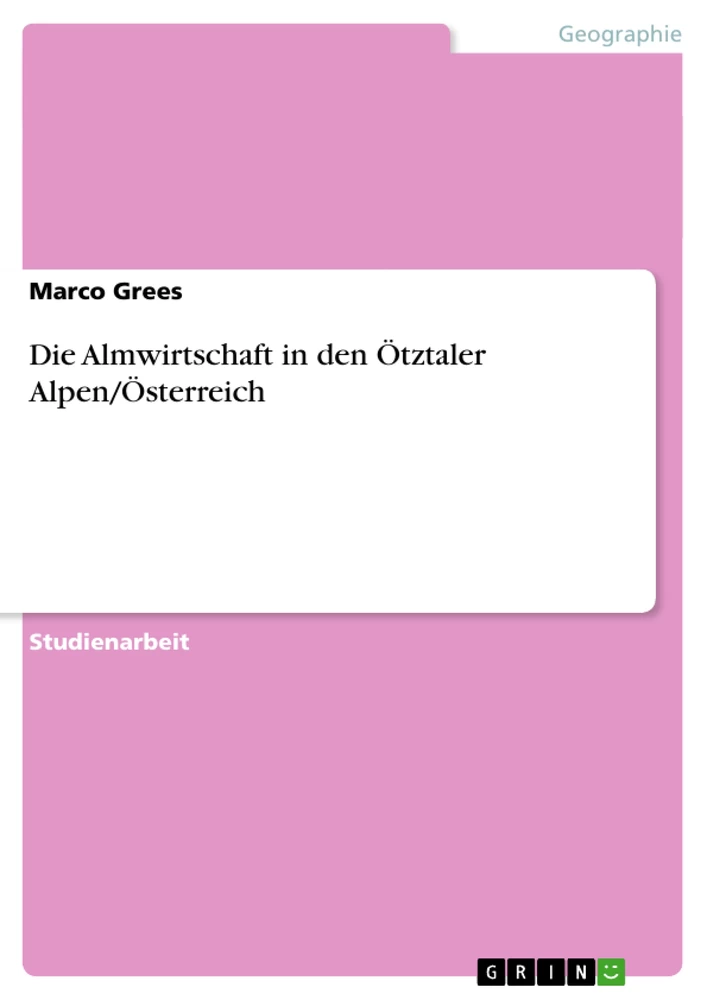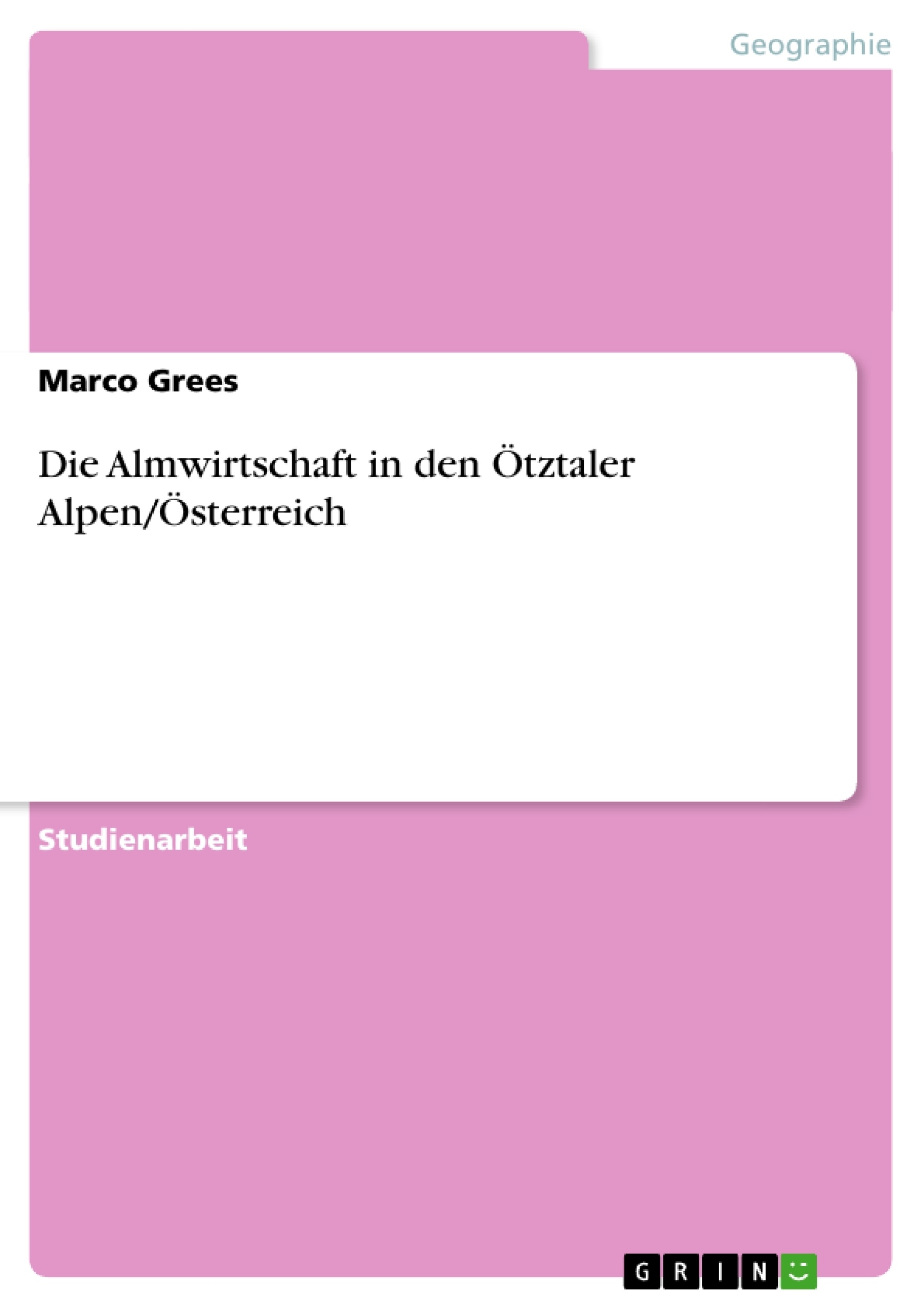Der Hang zur Tradition, der bis zum heutigen Tag in kaum einer Gesellschaftsgruppe so ausgeprägt ist, erfährt vor langer Zeit seinen Ursprung. Der harte Kampf ums Überleben jeden Winter und die enge Beziehung zum Vieh haben den Bauernstand durch die Jahrhunderte geprägt, und die Bergbauern prägten wiederum die Natur.
Seit langer Zeit zieren in Hoch- und Mittelgebirgen temporär bewohnte, bewirtschaftete und ortsfeste Kleinsiedlungen das Landschaftsbild. Diese so genannten Almen dienen seit jeher einer traditionellen Almwirtschaft, welche im Fokus dieser Arbeit stehen soll.
Auch wenn der Begriff „Alm“ im globalen Kontext nicht greifen kann, da Almen im Allgemeinen mit den Alpen oder dem bayrischen Raum assoziiert werden, so existieren weltweit ganz ähnliche Formen, etwa in den Pyrenäen, im Kaukasus oder bei den Nomaden in Tibet. Dass sich dieses Weidewirtschaftsareal weltweit finden lässt, ist somit gegeben. Die Almwirtschaft selbst kann – und das nicht erst seit heute – nicht nur als ein einfacher Zweig der Berg-Land-Wirtschaft angesehen werden. Sie ist in ein komplexes Beziehungsgefüge von Ökonomie, Ökologie und Soziokultur eingebettet. Die Funktionen dieses Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraumes sind sehr vielfältig und unser menschliches Handeln (sowie auch „Nichthandeln“) kann die unterschiedlichsten Wirkungen hervorrufen. Im Hinblick auf eine angestrebte nachhaltige Entwicklung der Almwirtschaft ist es daher notwendig, alle drei Aspekte in die Betrachtung zu integrieren.
Der Umfang dieser Arbeit wird sich somit in die Merkmale der Almen, der Almwirtschaft und der beispielhaften Darstellung dieser Wirtschaftsweise einer alpinen Region, den Ötztaler Alpen in Österreich, aufteilen.
Anschließend erfolgt eine aktuelle Situationsanalyse und ein Ausblick zur künftigen Entwicklung von Almen und Almwirtschaften, wobei diese durch ein Beispiel einer Alm in Tirol eingeleitet werden soll. Dieses Beispiel einer traditionell-modernen Alm mit multifunktionalem Angebot fungiert als Einstieg für Prognosen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Almen
- 1.1 Begriffsklärung und historischer Hintergrund
- 1.2 Die Lagen und Typen von Almen
- 1.3 Besitzverhältnisse
- 1.4 Almpersonal, Almgebäude und Almsiedlung
- 2. Die Almwirtschaft
- 2.1 Begriffsklärung, historischer Abriss und heutige Situation
- 2.2 Der Almauftrieb und der Almabtrieb
- 2.2.1 Der Almauftrieb
- 2.2.2 Der Almabtrieb
- 2.3 Funktionen der Almwirtschaft
- 2.3.1 Landwirtschaftliche Produktion
- 2.3.2 Fremdenverkehr
- 2.3.3 Natur- und Tierschutz
- 2.3.4 Schutz vor landschaftsformenden Prozessen
- 2.4 Resümee und Zukunftsaussichten
- 3. Die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen/Tirol
- 3.1 Geographische Einordnung der Ötztaler Alpen
- 3.2 Dimensionen der Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen/Tirol
- 3.2.1 Höhenlagen und Besitzverhältnisse der Almen und Hütten
- 3.2.2 Flächenanteile der Almen 1986
- 3.2.3 Tirols Almen nach Nutzungsformen 1986
- 3.2.4 Fremdenverkehrseinrichtungen auf den Almen Tirols 1986
- 3.2.5 Almauftriebszahlen Tirols nach Viehkategorien 1986
- 3.3 Die Gaislachalm bei Sölden – ein Beispiel moderner Almwirtschaft
- 3.4 Fazit, Bewertung und Prognose der Almwirtschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Almwirtschaft, insbesondere in den Ötztaler Alpen. Ziel ist es, die Bedeutung der Almwirtschaft als komplexes System aus ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Aspekten zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung, die aktuelle Situation und die Zukunftsaussichten dieser Wirtschaftsform.
- Begriff und Geschichte der Almwirtschaft
- Ökonomische, ökologische und soziale Funktionen der Almwirtschaft
- Die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen als Fallbeispiel
- Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Almwirtschaft
- Der Einfluss des Tourismus auf die Almwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Almen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Begriffsklärung des Begriffs "Alm" und beleuchtet den historischen Hintergrund der Almwirtschaft. Es beschreibt verschiedene Almtypen, deren Lagen und die damit verbundenen Besitzverhältnisse. Zusätzlich werden Aspekte wie Almpersonal, Almgebäude und Almsiedlungen detailliert behandelt, um ein ganzheitliches Bild der Almen und ihrer Bedeutung für die Landschaft zu zeichnen. Die Ausführungen liefern eine fundierte Grundlage für das Verständnis der Almwirtschaft im weiteren Verlauf der Arbeit.
2. Die Almwirtschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Almwirtschaft als komplexes System. Es beginnt mit einer Begriffsklärung und einem historischen Abriss, bevor es die heutige Situation beschreibt. Der Almauftrieb und der Almabtrieb werden als zentrale Ereignisse des landwirtschaftlichen Jahreszyklus detailliert dargestellt. Es werden die vielseitigen Funktionen der Almwirtschaft analysiert, inklusive der landwirtschaftlichen Produktion, des Fremdenverkehrs, des Natur- und Tierschutzes sowie des Schutzes vor landschaftsformenden Prozessen. Der Abschnitt schließt mit einem Resümee und einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Almwirtschaft.
3. Die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen/Tirol: Dieses Kapitel fokussiert auf die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen. Es beginnt mit einer geographischen Einordnung der Ötztaler Alpen und analysiert dann die Dimensionen der Almwirtschaft in dieser Region. Die Analyse umfasst Höhenlagen und Besitzverhältnisse der Almen und Hütten, Flächenanteile, Nutzungsformen, den Einfluss des Fremdenverkehrs und die Anzahl des aufgetriebenen Viehs. Ein detailliertes Beispiel einer modernen Almwirtschaft, die Gaislachalm bei Sölden, veranschaulicht die vielseitigen Herausforderungen und Möglichkeiten der Almwirtschaft in der heutigen Zeit. Das Kapitel endet mit einem Fazit, einer Bewertung und einer Prognose der Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen.
Schlüsselwörter
Almwirtschaft, Ötztaler Alpen, Tirol, Berglandwirtschaft, Nachhaltigkeit, Tourismus, Tradition, Landwirtschaftliche Produktion, Natur- und Tierschutz, Landschaftspflege, Almen, Almauftrieb, Almabtrieb, Besitzverhältnisse, Höhenlagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Almwirtschaft, insbesondere in den Ötztaler Alpen in Tirol. Sie beinhaltet eine Einleitung, ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Almwirtschaft als komplexes System aus ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Aspekten, unter Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklung, der aktuellen Situation und der Zukunftsaussichten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 befasst sich mit dem Begriff "Alm", seiner historischen Entwicklung und verschiedenen Almtypen. Kapitel 2 analysiert die Almwirtschaft als System, inklusive Almauftrieb, Almabtrieb und ihren verschiedenen Funktionen (Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz etc.). Kapitel 3 konzentriert sich auf die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen, untersucht deren Dimensionen und veranschaulicht dies anhand des Beispiels der Gaislachalm bei Sölden.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Almwirtschaft als komplexes System zu beleuchten. Die Themenschwerpunkte umfassen die Begriffsbestimmung und historische Entwicklung der Almwirtschaft, ihre ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen, die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen als Fallbeispiel, die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven sowie den Einfluss des Tourismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Almwirtschaft, Ötztaler Alpen, Tirol, Berglandwirtschaft, Nachhaltigkeit, Tourismus, Tradition, Landwirtschaftliche Produktion, Natur- und Tierschutz, Landschaftspflege, Almen, Almauftrieb, Almabtrieb, Besitzverhältnisse, Höhenlagen.
Wie ist das Kapitel über die Almen aufgebaut?
Das Kapitel "Almen" bietet eine umfassende Begriffsklärung und einen historischen Überblick. Es beschreibt verschiedene Almtypen, deren Lage und die damit verbundenen Besitzverhältnisse. Zusätzlich werden Almpersonal, Almgebäude und Almsiedlungen detailliert behandelt, um ein ganzheitliches Bild der Almen und ihrer Bedeutung für die Landschaft zu zeichnen.
Was wird im Kapitel über die Almwirtschaft behandelt?
Das Kapitel "Die Almwirtschaft" analysiert die Almwirtschaft als komplexes System. Es umfasst eine Begriffsklärung, einen historischen Abriss und eine Beschreibung der heutigen Situation. Der Almauftrieb und Almabtrieb werden detailliert dargestellt, ebenso die verschiedenen Funktionen der Almwirtschaft (landwirtschaftliche Produktion, Tourismus, Natur- und Tierschutz, Schutz vor landschaftsformenden Prozessen). Das Kapitel schließt mit einem Resümee und Zukunftsaussichten.
Wie wird die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen dargestellt?
Das Kapitel "Die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen/Tirol" fokussiert auf die Almwirtschaft in dieser Region. Es beinhaltet eine geographische Einordnung, eine Analyse der Dimensionen (Höhenlagen, Besitzverhältnisse, Flächenanteile, Nutzungsformen, Fremdenverkehr, Viehzahlen) und ein detailliertes Beispiel der Gaislachalm bei Sölden. Es schließt mit einem Fazit, einer Bewertung und Prognose der Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen.
- Citar trabajo
- Marco Grees (Autor), 2005, Die Almwirtschaft in den Ötztaler Alpen/Österreich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50395