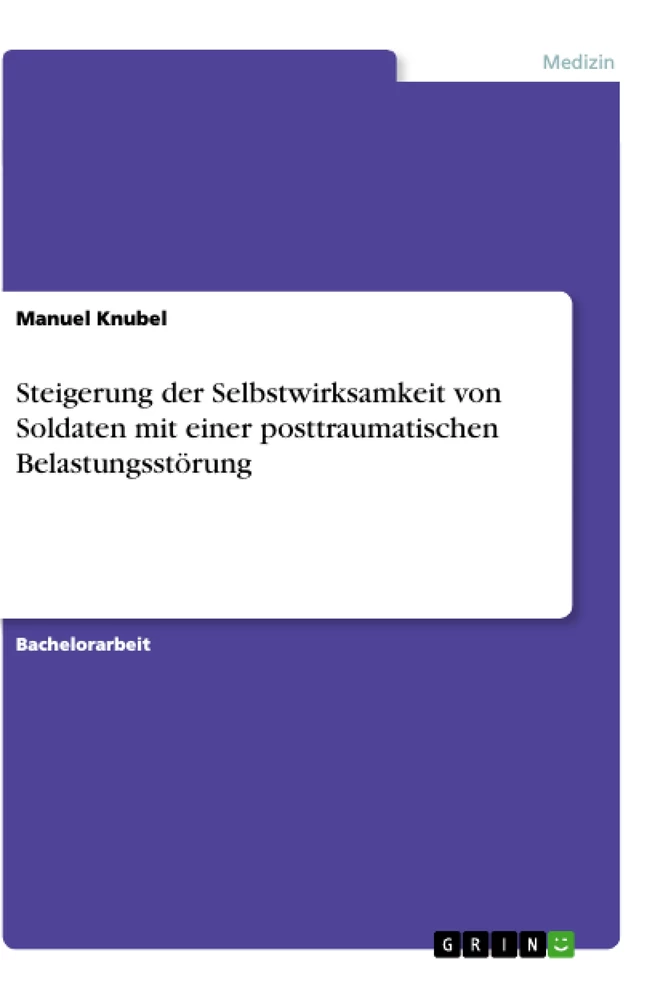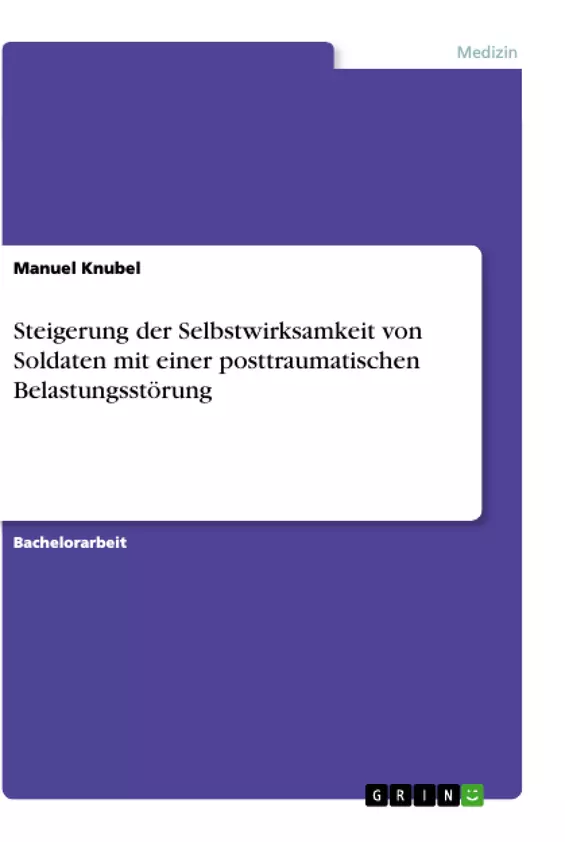Diese Arbeit untersucht die Selbstwirksamkeit sowie das habituelle Wohlbefinden von Soldaten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung mittels einer prospektiven Prä-Post-Befragung bei einer Trainings- und einer Kontrollgruppe an einer Sportschule der Bundeswehr. Dabei wird ein umfassendes individuelles Gesundheitskonzept vermittelt, welches auf die praktische Durchführung von professionell angeleitetem Sport ausgerichtet ist. Dazu zählen funktionelles Kräftigungstraining mit und ohne Gerät, Ausdauer- und Koordinationstraining und die Vermittlung von theoretischem Wissen in den Bereichen Gesundheit, Training, Ernährung und Psychoedukation.
Die Selbstwirksamkeit und das allgemeine Wohlbefinden, welches sich in körperliche, psychische und soziale Zufriedenheit kategorisieren lässt, sind feste Größen im Leben. Ein permanent positiv ausgeprägtes allgemeines Wohlbefinden sollte das Ziel jedes Menschen sein. Es ist die Basis, um den alltäglichen Herausforderungen im sich aufhaltenden Setting begegnen und gegen diese bestehen zu können. Diese Grundhaltung beeinflusst die eigene Einstellung zu auftretenden Problemen. Je häufiger Probleme oder Herausforderungen eigenständig, durch Beobachtung anderer, durch Motivation von außen oder über die emotionale Ebene bewältigt werden, desto ausgeprägter kann die eigene Selbstwirksamkeitserwartung sein und damit die Einschätzung der aktuellen Lebensqualität und des allgemeinen habituellen Wohlbefindens positiver ausfallen. Bestimmte Lebens- und Arbeitsbedingungen können diese Variablen negativ beeinflussen.
Eine Berufsgruppe, die davon besonders betroffen ist, ist die der Soldatinnen und Soldaten. Im Rahmen von Auslandseinsätzen, den damit verbundenen außergewöhnlichen Lebensumständen (fremdes Land, andere Kultur, andere Religion, veränderte Lebensumstände, soziale und persönliche Einschränkung durch Abwesenheit von Zuhause und damit von Familie und Freunden), den gesammelten Eindrücken (Eigenbeschuss, Kampfhandlung, Tod und Verwundung) und den gemachten Erfahrungen tendiert dieser Personenkreis durch direkten oder indirekten Einfluss auf das physische, psychische und soziale Befinden vermehrt an traumatischen Störungen zu erkranken, die sich im weiteren Verlauf zu einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Posttraumatische Belastungsstörung
- 3.1.1 Traumatadefinition
- 3.1.2 Symptomatik einer PTBS
- 3.1.3 Körperliche Aktivität als Behandlungsansatz für PTBS
- 3.2 Selbstwirksamkeit
- 3.2.1 Definition
- 3.2.2 Theorien
- 3.3 Allgemeines habituelles Wohlbefinden
- 3.3.1 Definition
- 3.3.2 Theorien
- 3.4 Kurze Darstellung der Ausgangslage
- 4 Methodik
- 4.1 Studiendesign
- 4.2 Stichprobe
- 4.3 Intervention
- 4.4 Messung der abhängigen Variablen
- 4.4.1 Selbstwirksamkeitserwartung
- 4.4.2 Allgemeines habituelles Wohlbefinden
- 4.5 Datenanalyse/Statistik
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Allgemeine Daten
- 5.2 Selbstwirksamkeitserwartung
- 5.3 Allgemeines habituelles Wohlbefinden
- 6 Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob die Steigerung der Selbstwirksamkeit und des allgemeinen habituellen Wohlbefindens von Soldaten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) im Rahmen der lehrgangsgebundenen Ausbildung möglich ist.
- Definition und Symptomatik der PTBS
- Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und allgemeinem Wohlbefinden
- Körperliche Aktivität als Behandlungsansatz für PTBS
- Methoden zur Erfassung von Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden
- Evaluation der Wirksamkeit einer lehrgangsgebundenen Ausbildung auf die Selbstwirksamkeit und das Wohlbefinden von Soldaten mit PTBS
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Selbstwirksamkeit und des Wohlbefindens bei Soldaten mit PTBS ein. Es erläutert die Bedeutung dieser Variablen für die Lebensqualität und die Bewältigung von Herausforderungen im Alltag.
- Kapitel 2: Zielsetzung: In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen und die Ziele der Arbeit dargelegt.
- Kapitel 3: Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu den Themen PTBS, Selbstwirksamkeit, allgemeines Wohlbefinden und der Rolle von körperlicher Aktivität bei der Behandlung von PTBS.
- Kapitel 4: Methodik: Dieses Kapitel beschreibt das Studiendesign, die Stichprobe, die Intervention und die Methoden zur Erfassung der abhängigen Variablen (Selbstwirksamkeitserwartung und allgemeines habituelles Wohlbefinden). Es werden außerdem die statistischen Verfahren zur Datenanalyse erläutert.
- Kapitel 5: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, die die Effekte der Intervention auf die Selbstwirksamkeit und das Wohlbefinden der teilnehmenden Soldaten zeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Selbstwirksamkeit, allgemeines habituelles Wohlbefinden, körperliche Aktivität, lehrgangsgebundene Ausbildung und Soldaten.
Häufig gestellte Fragen
Wie hilft Sport Soldaten mit einer PTBS?
Gezielter Sport verbessert das Körpergefühl, baut Stress ab und steigert die Selbstwirksamkeit, was entscheidend für die psychische Stabilisierung nach traumatischen Erlebnissen ist.
Was versteht man unter Selbstwirksamkeit bei Traumapatienten?
Selbstwirksamkeit ist der Glaube an die eigene Fähigkeit, schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen zu können.
Welche Symptome sind typisch für eine PTBS bei Soldaten?
Häufige Symptome sind Flashbacks, Schlafstörungen, soziale Isolation sowie eine dauerhafte Übererregung des Nervensystems infolge von Einsatzerlebnissen.
Was ist das Ziel des Gesundheitskonzepts an der Bundeswehr-Sportschule?
Das Ziel ist eine ganzheitliche Förderung durch Kräftigungstraining, Ausdauersport und Psychoedukation, um das habituelle Wohlbefinden der Soldaten nachhaltig zu steigern.
Kann körperliche Aktivität eine Therapie ersetzen?
Sport dient als wichtiger ergänzender Behandlungsansatz, sollte aber in der Regel Teil eines umfassenden therapeutischen Gesamtkonzepts sein.
- Quote paper
- Manuel Knubel (Author), 2017, Steigerung der Selbstwirksamkeit von Soldaten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504065