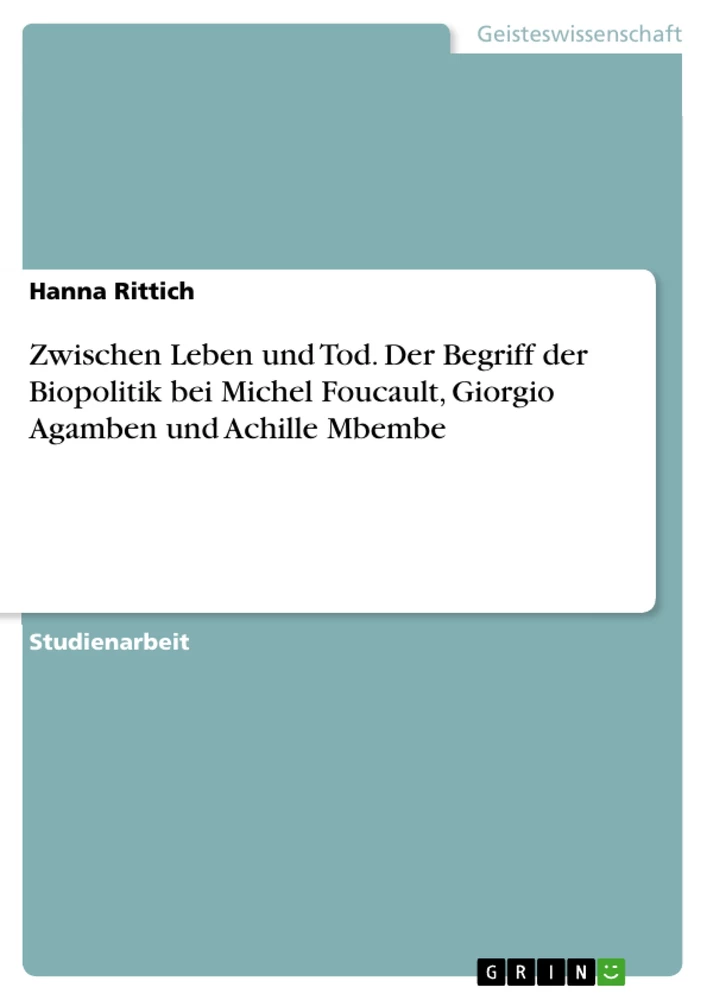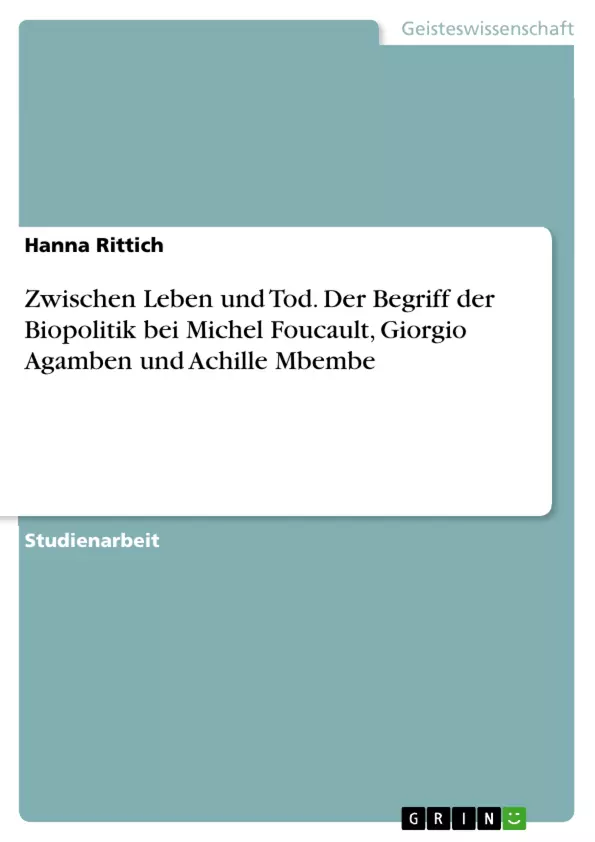Diese Arbeit setzt sich mit dem Begriff der Biopolitik auseinander, wobei die Kontroverse zwischen der Befürwortung und der Dementierung des Lebens ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist. Es sollen die Zusammenhänge zwischen Foucaults Biopolitik und Agambens Thanatopolitik, welche die Kehrseite der Biopolitik darstellt, aufgezeigt werden. Den Ausgang dieser Arbeit liefert eine Begriffseinordnung der Biopolitik, gefolgt von jener Definition, die auf Foucaults Ansichten beruht. Der Kontrast, den die Thanatopolitik von der Biopolitik abgrenzt, soll dann mit Hilfe von Agamben herausgearbeitet werden. Zum Schluss möchte ich anhand Achille Mbembes Nekropolitik eine Erweiterung Agambens Standpunkt aufzeigen.
Durch seine Grundidee der Biopolitik gelang es Michel Foucault den Begriff der Macht auf eine völlig neue, fundamentale Art und Weise zu betrachten. Und zwar in einem Modell, das nicht an die Begriffe wie Souveränität oder Recht gekoppelt war. Aus diesem Modell heraus ließ sich eine Analyse der Moderne entwickeln, die den Diskurs innerhalb der Humanwissenschaften nachhaltig verändert hat. Dieses neuartige Machtkonzept, welches die Produktivität, das Leben und die Lebensprozesse in den Fokus rückt und in einem ganz deutlichen Kontrast zur Souveränitätsmacht steht, stößt jedoch auf Probleme, sobald es mit geschichtlichen Realitäten konfrontiert wird. Denn die technischen Fortschritte der Moderne haben nicht nur Errungenschaften hervorgebracht, welche das Leben fördern und erhalten sollen, sondern auch jene, die das Leben in großem Maße vernichten können. Die blutigsten Kriege und Genozide sind Teil dieser Epoche und ein fester Bestandteil der Politik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biopolitik und Bio-Macht
- Foucaults Genealogie der Biopolitik
- Der Tod im Dienste des Lebens
- Thanatopolitik und Nekropolitik
- Das nackte Leben und der Ausnahmezustand
- Agambens alternative Genealogie der Biopolitik
- Das Lager als biopolitischer Raum
- Nekropolitik – Die verallgemeinerte Instrumentalisierung der menschlichen Existenz
- Die Entwicklung der Biopolitik nach Mbembe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte der Biopolitik bei Michel Foucault, Giorgio Agamben und Achille Mbembe. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven auf Biopolitik, Thanatopolitik und Nekropolitik zu vergleichen und zu kontrastieren, um ein umfassenderes Verständnis der Machtverhältnisse in der Moderne zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet den Bedeutungswandel des Verhältnisses von Leben und Tod im Kontext politischer Strategien.
- Foucaults Genealogie der Biopolitik und der Macht über Leben und Tod
- Agambens Kritik an Foucault und die Einführung der Thanatopolitik
- Mbembes Konzept der Nekropolitik als Erweiterung von Agambens Ansatz
- Der Einfluss von technologischem Fortschritt auf die Biopolitik
- Die Rolle von Leben und Tod in modernen politischen Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Biopolitik ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Sie beschreibt Foucaults neuartiges Machtkonzept und dessen Problematik im Umgang mit historischen Realitäten wie Kriegen und Genoziden. Die Arbeit fokussiert auf den Kontrast zwischen Biopolitik und Thanatopolitik, und erweitert diesen durch Mbembes Nekropolitik. Sie kündigt eine Begriffsbestimmung der Biopolitik an, gefolgt von einer Analyse Foucaults, Agambens und Mbembes.
Biopolitik und Bio-Macht: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Biopolitik und seine vielschichtigen Bedeutungen. Es beginnt mit einer Diskussion des Begriffs im Kontext zeitgenössischer Themen wie Gentechnik und Rassismus, um dann auf Foucaults ursprüngliche Definition einzugehen. Das Kapitel hebt hervor, dass Biopolitik nicht nur staatliche Regulation, sondern auch die Selbstregulation von Individuen umfasst. Es wird der Einfluss des Staates auf die Lebensführung der Bürger und die gleichzeitig stattfindende Selbstbestimmung der Individuen erörtert, mit Beispielen wie Pränataldiagnostik oder Schönheitsoperationen.
Foucaults Genealogie der Biopolitik: Dieses Kapitel analysiert Foucaults Konzept der Biopolitik als Machttechnologie, die sich mit Lebensprozessen und dem Verhältnis von Geburten- und Sterberaten beschäftigt. Es verweist auf Foucaults These, dass der moderne Mensch ein Tier ist, dessen Leben in der Politik auf dem Spiel steht. Das Kapitel hebt den Bedeutungswandel des Todes im Kontext der Fortschritte in der Medizin hervor, der von einer omnipräsenten Bedrohung zu etwas scheinbar Beherrschbarem wurde. Foucaults Arbeiten „Die Geburt der Klinik“ und seine Vorlesungen werden im Kontext der Machtausübung analysiert.
Schlüsselwörter
Biopolitik, Bio-Macht, Thanatopolitik, Nekropolitik, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Achille Mbembe, Macht, Leben, Tod, Moderne, Gouvernementalität, Disziplinargesellschaft, Ausnahmezustand, Lager.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Biopolitik, Thanatopolitik und Nekropolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konzepte der Biopolitik bei Michel Foucault, Giorgio Agamben und Achille Mbembe. Sie vergleicht und kontrastiert verschiedene Perspektiven auf Biopolitik, Thanatopolitik und Nekropolitik, um ein umfassenderes Verständnis der Machtverhältnisse in der Moderne zu entwickeln und den Bedeutungswandel des Verhältnisses von Leben und Tod im Kontext politischer Strategien zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Foucaults Genealogie der Biopolitik und der Macht über Leben und Tod, Agambens Kritik an Foucault und die Einführung der Thanatopolitik, Mbembes Konzept der Nekropolitik als Erweiterung von Agambens Ansatz, den Einfluss technologischen Fortschritts auf die Biopolitik und die Rolle von Leben und Tod in modernen politischen Strategien.
Welche Autoren werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Konzepte der Biopolitik von Michel Foucault, Giorgio Agamben und Achille Mbembe. Sie vergleicht ihre unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven.
Was ist Biopolitik nach Foucault?
Foucault versteht Biopolitik als eine Machttechnologie, die sich mit Lebensprozessen und dem Verhältnis von Geburten- und Sterberaten beschäftigt. Er argumentiert, dass der moderne Mensch ein Tier ist, dessen Leben in der Politik auf dem Spiel steht. Der Bedeutungswandel des Todes im Kontext medizinischer Fortschritte – von einer omnipräsenten Bedrohung zu etwas scheinbar Beherrschbarem – spielt eine zentrale Rolle in Foucaults Analyse.
Was ist Thanatopolitik nach Agamben?
Agamben entwickelt das Konzept der Thanatopolitik als Kritik an Foucaults Biopolitik. Seine Analyse konzentriert sich auf das Verhältnis von „nacktem Leben“ und Ausnahmezustand und die Rolle des Lagers als biopolitischer Raum.
Was ist Nekropolitik nach Mbembe?
Mbembe erweitert Agambens Ansatz mit dem Konzept der Nekropolitik, das die verallgemeinerte Instrumentalisierung der menschlichen Existenz beschreibt. Er analysiert die Entwicklung der Biopolitik und ihre Auswirkungen auf die Macht über Leben und Tod.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik und die Forschungsfragen einführt. Es folgen Kapitel zu Biopolitik und Bio-Macht, Foucaults Genealogie der Biopolitik, Thanatopolitik und Nekropolitik (inklusive Agambens und Mbembes Ansätzen) und abschließend ein Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Biopolitik, Bio-Macht, Thanatopolitik, Nekropolitik, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Achille Mbembe, Macht, Leben, Tod, Moderne, Gouvernementalität, Disziplinargesellschaft, Ausnahmezustand, Lager.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich akademisch mit den Konzepten der Biopolitik, Thanatopolitik und Nekropolitik auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich besonders für Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich der Politikwissenschaft, Philosophie, Soziologie und verwandter Disziplinen.
- Quote paper
- Hanna Rittich (Author), 2018, Zwischen Leben und Tod. Der Begriff der Biopolitik bei Michel Foucault, Giorgio Agamben und Achille Mbembe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506198