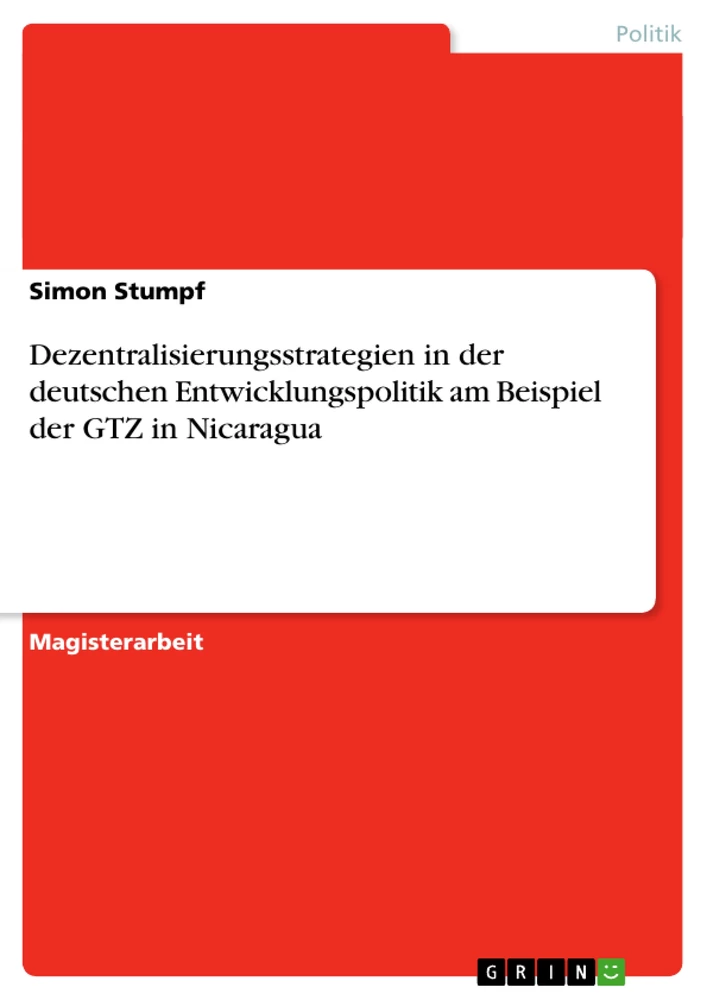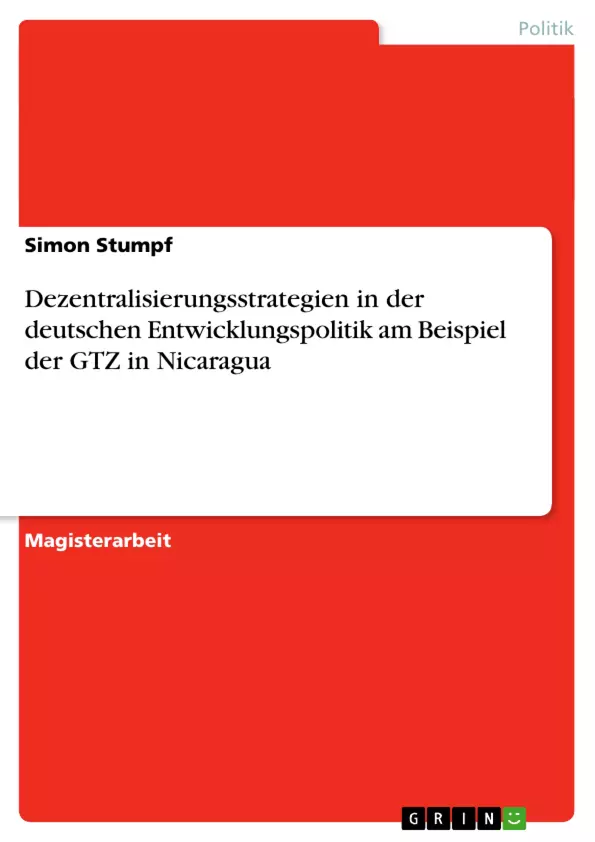In der im Jahr 2000 in New York verabschiedeten Milleniumserklärung, wie auch in dem damit verbundenen Aktionsprogramm 2015 der Bundesregierung, wird ausdrücklich die Bedeutung einer verantwortungsvollen und effizienten Regierungsführung („good governance“) als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung und damit zur Erreichung des globalen Entwicklungsziels der Armutsbekämpfung hervorgehoben. Daher richtet die Bundesrepublik Deutschland die Schwerpunkte ihrer bilateralen Zusammenarbeit daraufhin aus. In diesem Bereich nehmen Vorhaben zu den Themen Dezentralisierung und Kommunalentwicklung eine wichtige Position ein.
Der Begriff „good governance“ wurde von der Weltbank bereits gegen Ende der 80er Jahre in Folge der Strukturanpassungsstrategien in die entwicklungspolitische Diskussion eingeführt. Er entstand aus der Erfahrung, dass entwicklungspolitische Maßnahmen keinen Erfolg haben können, wenn nicht gewisse Mindeststandards an politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorhanden sind. Unmittelbar danach haben auch in Deutschland die Bemühungen, Einfluss auf die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Partnerländer zu nehmen, stark an Bedeutung gewonnen. „Good governance“ ist daher nicht nur ein entwicklungspolitisches Rahmenkonzept, sondern auch ein wichtiges Förderkriterium, welches die Vergabe deutscher bilateraler Hilfe konditioniert. Diese Kriterien sind somit Voraussetzung und Inhalt deutscher Entwicklungspolitik.
Zur Erreichung dieses Ziels bilden Dezentralisierungsvorhaben ein wichtiges Handlungsfeld und sind integraler Bestandteil von „good governance“-Strategien, da sie direkt Einfluss auf den allgemeinen politisch-gesellschaftlichen Rahmen eines Landes zu nehmen versuchen. Die deutsche Entwicklungspolitik beabsichtigt daher durch Dezentralisierung die demokratische Ausrichtung eines Staates zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen zum Begriff der Dezentralisierung
- 2.1. Entwicklungspolitische Einordnung des Begriffs Dezentralisierung
- 2.2. Definitionen und Typologien des Begriffs Dezentralisierung
- 2.3. Der Dezentralisierungsbegriff in der deutschen Entwicklungspolitik
- 2.4. Dezentralisierung und "Multi-Level Governance" - Versuch der Klärung eines begriffsimmanenten Missverständnisses
- 3. Die Stellung der GTZ in der deutschen Entwicklungspolitik
- 3.1. Kontinuität und Wandel der deutschen Entwicklungspolitik seit 1990
- 3.2. Institutionelle Grundstrukturen der deutschen Entwicklungspolitik
- 3.3. Die GTZ als „quasi-staatliches“ Durchführungsorgan Technischer Zusammenarbeit
- 4. Methodische Grundlagen
- 4.1. Grundlegendes zur qualitativen Forschung
- 4.2. Ethnographische Feldforschung
- 4.3. Verwendete Erhebungsverfahren der qualitativen Datenanalyse
- 4.3.1. Das Problemzentrierte Interview
- 4.3.2. Das Narrative Interview
- 4.3.3. Teilnehmende Beobachtung
- 4.4. Dateninterpretationsverfahren
- 4.4.1. Objektive Hermeneutik
- 4.4.2. Qualitative Inhaltsanalyse
- 4.5. Forschungsvorgehen
- 5. Der Dezentralisierungsprozess in Nicaragua
- 5.1. Die Geschichte der Gemeinden in Nicaragua
- 5.1.1. Die historische Bedeutung der Gemeinden
- 5.1.2. Die Rolle der Gemeinden während der Somoza - Diktatur
- 5.1.3. Der revolutionäre Einschnitt der Sandinisten
- 5.1.4. Das Ende der Sandinisten und die große Reformwelle zu Beginn der 90er Jahre
- 5.2. Räumliche und sozioökonomische Charakterisierung der Gemeinden
- 5.2.1. Die aktuelle politisch-administrative Aufteilung Nicaraguas
- 5.2.2. Geographische Struktur des Landes, der Regionen und der Gemeinden
- 5.2.3. Sozioökonomische Charakteristika
- 5.3. Normativer Rahmen der Dezentralisierung
- 5.3.1. Die Verfassung
- 5.3.2. Das Gemeindegesetz (\"Ley de los municipios\")
- 5.3.3. Die Gemeindeverordnung (“Reglamento a la Ley de Municipios”)
- 5.3.4. Sonstige gesetzliche Regelungen
- 5.4. Politische Repräsentation und Partizipation
- 5.4.1. Die territoriale Repräsentation auf der zentralstaatlichen Ebene
- 5.4.2. Das Kommunalwahlsystem
- 5.4.3. Formelle Partizipationsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft auf lokaler Ebene
- 5.5. Die Gemeindeautonomie
- 5.6. Institutioneller Rahmen der Gemeinde-Ebene
- 5.6.1. Der Bürgermeister und der Vizebürgermeister
- 5.6.2. Der Gemeinderat (,,Concejo Municipal\")
- 5.6.3. Verwaltungsbehörden in den Gemeinden und ihre technische Qualifikation
- 5.7. Das Finanzierungssystem der Gemeinden
- 5.8. Die Sonderstellung der Atlantikküste
- 5.9. Der Dezentralisierungsprozess in Nicaragua - ein kritisches Zwischenfazit
- 5.1. Die Geschichte der Gemeinden in Nicaragua
- 6. Die Strategieentwicklung der GTZ an ausgewählten politischen Prozessmarken
- 6.1. Kursorischer Überblick über die Arbeit der GTZ in Nicaragua
- 6.2. Normativer Rahmen des Dezentralisierungsprozesses
- 6.2.1. Die Situation der GTZ vor der Verfassungsreform von 1995
- 6.2.2. Von der Verfassungsreform zur Gemeindegesetzreform
- 6.2.3. Die Gemeindegesetzreform und der Einstieg der GTZ in den Dezentralisierungsprozess
- 6.3. Politisch-konzeptioneller Rahmen des Dezentralisierungsprozesses
- 6.3.1. Der prozessinhärente Partikularismus der Dezentralisierung in Nicaragua
- 6.3.2. Erste Programmbildung der GTZ und Erarbeitung der Nationalen Dezentralisierungspolitik
- 6.3.3. Die wahrgenommene Bedeutung der nationalen Dezentralisierungspolitik und ihre problematische Wertschätzung
- 6.4. Fiskaldezentralisierung
- 6.4.1. Ressourcenknappheit der Gemeinden und das lange geforderte Transferzahlungsgesetz
- 6.4.2. Der Einfluss der GTZ auf das Transferzahlungsgesetz und die Initiierung des Programms PRODELFIS
- 6.4.3. Die strategische (Neu-)Ausrichtung der GTZ nach der Neuregelung des Gemeindefinanztransfers
- 7. Die deutschen Beratungsstrategien im Dezentralisierungsprozess in Nicaragua - ein kurzes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dezentralisierungsstrategien der GTZ in Nicaragua. Sie analysiert die Rolle der GTZ im Kontext der deutschen Entwicklungspolitik und beleuchtet den Einfluss der GTZ auf den Dezentralisierungsprozess in Nicaragua.
- Die theoretischen Grundlagen des Begriffs Dezentralisierung
- Die Stellung der GTZ in der deutschen Entwicklungspolitik
- Der Dezentralisierungsprozess in Nicaragua
- Die Strategien der GTZ im Dezentralisierungsprozess in Nicaragua
- Die Auswirkungen der GTZ-Strategien auf den Dezentralisierungsprozess in Nicaragua
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Methodik vor. Das zweite Kapitel analysiert die theoretischen Grundlagen des Begriffs Dezentralisierung und beleuchtet die verschiedenen Definitionen und Typologien. Das dritte Kapitel untersucht die Stellung der GTZ in der deutschen Entwicklungspolitik und beleuchtet die institutionellen Rahmenbedingungen der deutschen Entwicklungspolitik. Das vierte Kapitel befasst sich mit den methodischen Grundlagen der Arbeit und beschreibt die angewendeten Forschungsmethoden. Das fünfte Kapitel analysiert den Dezentralisierungsprozess in Nicaragua und beleuchtet die Geschichte der Gemeinden, die räumlichen und sozioökonomischen Charakteristika sowie den normativen Rahmen der Dezentralisierung. Das sechste Kapitel untersucht die Strategien der GTZ im Dezentralisierungsprozess in Nicaragua.
Schlüsselwörter
Dezentralisierung, GTZ, Nicaragua, deutsche Entwicklungspolitik, Gemeindeentwicklung, Politikberatung, Good Governance, Partizipation, Fiskaldezentralisierung, Transferzahlungen
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Good Governance“ in der Entwicklungspolitik?
Es bezeichnet eine verantwortungsvolle Regierungsführung, die als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung gilt.
Welche Rolle spielt die GTZ in Nicaragua?
Die GTZ (heute GIZ) agiert als Durchführungsorgan für technische Zusammenarbeit und unterstützt Nicaragua insbesondere bei Dezentralisierungsprozessen und Kommunalentwicklung.
Was ist das Ziel der Dezentralisierung in Nicaragua?
Ziel ist die Stärkung der Gemeindeautonomie und die Förderung demokratischer Strukturen durch die Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen auf die lokale Ebene.
Was versteht man unter Fiskaldezentralisierung?
Es handelt sich um die Ausstattung der Kommunen mit eigenen finanziellen Ressourcen und gesetzlich geregelten Transferzahlungen vom Zentralstaat.
Wie hat die GTZ den Dezentralisierungsprozess beeinflusst?
Durch Politikberatung, die Unterstützung bei Gesetzgebungsreformen (z.B. Gemeindegesetz) und Programme zur Verbesserung der kommunalen Finanzsysteme.
- Arbeit zitieren
- M.A. pol. Simon Stumpf (Autor:in), 2005, Dezentralisierungsstrategien in der deutschen Entwicklungspolitik am Beispiel der GTZ in Nicaragua, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50785