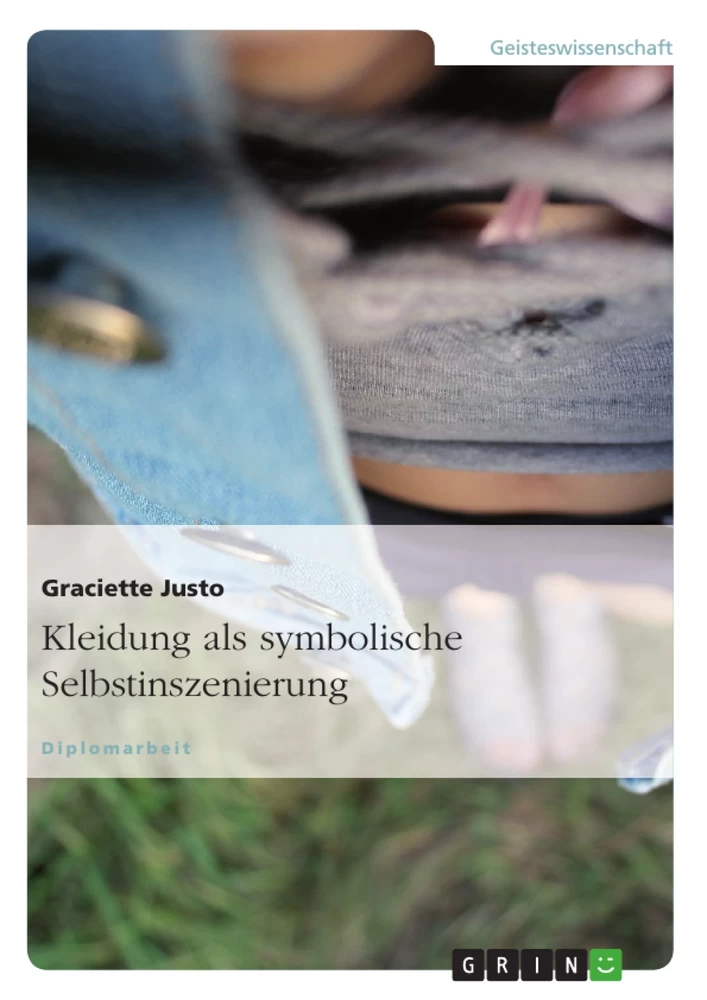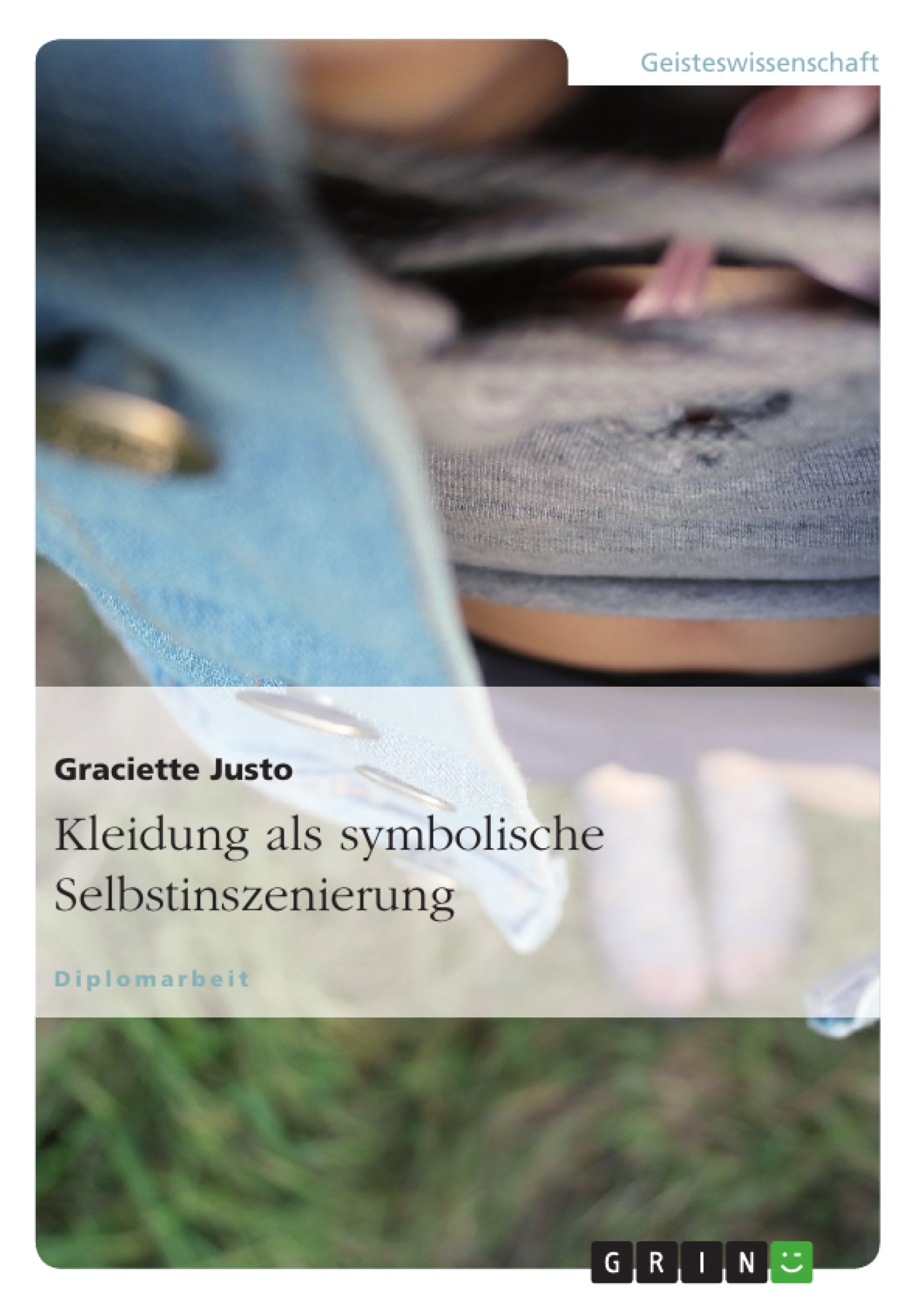Kleidung ist die zweite Haut des Menschen, welche an- und ablegbar ist. Diese Hülle, in die wir uns täglich begeben, kann dünn und luftdurchlässig oder dick bis panzerartig sein. Sie variiert von praktisch bis dekorativ, bequem bis ungemütlich, schick bis schlampig und auffällig bis tarnend. Verhüllungsgrad wie auch Kombinationsmöglichkeiten sind hochgradig variabel ... Was hat es damit auf sich?
Kleidung scheint ein Sprachrohr zu sein, ein Menschheitsphänomen an Kommunikation, denn sie drückt aus, "äußert" sich, bezieht Stellung.
Was sagt sie aus? Wie tut sie dies? Und warum?
Diese wissenschaftliche Arbeit besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilen: Die Kleidungsgestaltung an sich, ihr Kommunikationsaspekt und die Selbstinszenierung durch Kleidung.
Zunächst wird das Kleiderverhalten allgemein bzw. werden Antrieb und Ursprungsbedürfnis des Menschen zum Kleidungsverhalten beleuchtet (Gegenüberstellung verschiedener Theorien).
Weiter wird Kleidung als nonverbale Kommunikationsform untersucht und ihre Kommunikationsfunktion wird erläutert (Botschaftsinhalte, Kleidersymbolik, Kleidernormen, vestimentäre Sprache als subtile Ergänzung der begrenzten verbalen Sprache).
Zuletzt wird die Kleidersprache als Selbstdarstellungsform betrachtet (Repräsentation des Selbst, Selbstausdruck versus Ausdruck des idealen Selbst, Kleidung als Maskierungsform, Funktion der vestimentären Selbstgestaltung), sowie ihre Macht und unterschätzte Wirkung auf die Umwelt und das Selbstbild des Trägers.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der innere Antrieb des Kleidungsverhaltens
- I.1. Die Schutz-Theorie
- I.2. Die Scham-Theorie
- I.3. Die Schmuck-Theorie
- I.4. Die Ausdrucksfunktion im Schmücken und Verhüllung
- II. Selbstausdruck: Die kommunikative Leistung der Kleidung
- II.1. Die Botschaftsbereiche der Kleidung
- II.1.1. Gruppenzugehörigkeit
- II.1.2. Status
- II.1.3. Persönlichkeit
- II.1.4. Interpersonale Einstellungen
- II.1.5. Gefühlslage
- II.1.6. Parallelität & Bewusstheitsgrad der Kommunikationsbereiche
- II.2. Erkennung
- II.3. Kleidersprache als subtile Ergänzung verbaler Sprache
- II.4. Das Verstehen der Kleidersprache - Strukturelle Gesetzmäßigkeiten
- II.4.1. Kleidersymbolik
- II.4.1.1. Symbole der Kennzeichnung
- II.4.1.2. Symbole der Dekoration
- II.4.1.3. Die Beweglichkeit der Symbole
- II.4.1.3.1. Situative und gruppenspezifische Variabilität
- II.4.1.3.2. Der jeweilige Kontext gestaltet die Symbolik
- II.4.2. Kleidernormen
- II.4.2.1. Allgemeine Kombinationsnormen
- II.4.2.2. Situationsabhängigkeit der Normen
- II.4.2.3. Normen zu Signalen der Gruppenzugehörigkeit
- II.5. Zusammenfassung
- III. Die Selbstinszenierung durch Kleidung
- III.1. Repräsentation und Kompensation
- III.2. Kleidung: Selbstausdruck oder Ausdruck des idealen Selbst
- III.2.1. Die Selbstausdrucks-Theorie
- III.2.2. Die Persönlichkeits-Theorie
- III.2.3. Die Impression-Management-Theorie
- III.2.4. Die Theorie des idealen Selbst
- III.2.5. Die Theorie der symbolischen Selbstergänzung
- III.2.6. Kleidung - ein inszenierter Ausdruck
- III.3. Schein und Sein - Kleidung und Person
- III.3.1. Kleidung als Korrektur am Körper
- III.3.2. Die Manipulation in der Kleidersprache
- III.4. Die vestimentäre Selbstinszenierung als Maske
- III.4.1. Die verhüllende Funktion
- III.4.2. Die präsentierende Funktion
- III.4.3. Der Kompromiss in unseren Maskierungen
- IV. Die Macht der vestimentären Selbstinszenierung
- IV.1. Die Wirkung auf die Umwelt
- IV.1.1. Personale und soziale Funktion
- IV.2. Die Wirkung auf den Träger selbst
- IV.2.1. Der Einfluss auf das Selbstbild
- IV.2.2. Stabilisierung des Selbstbildes durch die Umweltreaktion
- IV.2.3. Selbstinszenierung als Anerkennungssuche
- IV.3. Fazit: Wechselwirkung
- IV.4. Der Nutzen der Täuschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Kleidung als symbolische Selbstinszenierung. Ziel ist es, das komplexe Zusammenspiel zwischen Kleidung, Kommunikation und der Konstruktion des Selbst zu beleuchten. Die Arbeit verknüpft verschiedene theoretische Ansätze und empirische Befunde.
- Der innere Antrieb des Kleidungsverhaltens
- Kleidung als nonverbale Kommunikation
- Die Selbstinszenierung durch Kleidung und deren Strategien
- Die Wirkung von Kleidung auf den Träger und die Umwelt
- Die Bedeutung von Kleidernormen und -symbolik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der innere Antrieb des Kleidungsverhaltens: Dieses Kapitel erforscht die grundlegenden Motive hinter dem menschlichen Bedürfnis nach Kleidung. Es analysiert verschiedene Theorien, wie die Schutz-, Scham- und Schmucktheorie, um die ursprünglichen Funktionen von Kleidung zu erklären. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Kleidung von einem rein funktionalen Schutzbedürfnis hin zu einem Ausdruck von Individualität und sozialer Zugehörigkeit. Die Verschmelzung von Schutz, Scham und Schmuck wird als zentrale Motivation für das Kleidungsverhalten herausgestellt, wobei die Ausdrucksfunktion im Schmücken und Verhüllen besonders hervorgehoben wird. Die verschiedenen Perspektiven ermöglichen ein differenziertes Verständnis der komplexen Beweggründe des Kleidungsverhaltens.
II. Selbstausdruck: Die kommunikative Leistung der Kleidung: Kapitel II analysiert Kleidung als eine Form nonverbaler Kommunikation. Es wird untersucht, welche Botschaften durch Kleidung übermittelt werden können, wie z.B. Gruppenzugehörigkeit, Status, Persönlichkeit, interpersonale Einstellungen und Gefühlslage. Die Arbeit beleuchtet die Komplexität der Interpretation von Kleidungssymbolen und die Rolle des Kontextes. Der Abschnitt über strukturelle Gesetzmäßigkeiten der Kleidersprache (Kleidersymbolik und Kleidernormen) bietet ein detailliertes Verständnis der Regeln und Konventionen, die die Interpretation von Kleidung beeinflussen. Die Zusammenfassung betont die subtile und vielschichtige Natur der Kommunikation durch Kleidung und deren enge Verknüpfung mit verbaler Kommunikation.
III. Die Selbstinszenierung durch Kleidung: Dieses Kapitel widmet sich der Selbstinszenierung durch Kleidung. Es werden verschiedene Theorien wie die Selbstausdrucks-, Persönlichkeits- und Impression-Management-Theorie sowie die Theorie des idealen Selbst und der symbolischen Selbstergänzung vorgestellt und deren Relevanz für das Verständnis von Kleidung als Mittel der Selbstpräsentation diskutiert. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit Kleidung den Selbstausdruck widerspiegelt oder ein idealisiertes Selbstbild präsentiert. Es wird die Rolle von Kleidung als Kompensation, Korrektur und Manipulation analysiert, wobei die vestimentäre Selbstinszenierung als Maske mit ihren verhüllenden und präsentierenden Funktionen im Mittelpunkt steht. Das Kapitel erörtert den komplexen Umgang mit Schein und Sein in Bezug auf Kleidung und Persönlichkeit.
IV. Die Macht der vestimentären Selbstinszenierung: Der abschließende Teil der Arbeit untersucht die Wirkung der vestimentären Selbstinszenierung auf die Umwelt und den Träger selbst. Die Analyse der personalen und sozialen Funktionen von Kleidung zeigt die weitreichenden Auswirkungen auf soziale Interaktionen und die Konstruktion von Identität. Es wird erörtert, wie Kleidung das Selbstbild beeinflusst und durch die Reaktion der Umwelt stabilisiert oder verändert werden kann. Der Aspekt der Anerkennungssuche durch Selbstinszenierung wird ebenfalls beleuchtet. Das Kapitel betont die Wechselwirkung zwischen Kleidung, Selbst und Umwelt und schließt mit Überlegungen zum Nutzen von Täuschung durch Kleidung.
Schlüsselwörter
Kleidung, symbolische Selbstinszenierung, nonverbale Kommunikation, Selbstausdruck, Identität, soziale Interaktion, Kleidernormen, Kleidersymbolik, Theorien des Kleidungsverhaltens, Impression Management, Selbstergänzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kleidung als symbolische Selbstinszenierung
Was ist der Hauptfokus dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht Kleidung als symbolische Selbstinszenierung und beleuchtet das komplexe Zusammenspiel zwischen Kleidung, Kommunikation und der Konstruktion des Selbst. Sie verknüpft verschiedene theoretische Ansätze und empirische Befunde.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den inneren Antrieb des Kleidungsverhaltens, Kleidung als nonverbale Kommunikation, die Selbstinszenierung durch Kleidung und deren Strategien, die Wirkung von Kleidung auf den Träger und die Umwelt sowie die Bedeutung von Kleidernormen und -symbolik.
Welche Theorien des Kleidungsverhaltens werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Theorien, darunter die Schutz-, Scham- und Schmucktheorie, die Selbstausdrucks-, Persönlichkeits- und Impression-Management-Theorie, die Theorie des idealen Selbst und die Theorie der symbolischen Selbstergänzung.
Wie wird der innere Antrieb des Kleidungsverhaltens erklärt?
Kapitel I erforscht die grundlegenden Motive hinter dem menschlichen Bedürfnis nach Kleidung. Es analysiert die Schutz-, Scham- und Schmucktheorie und betont die Ausdrucksfunktion im Schmücken und Verhüllen als zentrale Motivation. Die Verschmelzung dieser drei Aspekte wird als komplexer Beweggrund für das Kleidungsverhalten herausgestellt.
Welche Botschaften können durch Kleidung vermittelt werden?
Kapitel II analysiert Kleidung als nonverbale Kommunikation und untersucht, welche Botschaften übermittelt werden können, wie z.B. Gruppenzugehörigkeit, Status, Persönlichkeit, interpersonale Einstellungen und Gefühlslage. Die Komplexität der Interpretation von Kleidungssymbolen und die Rolle des Kontextes werden beleuchtet.
Wie wird die Selbstinszenierung durch Kleidung beschrieben?
Kapitel III widmet sich der Selbstinszenierung durch Kleidung. Es werden verschiedene Theorien vorgestellt und deren Relevanz für das Verständnis von Kleidung als Mittel der Selbstpräsentation diskutiert. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit Kleidung den Selbstausdruck widerspiegelt oder ein idealisiertes Selbstbild präsentiert. Die Rolle von Kleidung als Kompensation, Korrektur und Manipulation wird analysiert.
Welche Wirkung hat Kleidung auf den Träger und die Umwelt?
Kapitel IV untersucht die Wirkung der vestimentären Selbstinszenierung auf die Umwelt und den Träger selbst. Es analysiert die personalen und sozialen Funktionen von Kleidung und deren Auswirkungen auf soziale Interaktionen und die Konstruktion von Identität. Der Einfluss von Kleidung auf das Selbstbild und die Rolle der Anerkennungssuche werden beleuchtet.
Welche Rolle spielen Kleidernormen und -symbolik?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Kleidernormen und -symbolik als strukturelle Gesetzmäßigkeiten der Kleidersprache. Sie beschreibt, wie diese Regeln und Konventionen die Interpretation von Kleidung beeinflussen und wie sich Symbole situativ und gruppenspezifisch verändern können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kleidung, symbolische Selbstinszenierung, nonverbale Kommunikation, Selbstausdruck, Identität, soziale Interaktion, Kleidernormen, Kleidersymbolik, Theorien des Kleidungsverhaltens, Impression Management, Selbstergänzung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und eine Liste von Schlüsselwörtern. Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf und untersuchen die Thematik aus verschiedenen Perspektiven.
- Citar trabajo
- Graciette Justo (Autor), 2005, Kleidung als symbolische Selbstinszenierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51030