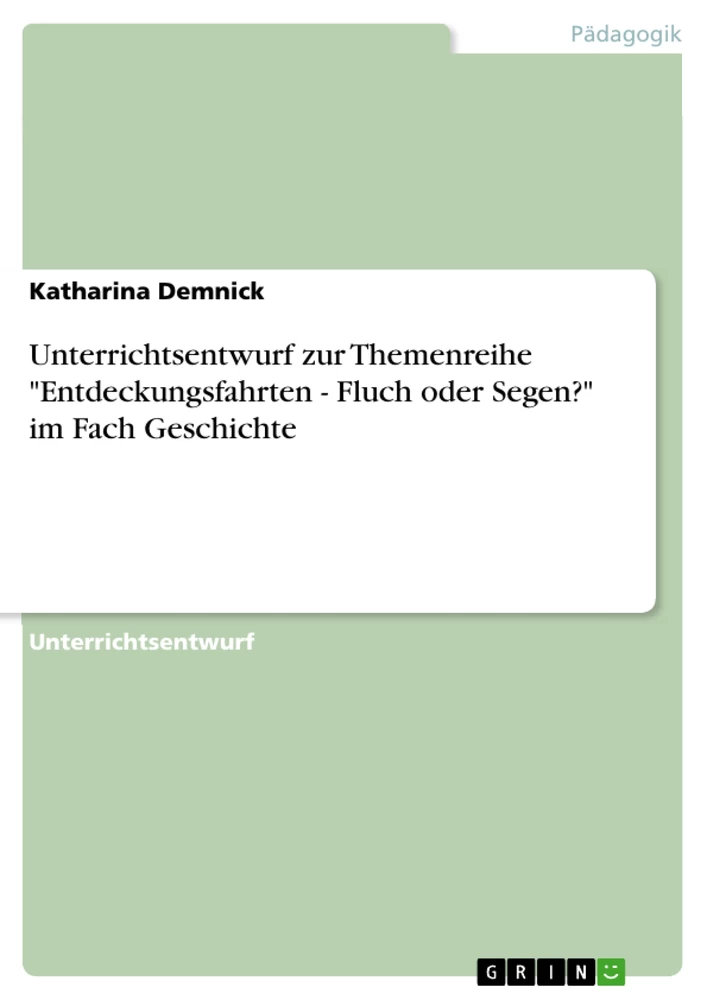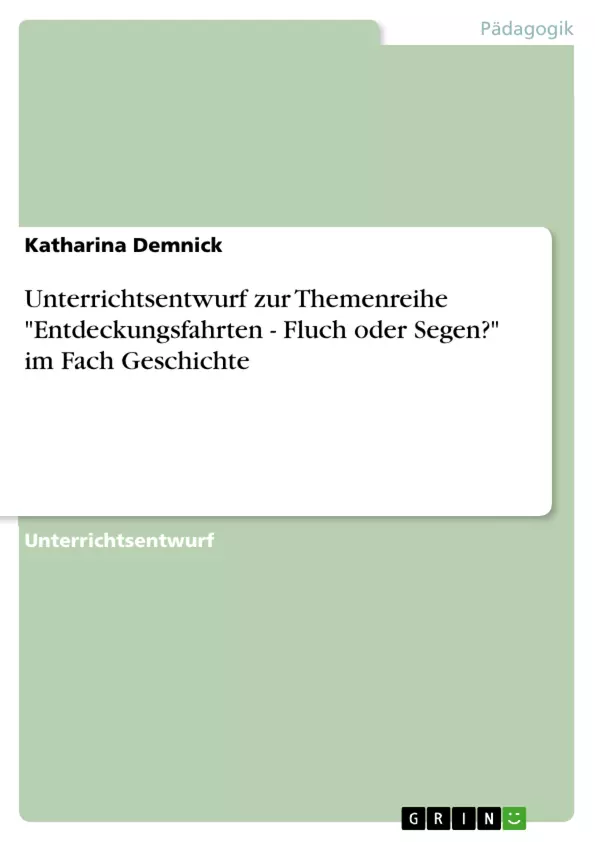Das Unterrichtsthema „Bedingungen auf See“ lässt sich als drittes Thema in die Unterrichtsreihe
„Entdeckungsfahrten - Fluch oder Segen?“ einordnen. Es gehört zum Themenfeld „Europäische Expansion
und Kolonialismus“. Inhaltlich wurde sich in der vorangegangenen Stunde mit den Vorbereitungen und den Voraussetzungen für eine Entdeckungsfahrt auseinandergesetzt. Die nachfolgende Stunde befasste sich mit dem Ankommen der
Entdecker in der neuen Welt. Die Leitfrage der Stunde lautete: „Die Entdeckung Amerikas - auf Kreuzfahrt mit Kolumbus?“
Der Unterrichtsentwurf ist für SuS der 7. Klasse konzipiert. Für die Durchführung wird ein Beamer und eine
Tafel benötigt. Es besteht die Möglichkeit den Klassenraum so zu gestalten, dass die Tische zu
Gruppentischen angeordnet werden können. Die SuS müssen bereits mit der Arbeitstechnik der Bildinterpretation vertraut sein und diese auf ein Comic übertragen können. Auch sollten sie mit Bereichen der Quellenkritik vertraut sein, um beispielsweise den Verweis auf den Verfasser des Comics korrekt einschätzen zu können.
Darüber hinaus sollten die SuS in der Lage sein, ein Imagevideo zu analysieren, um auf Grundlage ihrer
Beobachtungen die Arbeitsaufgaben bearbeiten zu können. Die SuS sollten außerdem für die Beantwortung
der Leitfrage über eine gewisse narrative Kompetenz verfügen sowie die Kommunikationsform des
Unterrichtsgesprächs kennen.
Inhaltsverzeichnis
- Unterrichtsvoraussetzungen
- Räumliche, fach- und unterrichtsmethodische Voraussetzungen
- Vorwissen der SuS
- Inhaltlicher Bezug zum Rahmenlehrplan (RLP)
- Kompetenzen mit Standards und Konkretisierung
- Unterrichtsbezogene Sachanalyse
- Nachweise der fachwissenschaftlichen Kompetenz
- Begründung der Bedeutsamkeit des Stundenthemas
- Begründung der didaktischen Reduktion
- Eingrenzung des Stundenthemas
- Reduktion des Materials
- Entlastung / Differenzierung
- Didaktische Konstruktion
- Didaktische Zugangsweise
- Darstellungskonzept
- Unterrichtsmethodisches Strukturierungskonzept
- Fachdidaktisches Prinzip
- Begründung der Lehr- und Lernstruktur
- Begründung des geschichtsdidaktischen Unterrichtskonzepts
- Begründung der Unterrichtsmethode
- Verlaufsplan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse ein vertieftes Verständnis der Entdeckungsfahrten im Kontext der europäischen Expansion und des Kolonialismus zu vermitteln. Die Schüler sollen lernen, historische Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und kritisch zu beurteilen, ihre Urteilsfähigkeit schärfen und ihr Geschichtsbewusstsein entwickeln.
- Analyse der Vorbereitungen und Bedingungen von Entdeckungsfahrten
- Bewertung der Auswirkungen der Entdeckungsfahrten auf die beteiligten Kulturen
- Entwicklung kritischer Urteilsfähigkeit gegenüber historischen Quellen und Darstellungen
- Förderung des Geschichtsbewusstseins durch den Bezug zu Gegenwart und Zukunft
- Anwendung verschiedener methodischer Ansätze im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Unterrichtsvoraussetzungen: Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen räumlichen, fachlichen und methodischen Voraussetzungen für den Unterricht. Er beinhaltet die Anforderungen an die Schüler bezüglich ihrer Vorkenntnisse in Bildinterpretation, Quellenkritik und narrativer Kompetenz. Die benötigten Materialien wie Beamer und Tafel werden ebenfalls genannt. Der Abschnitt stellt sicher, dass der Unterricht auf den vorhandenen Fähigkeiten der Schüler aufbaut und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Inhaltlicher Bezug zum Rahmenlehrplan (RLP): Hier wird der Bezug des Unterrichtsentwurfs zum Rahmenlehrplan für Geschichte (2015) hergestellt. Es wird erläutert, wie die im Entwurf verfolgten Ziele und Kompetenzen den Vorgaben des RLP entsprechen, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung des Geschichtsbewusstseins und des Erwerbs fachbezogener Kompetenzen wie Urteilen und Deuten. Die Einordnung des Themas „Europäische Expansion und Kolonialismus“ in den Längsschnitt des RLP wird ebenfalls begründet.
Kompetenzen mit Standards und Konkretisierung: Dieser Abschnitt konkretisiert die im Rahmenlehrplan definierten Kompetenzen, insbesondere die Kompetenz „Urteilen und sich orientieren“, für den vorliegenden Unterricht. Es wird dargestellt, wie die Schüler durch die Bearbeitung der Leitfrage („Die Entdeckung Amerikas – auf Kreuzfahrt mit Kolumbus?“) und die Erstellung eines „Blog-Buch-Eintrags“ ihre Urteilsfähigkeit schulen und ihr Geschichtsbewusstsein entwickeln. Die Verbindung zwischen den allgemeinen Kompetenzstandards und der konkreten Umsetzung im Unterricht wird deutlich herausgearbeitet.
Unterrichtsbezogene Sachanalyse: Dieser Teil des Entwurfs liefert die fachwissenschaftliche Grundlage für den Unterricht. Er beleuchtet die Bedeutung des Themas „Bedingungen auf See“ im Kontext der Entdeckungsfahrten und begründet die didaktische Reduktion des Stoffes. Die Auswahl und Eingrenzung des Themas wird didaktisch gerechtfertigt, um den Schülern einen handhabbaren und verständlichen Zugang zum komplexen Thema zu ermöglichen. Differenzierungsmaßnahmen werden ebenfalls berücksichtigt.
Didaktische Konstruktion: Hier werden die didaktische Zugangsweise, das Darstellungskonzept, das methodische Strukturierungskonzept und das fachdidaktische Prinzip des Unterrichts erläutert. Es wird beschrieben, wie der Unterricht gestaltet wird, um die Schüler aktiv am Lernprozess zu beteiligen und ein tieferes Verständnis des Themas zu erreichen. Die Wahl der Methoden wird begründet und ihre Eignung für die Zielgruppe und die Lernziele dargestellt.
Begründung der Lehr- und Lernstruktur: In diesem Kapitel wird das gewählte geschichtsdidaktische Unterrichtskonzept und die gewählte Unterrichtsmethode begründet. Die Entscheidungen bezüglich der didaktischen Gestaltung und der methodischen Umsetzung werden im Detail erläutert, um deren Angemessenheit und Wirksamkeit zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Entdeckungsfahrten, Europäische Expansion, Kolonialismus, Geschichtsbewusstsein, Quellenkritik, Urteilsfähigkeit, Perspektivenübernahme, didaktische Reduktion, Rahmenlehrplan, Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Europäische Expansion und Kolonialismus
Was enthält der Unterrichtsentwurf?
Der Entwurf bietet einen umfassenden Überblick über eine Unterrichtsstunde zum Thema "Europäische Expansion und Kolonialismus", inklusive Inhaltsverzeichnis, Lernzielen, Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Er deckt alle wichtigen Aspekte der Unterrichtsplanung ab, von den Voraussetzungen bis zum Verlaufsplan.
Welche Voraussetzungen werden für den Unterricht beschrieben?
Der Entwurf spezifiziert die räumlichen, fachlichen und methodischen Voraussetzungen, das Vorwissen der Schüler (Bildinterpretation, Quellenkritik, narrative Kompetenz) und die benötigten Materialien (Beamer, Tafel). Es wird sichergestellt, dass der Unterricht auf dem vorhandenen Wissen der Schüler aufbaut und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Wie ist der Entwurf im Rahmenlehrplan verankert?
Der Entwurf zeigt explizit den Bezug zum Rahmenlehrplan Geschichte (2015) auf und erläutert, wie die Lernziele und Kompetenzen den Vorgaben des RLP entsprechen, insbesondere hinsichtlich des Geschichtsbewusstseins und fachbezogener Kompetenzen wie Urteilen und Deuten. Die Einordnung des Themas in den Längsschnitt des RLP wird begründet.
Welche Kompetenzen werden im Unterricht gefördert?
Der Entwurf konkretisiert die im Rahmenlehrplan definierten Kompetenzen, besonders die Kompetenz "Urteilen und sich orientieren". Die Schüler sollen durch die Bearbeitung einer Leitfrage und die Erstellung eines "Blog-Buch-Eintrags" ihre Urteilsfähigkeit schulen und ihr Geschichtsbewusstsein entwickeln. Die Verbindung zwischen allgemeinen Kompetenzstandards und der konkreten Umsetzung wird deutlich herausgearbeitet.
Wie wird die fachliche Grundlage des Unterrichts dargestellt?
Der Entwurf liefert eine fachwissenschaftliche Begründung für die Auswahl des Themas "Bedingungen auf See" im Kontext der Entdeckungsfahrten. Er erklärt die didaktische Reduktion des Stoffes, die Auswahl und Eingrenzung des Themas sowie die Berücksichtigung von Differenzierungsmaßnahmen für einen handhabbaren und verständlichen Zugang zum komplexen Thema.
Wie ist die didaktische Konstruktion des Unterrichts beschrieben?
Der Entwurf beschreibt die didaktische Zugangsweise, das Darstellungskonzept, das methodische Strukturierungskonzept und das fachdidaktische Prinzip. Er erläutert, wie der Unterricht gestaltet wird, um Schüler aktiv zu beteiligen und ein tieferes Verständnis zu erreichen. Die Wahl der Methoden wird begründet und ihre Eignung für die Zielgruppe und die Lernziele dargestellt.
Wie wird die Lehr- und Lernstruktur begründet?
Der Entwurf begründet das gewählte geschichtsdidaktische Unterrichtskonzept und die gewählte Unterrichtsmethode im Detail. Die Entscheidungen bezüglich der didaktischen Gestaltung und der methodischen Umsetzung werden erläutert, um deren Angemessenheit und Wirksamkeit zu verdeutlichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Der Unterricht konzentriert sich auf die Analyse der Vorbereitungen und Bedingungen von Entdeckungsfahrten, die Bewertung der Auswirkungen auf die beteiligten Kulturen, die Entwicklung kritischer Urteilsfähigkeit, die Förderung des Geschichtsbewusstseins und die Anwendung verschiedener methodischer Ansätze.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Unterrichtsentwurf?
Schlüsselwörter sind: Entdeckungsfahrten, Europäische Expansion, Kolonialismus, Geschichtsbewusstsein, Quellenkritik, Urteilsfähigkeit, Perspektivenübernahme, didaktische Reduktion, Rahmenlehrplan, Kompetenzen.
Für welche Klassenstufe ist der Unterrichtsentwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist für die 7. Klasse konzipiert.
Welches Ziel verfolgt der Unterrichtsentwurf?
Der Entwurf zielt darauf ab, den Schülern ein vertieftes Verständnis der Entdeckungsfahrten im Kontext der europäischen Expansion und des Kolonialismus zu vermitteln, historische Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und kritisch zu beurteilen, ihre Urteilsfähigkeit zu schärfen und ihr Geschichtsbewusstsein zu entwickeln.
- Citation du texte
- Katharina Demnick (Auteur), 2019, Unterrichtsentwurf zur Themenreihe "Entdeckungsfahrten - Fluch oder Segen?" im Fach Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510882