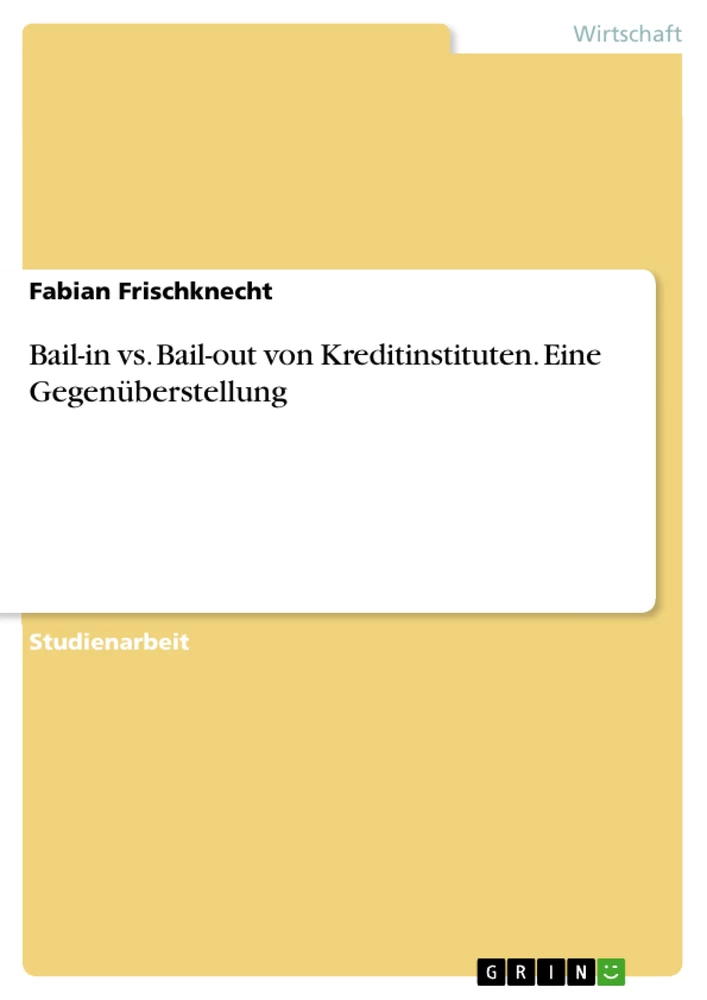Im Oktober 2012 wurde von der durch die Europäische Kommission eingesetzten „Highlevel Expert Group on Bank Structural Reform“ ein Abschlussbericht vorgelegt, in dem Maßnahmen vorgeschlagen wurden, die die Reformen als Konsequenz aus der Finanz- und Staatsschuldenkrise abschließen sollten. Das Hauptaugenmerk lag dabei unter anderem auf Bail-in-Maßnahmen und deren Funktionsvoraussetzungen zur Umsetzung. Die folgende Arbeit soll darauf eingehen, was Ursache dafür war, dass diese Maßnahmen notwendig wurden und erläutern, inwieweit bis heute eine Umsetzung, bzw. ein rechtlicher Rahmen realisiert werden konnte.
„[…] one of the most dramatic days in Wall Street’s history“ war der einleitende Satz eines Artikels in der New York Times am 14.09.2008. Der Höhepunkt der Finanzmarktkrise im Jahr 2008. Einen Tag später beantragte die US-amerikanische Bank „Lehman Brothers“ Insolvenz. Die Folge war ein erheblicher Vertrauensverlust innerhalb des Bankensystems. Die Finanzmarktkrise verursachte in den EU-Staaten einer Schätzung zur Folge Kosten von ca. 4,6 Billionen Euro, die zur Rettung des Finanzsektors aufgebracht werden mussten. Damit einhergehend, stellt sich die Frage, wer für einen Schaden solchen Ausmaßes haftet. In diesem Fall der Staat und damit der Steuerzahler. Doch ist es gerecht, das Kollektiv für die Fehler einzelner zahlen zu lassen? Auf welcher rechtlichen Grundlage basieren Maßnahmen im Zuge der Finanzmarktkrise und was haben wir aus dieser Zeit gelernt und versucht besser
zu gestalten?
Im Folgenden werden in Kapitel 2 die relevanten Begrifflichkeiten „Bail-in“ und „Bail-out“ erläutert. Anschließend soll geklärt werden, wie das behandelte Thema an Wichtigkeit gewann. Dabei soll vor allem auf die Finanzmarktkrise und die daraus entstehenden Maßnahmen eingegangen werden. Es wird geklärt, was hinter der EU-Abwicklungsrichtlinie und der Umsetzung in nationale Gesetzgebung steckt, wie diese funktioniert und was Voraussetzung für die Anwendung eines „Bail-in“ ist. In Kapitel 4.5 wird aufgezeigt, inwiefern Bail-inMaßnahmen in der Praxis bereits Anwendung fanden. Im Gegensatz dazu wird im anschließenden Kapitel der Bail-out erläutert und abschließend eine Abgrenzung von Bail-in und Bail-out vorgenommen. Zuletzt soll ein Fazit aus den zuvor aufgezeigten Thematiken und Problemen gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 3. Hintergrund
- 3.1 Die Finanzmarktkrise
- 3.2 Maßnahmen
- 4. Bail-in
- 4.1 BRRD und BaSAG
- 4.2 Funktionsweise der Abwicklungsrichtlinie
- 4.3 Voraussetzungen
- 4.4 Ablauf eines Bail-in
- 4.5 Angewandte Bail-in-Maßnahmen
- 5. Bail-out
- 5.1 Ausgestaltung
- 5.2 Abgrenzung Bail-in/Bail-out
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Konzepte "Bail-in" und "Bail-out" im Kontext der Finanzmarktkrise und der darauf folgenden Regulierungen. Ziel ist es, die Hintergründe, Funktionsweisen und rechtlichen Rahmenbedingungen dieser beiden Maßnahmen zu erläutern und ihre Bedeutung für die Stabilität des Finanzsystems zu beleuchten.
- Die Finanzmarktkrise 2008 und ihre Folgen
- Die Funktionsweise von Bail-in-Maßnahmen
- Die rechtlichen Grundlagen von Bail-in und Bail-out
- Der Vergleich zwischen Bail-in und Bail-out
- Die praktische Anwendung von Bail-in-Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Beginn der Finanzkrise 2008 mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und den daraus resultierenden enormen Kosten für die Rettung des Finanzsektors in der EU. Sie stellt die Frage nach der Gerechtigkeit der Kostenübernahme durch den Steuerzahler und leitet die zentrale Fragestellung nach den rechtlichen Grundlagen und den daraus resultierenden Reformen ein. Der Fokus liegt auf den notwendigen Bail-in-Maßnahmen und deren Umsetzung.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Bail-in" und "Bail-out". Es legt den Grundstein für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die wesentlichen Unterschiede und die Bedeutung dieser Konzepte im Kontext der Finanzstabilität herausarbeitet. Die klare Definition der Begriffe ist essenziell für das Verständnis der gesamten Arbeit.
3. Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die Finanzmarktkrise 2008 als den entscheidenden Auslöser für die Entwicklung und Notwendigkeit von Bail-in-Maßnahmen. Es analysiert die Krise und die darauf folgenden Rettungsaktionen, die zu einer massiven Belastung der Staatshaushalte führten. Die Darstellung der Maßnahmen unterstreicht die Notwendigkeit für neue, nachhaltigere Ansätze zur Krisenbewältigung, welche im weiteren Verlauf der Arbeit detaillierter behandelt werden.
4. Bail-in: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Konzept des Bail-in. Es beschreibt die BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) und die BaSAG (Bankenabwicklungs- und -sanierungsgesetz), erläutert die Funktionsweise der Abwicklungsrichtlinie, die Voraussetzungen für deren Anwendung und den Ablauf eines Bail-in-Prozesses. Besonders detailliert wird auf die in der Praxis angewandten Bail-in-Maßnahmen eingegangen, um ein umfassendes Bild der Umsetzung und der Herausforderungen zu liefern.
5. Bail-out: Dieses Kapitel beschreibt das Konzept des Bail-out im Gegensatz zum Bail-in. Es analysiert die Ausgestaltung von Bail-out-Maßnahmen und liefert eine detaillierte Abgrenzung zwischen Bail-in und Bail-out, um die Unterschiede in den jeweiligen Vorgehensweisen und den damit verbundenen Konsequenzen aufzuzeigen. Der Vergleich hebt die Vorteile und Nachteile beider Ansätze hervor.
Schlüsselwörter
Bail-in, Bail-out, Finanzmarktkrise, BRRD, BaSAG, Bankenabwicklung, Finanzstabilität, Rettungspakete, Gläubigerschutz, Regulierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit Bail-in vs. Bail-out
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Konzepte "Bail-in" und "Bail-out" im Kontext der Finanzmarktkrise von 2008 und der darauf folgenden Regulierungen. Sie erläutert die Hintergründe, Funktionsweisen und rechtlichen Rahmenbedingungen beider Maßnahmen und beleuchtet deren Bedeutung für die Stabilität des Finanzsystems. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Begriffsklärungen, einen Überblick über die Finanzmarktkrise und die darauf folgenden Maßnahmen, detaillierte Beschreibungen von Bail-in und Bail-out, sowie ein Fazit. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind die Finanzmarktkrise 2008 und ihre Folgen, die Funktionsweise von Bail-in-Maßnahmen, die rechtlichen Grundlagen von Bail-in und Bail-out (inkl. BRRD und BaSAG), ein Vergleich beider Konzepte und die praktische Anwendung von Bail-in-Maßnahmen.
Was wird unter "Bail-in" verstanden?
Die Arbeit beschreibt "Bail-in" als einen Mechanismus zur Rettung notleidender Banken, bei dem die Gläubiger der Bank (z.B. Anleger) Verluste hinnehmen müssen, bevor staatliche Hilfen gewährt werden. Es werden die BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) und das BaSAG (Bankenabwicklungs- und -sanierungsgesetz) als rechtliche Grundlagen erläutert, sowie der Ablauf und die Voraussetzungen eines Bail-in-Prozesses detailliert dargestellt.
Was wird unter "Bail-out" verstanden?
"Bail-out" bezeichnet staatliche Rettungsaktionen für Banken, bei denen der Staat die Banken mit Steuergeldern rettet. Die Arbeit vergleicht "Bail-out" mit "Bail-in" und hebt die Unterschiede in den Vorgehensweisen und Konsequenzen hervor.
Welche Rolle spielt die Finanzmarktkrise 2008?
Die Finanzmarktkrise 2008 wird als entscheidender Auslöser für die Entwicklung und Notwendigkeit von Bail-in-Maßnahmen dargestellt. Die Arbeit analysiert die Krise und die darauf folgenden Rettungsaktionen, die zu einer massiven Belastung der Staatshaushalte führten und die Notwendigkeit neuer, nachhaltigerer Ansätze zur Krisenbewältigung aufzeigte.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) und das BaSAG (Bankenabwicklungs- und -sanierungsgesetz) als zentrale rechtliche Grundlagen für Bail-in-Maßnahmen.
Wie werden Bail-in und Bail-out verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ausgestaltung, Vorgehensweisen und Konsequenzen von Bail-in und Bail-out, um die Unterschiede und die jeweiligen Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Bail-in, Bail-out, Finanzmarktkrise, BRRD, BaSAG, Bankenabwicklung, Finanzstabilität, Rettungspakete, Gläubigerschutz, Regulierung.
- Citar trabajo
- Fabian Frischknecht (Autor), 2019, Bail-in vs. Bail-out von Kreditinstituten. Eine Gegenüberstellung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511362