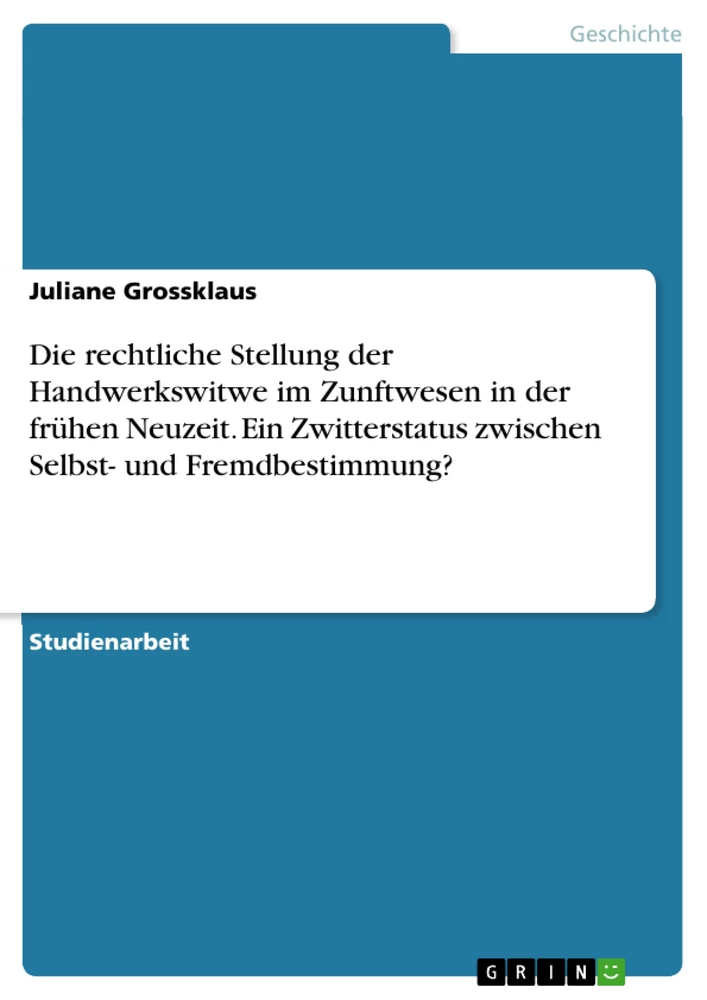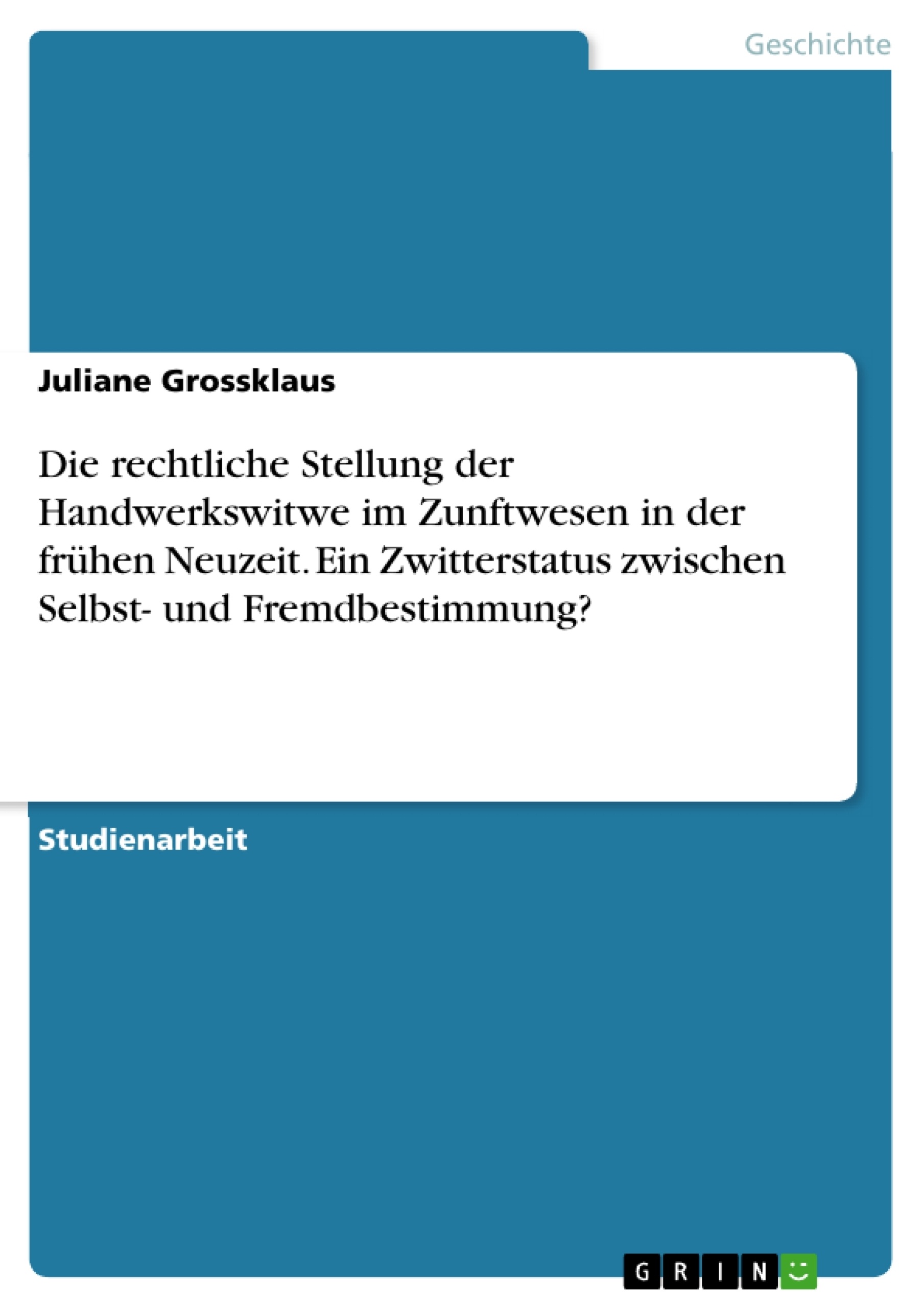Das Ziel dieser Arbeit ist es zu erfahren, ob die Handwerkswitwe als Handwerks- und Zunftmitglied akzeptiert wurde und worauf sich ihre Handlungsfelder begrenzten. Das Auftreten der Handwerkswitwe soll im privaten und öffentlichen Kontext verglichen werden, damit diesbezüglich mögliche Einschränkungen oder Erweiterungen zum Vorschein kommen können. Da der Geselle als handwerkliche "Linkehand" der Handwerkswitwe gesehen werden konnte und er in einem bestimmten Verhältnis zur Handwerkswitwe stand, wird dies im dritten Kapitel gesondert erforscht. Desweiteren soll die Untersuchung von zünftischen Strukturen im Bezug zur Handwerkswitwe in einem kleineren Rahmen erfolgen. Ausschlaggebend für diese Arbeit werden die Rechte der Handwerkswitwe sein, denn sie eröffnen eine neue Dimension für diese.
Dabei liegt der lokale Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Stadt Augsburg. Die Stadt bietet sich zur Untersuchung ganz besonders an, da Augsburg durch die vielfältigen und wohlhabenden Handwerke als die "Goldene und reichste Stadt der Welt" galt. Die Stadt Ravensburg ist, ähnlich wie Augsburg in der frühen Neuzeit, handwerksbedeutend gewesen und daher bezieht sich die Arbeit im letzten Kapitel gesondert auf Handwerkswitwen in Ravensburg, um mögliche Sonderstellungen herauszukristallisieren. Eine zeitliche Eingrenzung dieser Arbeit auf das 18. Jahrhundert erscheint sinnvoll, weil Handwerkswitwen in diesem Jahrhundert auffallend viel Aufmerksamkeit durch Suppliken und durch die Handwerksakten erfahren haben. Dennoch wird dieser zeitliche Rahmen aufgrund des aufschlussreichen Augsburger Stadtbuches mit Stadtrecht kurzzeitig verlassen. Im Zusammenhang mit der Schuhmacherwitwe Böhmin werden in die zünftischen Gewohnheiten Einblick gewährt. Defizite befinden sich im Forschungsstand über die Differenzierung von Meisterwitwen zu Handwerkswitwen. Darum werden die Meisterwitwen inhaltlich weniger miteinbezogen, da ihr rechtlicher Standpunkt klarer ist als der der Handwerkswitwe. Dieses Thema und die dazugehörige Fragestellung erscheint interessant, weil die Überzeugung zum Vorschein kommen könnte, dass Handwerkswitwen unter bestimmten Bedingungen die Chance haben konnten, selbstbestimmter zu leben und zu arbeiten. Das Ziel dieser Arbeit soll sein, die Gründe herauszuarbeiten, weswegen sich die Handwerkswitwe in ihrer Stellung von den "handwerkslosen" Witwen in der frühen Neuzeit abhebt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Handlungsfelder der Handwerkswitwe
- inner- und außerhalb der Zunft
- Einsetzung von Gesellen
- Die Rechte der Handwerkswitwe
- Die Wiederheirat
- Die Zunft
- Die wirtschaftliche Lage
- Die Werkstattübergabe
- Sonderbare Handwerkswitwen aus Ravensburg:
- Die Metzgerwitwe Susanna Schmidin
- Die Schuhmacherwitwe Maria Böhmin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die rechtliche Stellung der Handwerkswitwe im Zunftwesen der frühen Neuzeit am Beispiel von Augsburg zu untersuchen. Dabei geht es darum, zu analysieren, ob die Handwerkswitwe als Handwerks- und Zunftmitglied akzeptiert wurde und welche Handlungsfelder ihr offenstanden.
- Die rechtliche Stellung der Handwerkswitwe im Zunftwesen
- Die Handlungsfelder der Handwerkswitwe innerhalb und außerhalb der Zunft
- Die Rolle des Gesellen im Verhältnis zur Handwerkswitwe
- Die Rechte der Handwerkswitwe im Vergleich zu anderen Witwen
- Die wirtschaftliche Lage der Handwerkswitwe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht die Stellung der Handwerkswitwe im Zunftwesen der frühen Neuzeit am Beispiel von Augsburg und stellt die zentralen Fragestellungen und Forschungsansätze vor.
- Die Handlungsfelder der Handwerkswitwe: Dieses Kapitel analysiert die Tätigkeitsfelder der Handwerkswitwe sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zunft. Dabei wird auf die Problematik der Quellenlage und die Frage nach einer möglichen formalen Ausbildung der Handwerkswitwen eingegangen.
- Einsetzung von Gesellen: Der Geselle als handwerkliche „Linkehand“ der Handwerkswitwe wird in diesem Kapitel untersucht und dessen Bedeutung für die Werkstattführung der Witwe analysiert.
- Die Rechte der Handwerkswitwe: Dieses Kapitel beleuchtet die Rechte der Handwerkswitwe im Detail und stellt diese in den Kontext der zünftischen Strukturen und des Stadtrechts.
- Die Wiederheirat: Dieses Kapitel behandelt die Wiederheirat der Handwerkswitwe und deren Auswirkungen auf ihre rechtliche Stellung und ihre Rolle im Handwerk.
- Die Zunft: Die zünftischen Strukturen und deren Einfluss auf die Handwerkswitwe stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels.
- Die wirtschaftliche Lage: Dieses Kapitel befasst sich mit der wirtschaftlichen Lage der Handwerkswitwe und untersucht, wie sie ihre Lebensgrundlage sicherte.
- Die Werkstattübergabe: Dieses Kapitel untersucht die Übergabe der Werkstatt an die Handwerkswitwe und die damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte.
- Sonderbare Handwerkswitwen aus Ravensburg: Dieses Kapitel stellt die Fälle der Metzgerwitwe Susanna Schmidin und der Schuhmacherwitwe Maria Böhmin in den Mittelpunkt und analysiert deren spezifische Position im Zunftwesen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenkomplex der Handwerkswitwe im Zunftwesen der frühen Neuzeit. Zentrale Schlüsselwörter sind: Handwerkswitwe, Zunft, Augsburg, Stadtrecht, Rechtsstellung, Handlungsfelder, Geselle, Werkstattübergabe, wirtschaftliche Lage, Wiederheirat, Meisterwitwe, Ravensburger Handwerkswitwen. Die Arbeit setzt sich mit dem Forschungsstand zu diesem Thema auseinander und beleuchtet die spezifische Situation der Handwerkswitwe im Vergleich zu anderen Witwen und Meisterwitwen.
- Quote paper
- Juliane Grossklaus (Author), 2019, Die rechtliche Stellung der Handwerkswitwe im Zunftwesen in der frühen Neuzeit. Ein Zwitterstatus zwischen Selbst- und Fremdbestimmung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512044