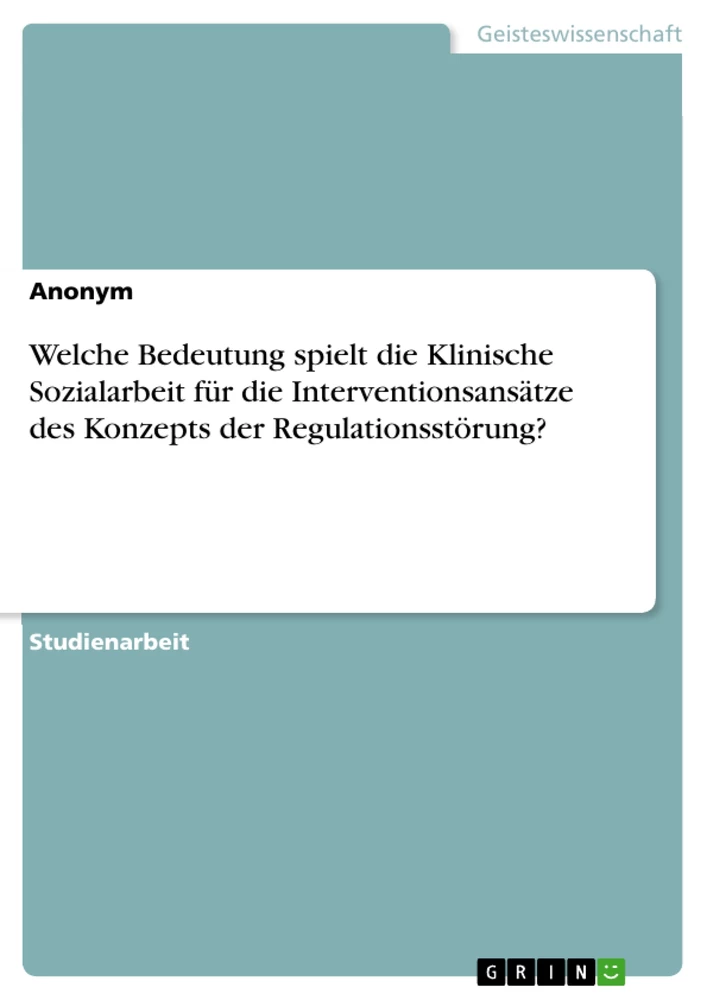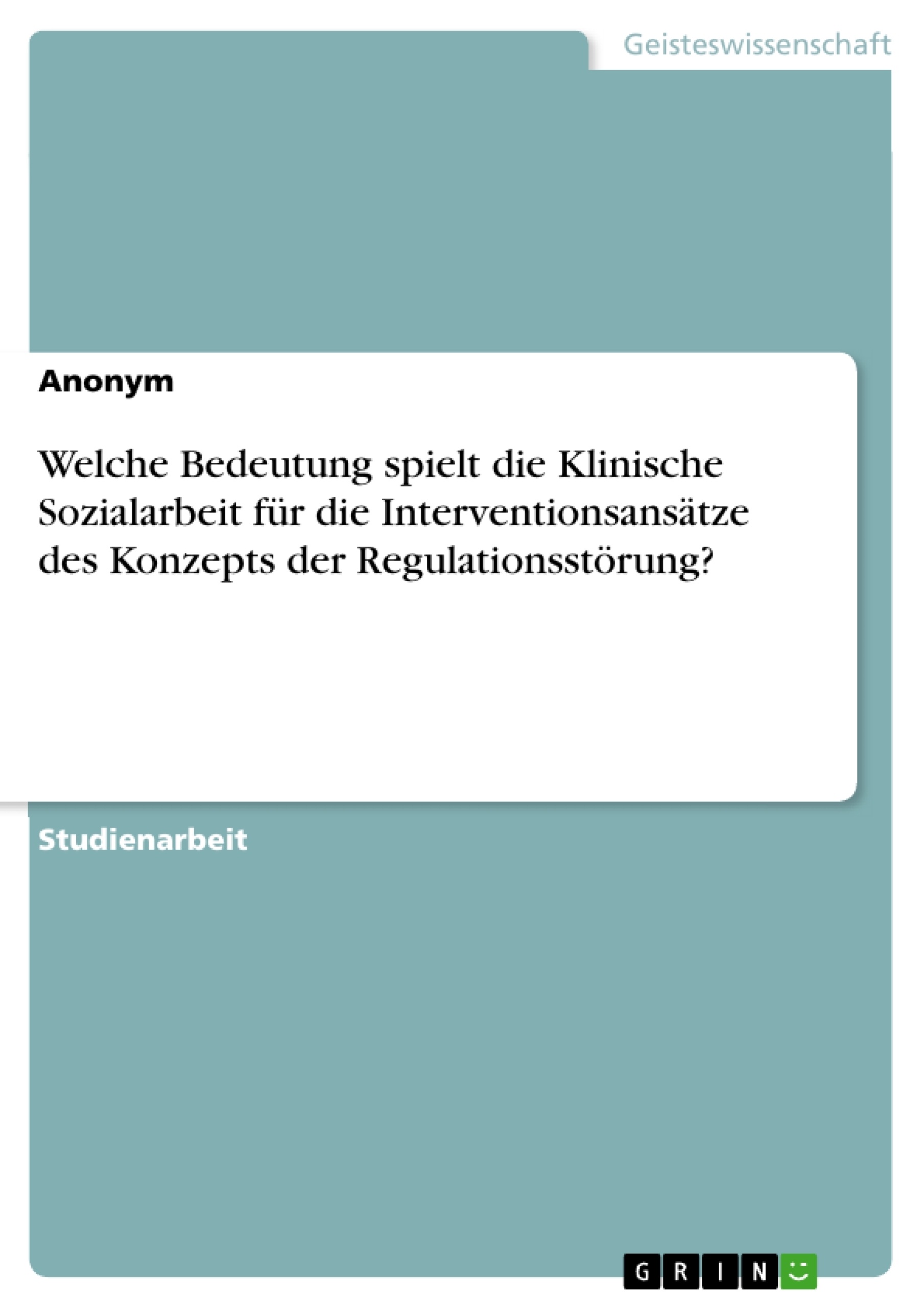Diese Arbeit untersucht die Regulationsstörung und die Bedeutung der Sozialarbeit für Interventionsansätze.
Regulationsstörungen sind ein weit verbreitetes Störungsbild in der frühen Kindheit. Ein solches Störungsbild liegt vor, wenn Säuglinge bzw. Kinder sich in ihrem Verhaltens-, Erlebens- und Gefühlszustand nur unzureichend selbst regulieren können. Entstehungsbedingungen finden sich sowohl im kindlichen Bereich, als auch bedingt durch elterliche sowie umweltbezogene Faktoren. Besonders einflussreich ist die Wechselbeziehung zwischen Kind und primärer Bezugsperson, seien es nun fehlende Kompetenzen auf Seiten der Eltern oder Auffälligkeiten des Kindes, welche nicht zu einer gemeinsamen, funktionalen Regulation führen.
Stattdessen kommt es zu einem Teufelskreis an Dysfunktionalität zwischen beiden, sodass der Säugling nicht beruhigt werden kann, negative Rückkopplungssignale an die Eltern gesendet werden, die wiederum Schuldgefühle und Ärger entwickeln, was sich im Rückschluss nochmals auf ihre Regulationshilfen und das Erleben des Kindes auswirkt. Interventionen, wie Entlastungsgespräche, Entwicklungsberatung in Form von Psychoedukation, Förderung des Säuglings und Eltern-Kind/Säuglings-Therapie, erzielen zunehmende Behandlungswirkung. Die Klinische Sozialarbeit, mit ihrem weitgreifenden Fokus auf das bio-psycho-soziale Gesundheitsverständnis könnte in der Behandlung, vor allem bezogen auf soziale Faktoren, eine bedeutsame Unterstützung bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Frühkindliche Entwicklung der Regulierung.
- 2. Frühkindliche Regulierung.
- 2.1 Selbstregulation
- 2.2 Co-Regulation
- 2.3 Intuitive elterliche Kompetenzen
- 3. Entwicklungsdynamisches Modell der Regulationsstörung
- 3.1 Störungsbild der Regulationsstörung
- 3.2 Entstehungsbedingungen
- 3.3 Wechselbeziehung der Eltern-Kind-Interaktion
- 4. Interventionsansätze zur Behandlung der Regulationsstörung
- 4.1 Professionen
- 4.2 Allgemeine Rahmenbedingungen
- 4.3 Therapieansätze
- 4.4 Konkrete Behandlungselemente
- 4.4.1 Stufe 1 – Behandlung gemäß der Symptomtria
- 4.4.2 Stufe 2 - Behandlung der Beziehungsdynamik
- 4.5 Aktueller Forschungsstand
- 5. Bedeutung der Klinischen Sozialarbeit in der Behandlung der Regulationsstörung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Regulationsstörung bei Säuglingen und Kleinkindern. Ziel ist es, das Konzept der Regulationsstörung zu erläutern und die Rolle der Klinischen Sozialarbeit bei der Behandlung zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den Entstehungsbedingungen, dem Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung und den verschiedenen Interventionsansätzen.
- Entwicklung der Regulierung in der frühen Kindheit
- Selbstregulation und Co-Regulation
- Entstehung und Manifestation von Regulationsstörungen
- Interventionsansätze in der Behandlung
- Bedeutung der Klinischen Sozialarbeit in der Behandlung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Entwicklung der Regulierung in der frühen Kindheit ein und beleuchtet die Rolle der Selbstregulation und Co-Regulation. Kapitel 2 widmet sich dem Entwicklungsdynamischen Modell der Regulationsstörung, der Definition des Störungsbildes, den Entstehungsbedingungen und der Wechselbeziehung zwischen Eltern und Kind. Kapitel 3 beleuchtet Interventionsansätze, die bei der Behandlung von Regulationsstörungen zum Einsatz kommen. Diese umfassen professionelle Akteure, Rahmenbedingungen, Therapieansätze, konkrete Behandlungselemente und den aktuellen Forschungsstand.
Schlüsselwörter
Regulationsstörung, Frühkindliche Entwicklung, Selbstregulation, Co-Regulation, Eltern-Kind-Beziehung, Interventionsansätze, Klinische Sozialarbeit, Bio-Psycho-Soziales Gesundheitsverständnis, Therapieformen, Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was genau ist eine frühkindliche Regulationsstörung?
Eine Regulationsstörung liegt vor, wenn Säuglinge oder Kleinkinder Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten, ihre Gefühle oder ihren Erlebenszustand (z. B. Schreien, Schlafen, Füttern) selbst zu regulieren.
Wie entsteht der „Teufelskreis der Dysfunktionalität“?
Wenn ein Säugling nicht beruhigt werden kann, entwickeln Eltern oft Schuldgefühle oder Ärger. Diese negativen Emotionen übertragen sich zurück auf das Kind, was die Regulation weiter erschwert.
Welche Rolle spielt die Klinische Sozialarbeit bei der Behandlung?
Die Klinische Sozialarbeit nutzt ein bio-psycho-soziales Modell, um nicht nur das Kind, sondern auch soziale Faktoren und das familiäre Umfeld in die Therapie einzubeziehen.
Was ist der Unterschied zwischen Selbstregulation und Co-Regulation?
Selbstregulation ist die Fähigkeit des Kindes, sich selbst zu beruhigen. Co-Regulation ist die notwendige Unterstützung durch die Bezugsperson, um diesen Zustand zu erreichen.
Welche Interventionsansätze gibt es für betroffene Familien?
Dazu gehören Entlastungsgespräche, Psychoedukation (Entwicklungsberatung), die Förderung der intuitiven elterlichen Kompetenzen und spezielle Eltern-Kind-Therapien.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Welche Bedeutung spielt die Klinische Sozialarbeit für die Interventionsansätze des Konzepts der Regulationsstörung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513192