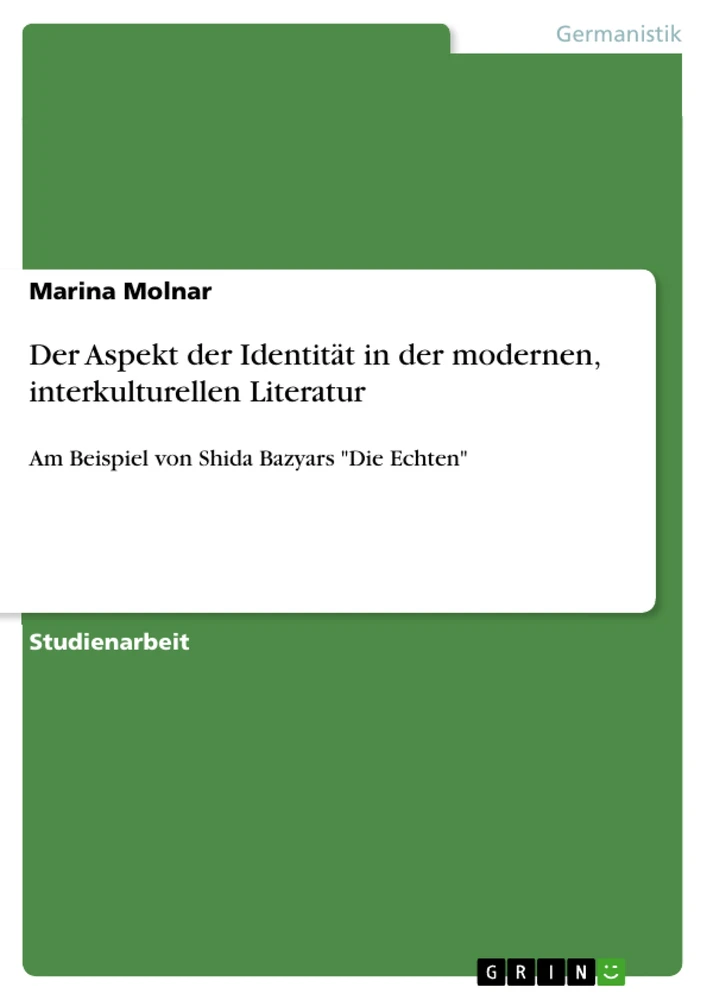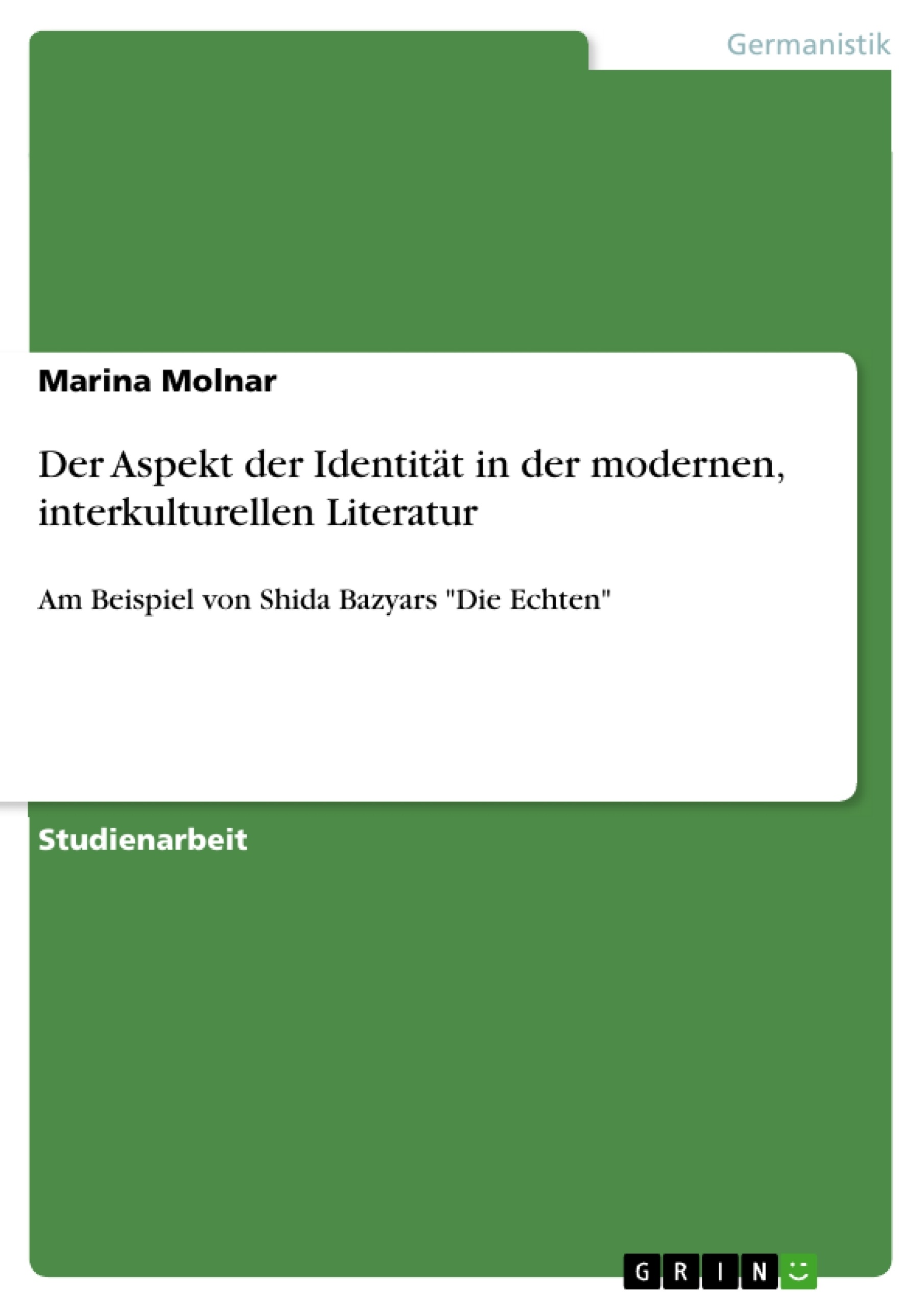"Wie wir leben wollen. Texte für Solidarität und Freiheit" lautet der Titel des Sammelbands, in dem Shida Bazyars Kurzgeschichte "Die Echten" 2016 erschienen ist – Ein Buch, das eine Reihe von Texten junger AutorInnen versammelt, die sich mit der Bedeutung von Heimat, Fremde und Identität auseinandersetzen und dabei ein eindrucksvolles Bild unserer gegenwärtigen Gesellschaft zeichnen. Vor dem politischen Hintergrund des Nah-Ost-Konflikts, dem IS und Flüchtlingsströmen, im Rahmen derer sich tausende Menschen auf den langen, beschwerlichen Weg nach Europa machen, werden vermehrt ängstliche und wütend protestierende Stimmen laut, die das europäische Identitätskonzept gefährdet sehen. In einer politisch angespannten Situation wie dieser sehen AutorInnen wie Shida Bazyar ihre Aufgabe darin, die aktuellen Themen literarisch zu verarbeiten. Denn die literarische Ebene ermöglicht es Themen und Probleme aufzugreifen, die im realpolitischen Raum in der gegebenen Situation unmöglich ansprechbar und unauflösbar geworden zu sein scheinen.
In diesem Kontext gewinnt ein Teilbereich der germanistischen Literaturwissenschaft an Bedeutung, dessen Anfänge auf die 1950er Jahren zurückgehen und der sich in den 1980ern endgültig etabliert hat: die interkulturelle, deutschsprachige Literaturwissenschaft, eine Disziplin, die „international und interdisziplinär Interkulturalitätskonzepte erforscht und sich als Schnittstelle zwischen Muttersprachen und internationaler Germanistik versteht“ (Leskovec 2011). Innerhalb dieser Disziplin werden „Texte als interkulturelle Phänomene verstanden, aufgrund der Tatsache, dass sie Grenzen aufheben, wie die Grenzen zwischen Sprachebenen, zwischen kulturellen Sphären oder zwischen Ästhetiken“ (Leskovec 2011) und können somit als Werke der Interferenz verstanden werden.
Im Kontext postmigrantischer Gesellschaften, wie sie heute in weiten Teilen Europas bestehen, gewinnt die interkulturelle Germanistik zunehmend an Bedeutung. Sie stellt den Rahmen dar, in dem Texte von AutorInnen mit Migrationshintergrund und/oder Texte, die sich mit interkulturellen Themen auseinandersetzen zu analysieren sind und dient somit auch im Kontext dieser Analyse als Grundlage.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Identität in postmodernen Gesellschaften
- 2.1. Hybridität als Konzept
- 3. Charakterisierung im Rahmen interkulturellen, literaturwissenschaftlichen Analyse
- 4. Identitätskonzepte in „Die Echten“ von Shida Bazyar
- 4.1. Die erste Generation: Großvater
- 4.2. Die deutsche Perspektive: Mütter, Nazis, Journalisten
- 5. Die dritte Generation: Ich-Erzählerin, Toni, Schwester
- 6. Konklusion
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert den Aspekt der Identität in Shida Bazyars Kurzgeschichte „Die Echten“ im Kontext der modernen, interkulturellen Literatur. Die Arbeit untersucht, wie die Autorin Identitätskonzepte in einer postmigrantischen Gesellschaft darstellt und welche literaturwissenschaftlichen Methoden zur Analyse solcher Texte geeignet sind.
- Identitätsbildung in postmodernen Gesellschaften
- Das Konzept der Hybridität
- Identitätskonzepte in verschiedenen Generationen einer Migrantenfamilie
- Interkulturelle Literaturwissenschaft als analytischer Rahmen
- Die Darstellung von Migration und Zugehörigkeit in „Die Echten“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die Kurzgeschichte „Die Echten“ von Shida Bazyar im Kontext aktueller politischer und gesellschaftlicher Diskurse über Migration und Identität vor. Sie betont die Bedeutung der interkulturellen Literaturwissenschaft für die Analyse solcher Texte und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Autorin, Shida Bazyar, wird als deutschsprachige Autorin mit iranischen Wurzeln vorgestellt, deren Werk sich mit der Herausbildung von Identitäten in einer postmigrantischen Gesellschaft auseinandersetzt, ein Thema von hoher Relevanz für die literaturwissenschaftliche Forschung.
2. Identität in postmodernen Gesellschaften: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen und vielschichtigen Begriff der Identität in postmodernen Gesellschaften. Es diskutiert den Identitätsbegriff aus psychologischer, soziologischer und kultureller Perspektive und beschreibt die Herausforderungen der Identitätsbildung in einem Kontext der Globalisierung und Migration. Die Ambivalenz der Erfahrung von Fremdheit und die Rolle des "Anderen" bei der Identitätsfindung werden eingehend untersucht. Das Kapitel führt schließlich zum Konzept der Hybridität als einem zentralen Ansatzpunkt zur Beschreibung von Identitäten in multikulturellen Kontexten.
2.1. Hybridität als Konzept: Dieser Abschnitt vertieft das Konzept der Hybridität als Identitätsmodell, besonders im Kontext postmigrantischer Gesellschaften. Der Begriff wird eingeordnet und seine Anwendung auf kulturelle, religiöse, nationale und ethnische Überlappungen erläutert. Die Bedeutung von Mehrfachzugehörigkeiten und das „Patchwork“ an Identitäten, die sich in einer nicht-hybriden Mehrheitsgesellschaft gegenseitig ausschließen würden, werden im Detail analysiert. Die zentrale Argumentation dieses Teils ist, dass Hybridität ein zunehmend relevantes Konzept ist, um die Identitätsfindung von Menschen mit Migrationshintergrund in postmoderner Gesellschaft zu verstehen.
Schlüsselwörter
Identität, Hybridität, Interkulturelle Literaturwissenschaft, Postmigrantische Gesellschaft, Migration, „Die Echten“, Shida Bazyar, Generationen, Fremdheit, Zugehörigkeit, Iran, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zu Shida Bazyars "Die Echten" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Darstellung von Identität in Shida Bazyars Kurzgeschichte "Die Echten" im Kontext der modernen, interkulturellen Literatur. Der Fokus liegt auf der Identitätsbildung in einer postmigrantischen Gesellschaft und den dafür geeigneten literaturwissenschaftlichen Methoden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Identitätsbildung in postmodernen Gesellschaften, das Konzept der Hybridität, Identitätskonzepte in verschiedenen Generationen einer Migrantenfamilie, interkulturelle Literaturwissenschaft als analytischer Rahmen und die Darstellung von Migration und Zugehörigkeit in "Die Echten".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Kurzgeschichte), Identität in postmodernen Gesellschaften (Identitätsbegriff aus verschiedenen Perspektiven und Herausforderungen der Identitätsbildung), Hybridität als Konzept (Vertiefung des Hybriditätsmodells im Kontext postmigrantischer Gesellschaften), Identitätskonzepte in "Die Echten" (Analyse der Identitätskonzepte in Bezug auf verschiedene Generationen der Familie in der Kurzgeschichte), Die dritte Generation (Analyse der Ich-Erzählerin, Toni und ihrer Schwester), Konklusion (Zusammenfassung der Ergebnisse) und Literaturverzeichnis.
Wie wird Identität in der Arbeit konzeptualisiert?
Die Arbeit beleuchtet den komplexen Begriff der Identität aus psychologischer, soziologischer und kultureller Perspektive. Besonders wichtig ist das Konzept der Hybridität als Modell für die Beschreibung von Identitäten in multikulturellen Kontexten, welches die Mehrfachzugehörigkeiten und das „Patchwork“ an Identitäten von Menschen mit Migrationshintergrund betont.
Welche Rolle spielt die interkulturelle Literaturwissenschaft?
Die interkulturelle Literaturwissenschaft dient als analytischer Rahmen für die Untersuchung der Identitätsdarstellungen in "Die Echten". Sie ermöglicht eine fundierte Analyse der spezifischen Herausforderungen und Erfahrungen von Migrantenfamilien und ihrer Identitätsfindung in einer Mehrheitsgesellschaft.
Welche Generationen werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Identitätskonzepte in Bezug auf drei Generationen einer Migrantenfamilie: die erste Generation (Großvater), die zweite Generation (Mütter, Nazis, Journalisten als Repräsentanten der deutschen Perspektive) und die dritte Generation (Ich-Erzählerin, Toni und ihre Schwester).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Identität, Hybridität, Interkulturelle Literaturwissenschaft, Postmigrantische Gesellschaft, Migration, "Die Echten", Shida Bazyar, Generationen, Fremdheit, Zugehörigkeit, Iran, Deutschland.
Welche methodischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit skizziert einen methodischen Ansatz, der die interkulturelle Literaturwissenschaft nutzt, um die Identitätsdarstellungen in Shida Bazyars "Die Echten" zu analysieren. Die genaue Methodik wird im Text detailliert erläutert.
- Citar trabajo
- Marina Molnar (Autor), 2017, Der Aspekt der Identität in der modernen, interkulturellen Literatur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514903