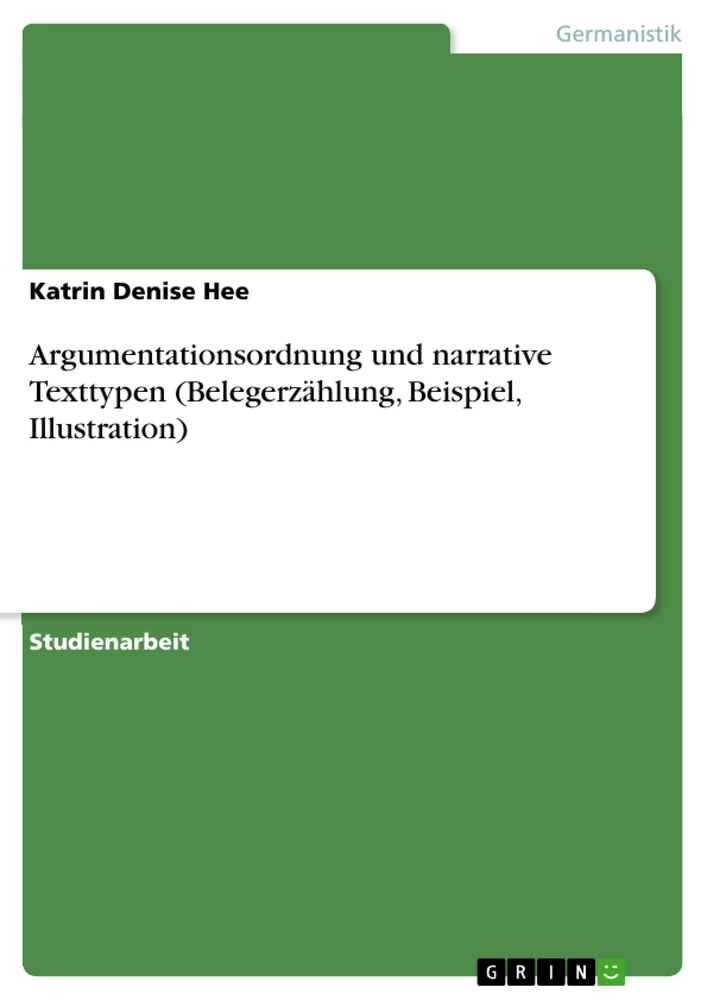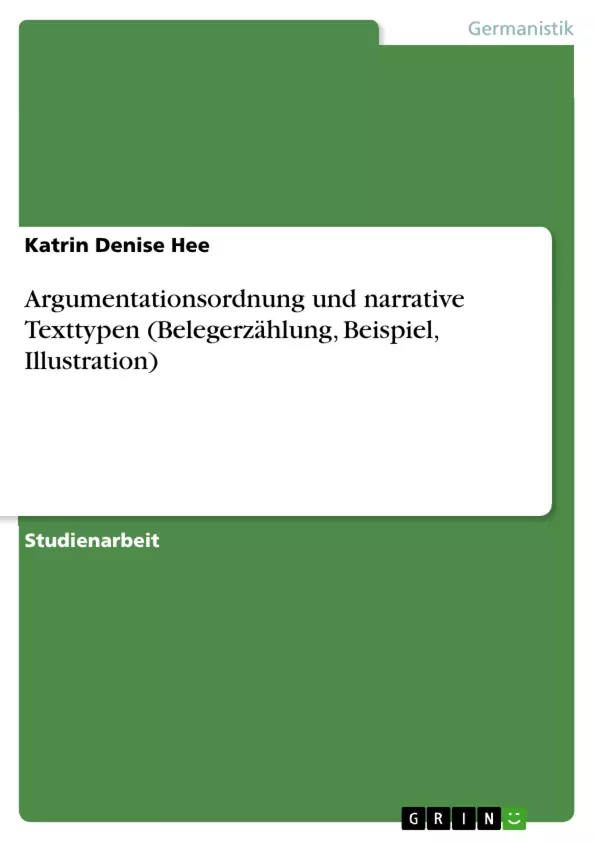Argumentation spielt in unserem alltäglichen Leben eine große Rolle. Ob in Familie, Beziehung oder Beruf, um unsere eigene Meinung, unseren eigenen Standpunkt und oft auch unser Recht zu verteidigen und zu rechtfertigen, müssen wir auf Argumente zurückgreifen, um unseren Gesprächspartner von unserer Sicht der Dinge zu überzeugen. Wer dabei die besseren Argumente hat, kann seinen Standpunkt plausibler darstellen und, wenn dem Gegner die Widerlegung der Argumente nicht mehr gelingt und ihm keine Gegenargumente einfallen, oft das Durchsetzen seiner Ziele erreichen. Argumentieren ist daher auf der einen Seite ein alltäglicher Bestandteil unseres Lebens und andererseits ein wichtiges Instrument für unsere Selbstbestimmung und Durchsetzungsfähigkeit.
Argumentieren spielt allerdings nicht nur im alltäglichen Leben eine maßgebliche Rolle, sondern ist auch in der Wissenschaft von großer Bedeutung. So beschäftigte sich bereits Aristoteles in seiner Rhetorik mit der Kunst des Argumentierens und stellte die Grundlage der heutigen sprachwissenschaftlichen Argumentationsforschung in Form seiner Syllogismen und Topoi dar, die später von Cicero unter dem Terminus loci weiterentwickelt und in neuerer Zeit v.a. durch Toulmin neu strukturiert und geprägt wurden. Galt das Argumentieren bei Aristoteles allerdings in erster Linie politischen Zwecken, so hat sich heute die Bedeutung und die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema ausgeweitet. Argumentieren findet in allen Bereichen des alltäglichen Lebens statt und Wissenschaftler, wie v.a. Kienpointner, haben sich dieses Phänomens angenommen, es untersucht und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- I. Belegerzählungen
- I.1. Aufbau und Struktur von Erzählungen
- I.2. Textanalyse
- II. Illustrieren
- II.1. Merkmale und Illustrationstypen
- II.1.1. Typ A
- II.1.2. Typ B
- II.1.3. Gemeinsamkeiten
- II.2. Textanalyse
- II.2.1. Typ A
- II.2.2. Typ B
- II.1. Merkmale und Illustrationstypen
- III. Beispiel
- III.1. Auftreten und Funktion
- III.2. Textanalyse
- I. Belegerzählungen
- C. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Verwendung narrativer Texttypen als Mittel der Argumentation im Alltag. Ziel ist es, die Funktionsweise dieser Texttypen zu untersuchen und ihre Rolle in der Gestaltung von Argumentationsverläufen zu beleuchten. Dabei werden insbesondere Belegerzählungen, Illustrationen und Beispiele in den Fokus gerückt.
- Der Aufbau und die Struktur von Erzählungen als Grundlage für argumentative Texttypen
- Die verschiedenen Arten und Funktionen von Belegerzählungen, Illustrationen und Beispielen
- Die Analyse von Textbeispielen zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten narrativer Texttypen
- Die Rolle von narrativen Texttypen in der Gestaltung von Argumentationsverläufen im Alltag
- Die Verbindung von sprachwissenschaftlicher Argumentationsforschung und der Analyse von Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Argumentieren im Alltag“ ein und beleuchtet die Bedeutung von Argumentation sowohl im privaten als auch im wissenschaftlichen Kontext. Dabei wird auch die Rolle von narrativen Texttypen in der Argumentation hervorgehoben.
Im Hauptteil werden zunächst Belegerzählungen als eine Form der argumentativen Erzählung behandelt. Es wird der Aufbau und die Struktur von Erzählungen nach Labov/Waletzky (1966) und Quasthoff (2001) erläutert. Darüber hinaus werden die Merkmale und Illustrationstypen von Illustrationen sowie die Analyse von Textbeispielen in diesem Kapitel beleuchtet.
Das Kapitel über das „Beispiel“ behandelt das Auftreten und die Funktion von Beispielen als argumentative Texttypen sowie deren Analyse in konkreten Textbeispielen.
Schlüsselwörter
Argumentation, Erzählung, Belegerzählung, Illustrieren, Beispiel, narrative Texttypen, Alltagssprache, Sprachwissenschaft, Sprechakttheorie, Textanalyse, Argumentationsforschung
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Argumentation im Alltag?
Argumentation dient dazu, Standpunkte zu verteidigen, Gesprächspartner zu überzeugen und ist ein wichtiges Instrument für Selbstbestimmung und Durchsetzungsfähigkeit.
Was sind narrative Texttypen in der Argumentation?
Es handelt sich um Erzählformen wie Belegerzählungen, Beispiele oder Illustrationen, die genutzt werden, um eine Argumentation anschaulicher und plausibler zu machen.
Wie ist eine Belegerzählung aufgebaut?
Sie folgt meist einer festen Struktur (nach Labov/Waletzky), bestehend aus Orientierung, Komplikation, Evaluation und Auflösung, um eine These durch eine Geschichte zu stützen.
Was ist der Zweck von Illustrationen im Text?
Illustrationen dienen der Veranschaulichung abstrakter Sachverhalte und können in verschiedene Typen unterteilt werden, die unterschiedliche Funktionen in der Argumentationsordnung erfüllen.
Wer waren die Wegbereiter der Argumentationsforschung?
Die Wurzeln liegen bei Aristoteles (Topoi/Syllogismen), wurden von Cicero weiterentwickelt und in der Moderne durch Forscher wie Toulmin und Kienpointner geprägt.
- Citar trabajo
- MA Katrin Denise Hee (Autor), 2005, Argumentationsordnung und narrative Texttypen (Belegerzählung, Beispiel, Illustration), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51915