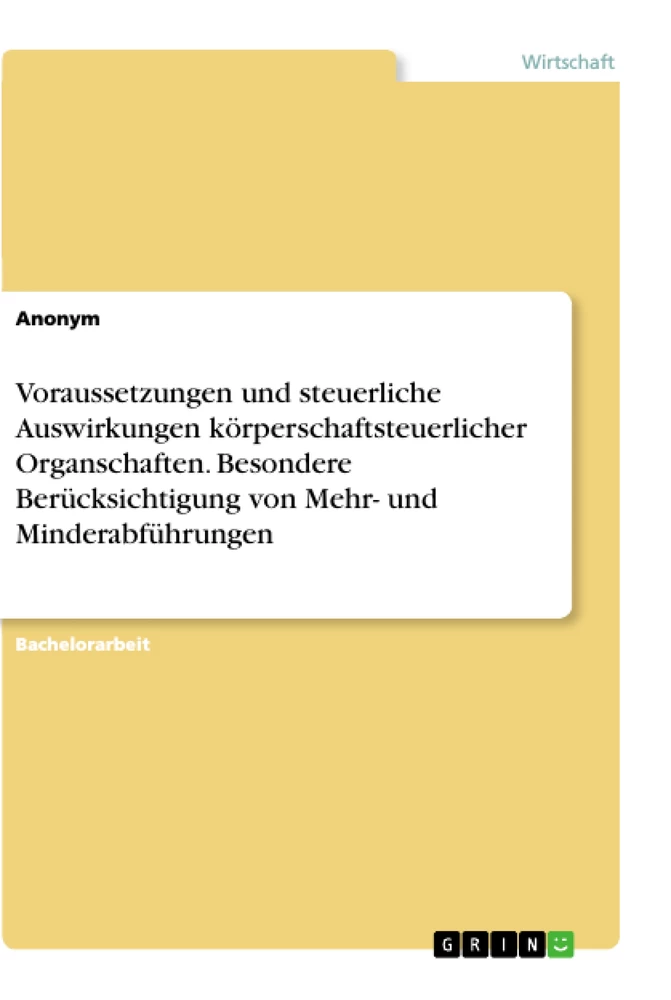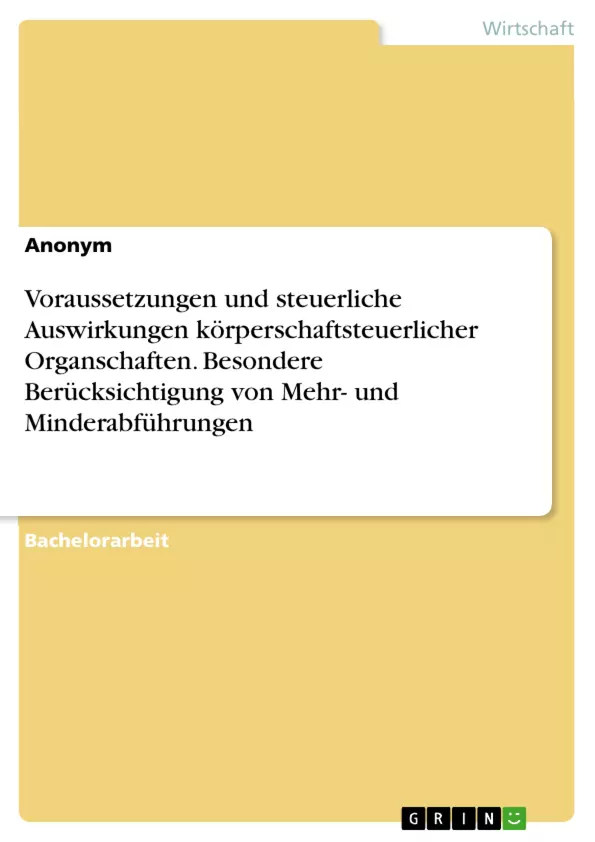Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die genauere Betrachtung der körperschaftsteuerlichen Organschaft. Untersucht werden die theoretische und praktische Bedeutung dieses steuerlichen Konstrukts. Zu Beginn wird aufgezeigt, in welchen Bereichen sich Probleme ergeben können. Im Anschluss daran werden die Grundlagen kurz erläutert und die Voraussetzungen sowie die steuerlichen Auswirkungen kritisch analysiert. Besondere Berücksichtigung erhalten die vororganschaftlichen und organschaftlichen Mehr- und Minderabführungen. Diese Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz werden an praktischen Beispielen veranschaulicht. Mit der kritischen Würdigung der Ergebnisse in Bezug auf die zu Beginn definierten Probleme und den zusätzlich erarbeiteten Informationen schließt diese Bachelorarbeit ab.
Das Unternehmenssteuerrecht in Deutschland wird vom Prinzip der subjektbezogenen Besteuerung beherrscht. Es geht im Grundsatz davon aus, dass jedes Rechtssubjekt eigenständig steuerpflichtig ist. Die Zugehörigkeit rechtlich selbstständiger Unternehmen zu einem Unternehmens- oder Konzernverbund wird hierbei ausgeblendet. Um dennoch den Erfordernissen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu entsprechen, versucht der Gesetzgeber durch das Rechtsinstitut der Organschaft, die wirtschaftliche Verbundzugehörigkeit zu berücksichtigen und eine Konzernbesteuerung zumindest ansatzweise zu verwirklichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung und Zielsetzung
- 2 Grundlagen
- 3 Tatbestandsmerkmale
- 3.1 Persönliche Voraussetzungen
- 3.1.1 Anforderungen an die Organgesellschaft
- 3.1.2 Anforderungen an den Organträger
- 3.2 Sachliche Voraussetzungen
- 3.2.1 Finanzielle Eingliederung
- 3.2.2 Gewinnabführungsvertrag
- 3.1 Persönliche Voraussetzungen
- 4 Steuerliche Auswirkungen
- 4.1 Gewinnabführung und Verlustübernahme
- 4.1.1 Einkommensermittlung bei der Organgesellschaft
- 4.1.2 Einkommenszurechnung bei dem Organträger
- 4.1.3 Einkommensermittlung bei dem Organträger
- 4.2 Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter
- 4.3 Mehr- und Minderabführungen in der Organschaft
- 4.3.1 Organschaftlich verursachte Differenzen
- 4.3.1.1 Bildung organschaftlicher Ausgleichsposten
- 4.3.1.2 Auflösung organschaftlicher Ausgleichsposten
- 4.3.1.3 Beispiel zu den Auswirkungen der Brutto- und Nettomethode
- 4.3.1.4 Beispiel einer organschaftlich verursachten Mehrabführung
- 4.3.2 Vororganschaftlich verursachte Differenzen
- 4.3.2.1 Tatbestand
- 4.3.2.2 Rechtsfolgen
- 4.3.2.3 Beispiel einer vororganschaftlich verursachten Minderabführung
- 4.3.1 Organschaftlich verursachte Differenzen
- 4.1 Gewinnabführung und Verlustübernahme
- 5 Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Organschaft im Steuerrecht. Ziel ist es, die tatbestandlichen Voraussetzungen und die steuerlichen Auswirkungen einer Organschaft umfassend darzustellen und kritisch zu würdigen. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Regelungen und deren praktische Anwendung.
- Tatbestandsmerkmale der Organschaft (persönliche und sachliche Voraussetzungen)
- Steuerliche Auswirkungen der Gewinnabführung und Verlustübernahme
- Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter
- Mehr- und Minderabführungen in der Organschaft
- Kritische Würdigung der rechtlichen Regelungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung und Zielsetzung: Dieses Kapitel legt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit dar. Es beschreibt den Hintergrund der Untersuchung und die Bedeutung des Themas der Organschaft im Steuerrecht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Klärung der komplexen steuerlichen Auswirkungen einer Organschaft und die Analyse möglicher Probleme in der praktischen Anwendung der rechtlichen Bestimmungen.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die grundlegenden Definitionen und Konzepte, die für das Verständnis der Organschaft im Steuerrecht unerlässlich sind. Es legt die rechtlichen und theoretischen Grundlagen der Untersuchung fest, die für die Analyse der folgenden Kapitel notwendig sind. Eine detaillierte Erläuterung der relevanten Paragraphen des Einkommensteuergesetzes (EStG) und anderer relevanter Gesetze bildet den Kern dieses Kapitels.
3 Tatbestandsmerkmale: Dieses Kapitel untersucht detailliert die Voraussetzungen für das Bestehen einer Organschaft. Es differenziert zwischen den persönlichen Voraussetzungen, die die beteiligten Unternehmen betreffen (Anforderungen an die Organgesellschaft und den Organträger), und den sachlichen Voraussetzungen, die den wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Unternehmen definieren (finanzielle Eingliederung und Gewinnabführungsvertrag). Es analysiert die einzelnen Kriterien und deren Interaktion, um ein vollständiges Bild der rechtlichen Anforderungen zu erstellen.
4 Steuerliche Auswirkungen: Dieses Kapitel analysiert die steuerlichen Folgen der Organschaft, konzentrierend sich auf die Gewinnabführung und Verlustübernahme. Es erläutert die Einkommensermittlung bei der Organgesellschaft und dem Organträger, sowie die Behandlung von Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Mehr- und Minderabführungen und der damit verbundenen Problematik der organschaftlich und vororganschaftlich verursachten Differenzen. Die Kapitel demonstrieren anhand von Beispielen die Berechnung und die praktischen Auswirkungen dieser Differenzen.
5 Kritische Würdigung: Dieses Kapitel dient der kritischen Reflexion der dargestellten rechtlichen Regelungen und ihrer praktischen Anwendung. Es bewertet die Stärken und Schwächen des Systems der Organschaft und diskutiert eventuelle Verbesserungspotenziale oder Reformbedarf. Die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel werden zusammengefasst und in einen übergeordneten Kontext gestellt. Das Kapitel liefert eine umfassende Bewertung der Organschaft im Steuerrecht.
Schlüsselwörter
Organschaft, Steuerrecht, Gewinnabführung, Verlustübernahme, Einkommensteuergesetz (EStG), finanzielle Eingliederung, Gewinnabführungsvertrag, Ausgleichszahlungen, Mehr- und Minderabführungen, steuerliche Auswirkungen, kritische Würdigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Organschaft im Steuerrecht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Organschaft im Steuerrecht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Das Dokument dient als Vorschau und Zusammenfassung der Thematik, geeignet zur akademischen Analyse.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Organschaft (persönliche und sachliche Voraussetzungen wie Anforderungen an Organgesellschaft und Organträger, finanzielle Eingliederung und Gewinnabführungsvertrag), die steuerlichen Auswirkungen (Gewinnabführung, Verlustübernahme, Einkommensermittlung, Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter), Mehr- und Minderabführungen (inklusive organschaftlich und vororganschaftlich verursachter Differenzen mit Beispielen) und eine kritische Würdigung der rechtlichen Regelungen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Problemstellung und Zielsetzung; 2. Grundlagen; 3. Tatbestandsmerkmale; 4. Steuerliche Auswirkungen; 5. Kritische Würdigung. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Was sind die persönlichen Voraussetzungen einer Organschaft?
Die persönlichen Voraussetzungen beziehen sich auf die Anforderungen an die Organgesellschaft und den Organträger. Das Dokument geht detailliert auf diese Anforderungen ein, jedoch ohne konkrete gesetzliche Paragraphen zu zitieren.
Was sind die sachlichen Voraussetzungen einer Organschaft?
Die sachlichen Voraussetzungen umfassen die finanzielle Eingliederung und den Gewinnabführungsvertrag. Das Dokument erklärt diese Konzepte, ohne jedoch detaillierte rechtliche Definitionen zu liefern.
Wie werden die steuerlichen Auswirkungen einer Organschaft behandelt?
Das Dokument behandelt die steuerlichen Auswirkungen der Gewinnabführung und Verlustübernahme, die Einkommensermittlung bei Organgesellschaft und Organträger, Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter und vor allem die komplexen Aspekte von Mehr- und Minderabführungen, differenziert nach organschaftlich und vororganschaftlich verursachten Differenzen. Beispiele verdeutlichen die Berechnungen.
Was ist die kritische Würdigung der Organschaft?
Das fünfte Kapitel bietet eine kritische Reflexion der rechtlichen Regelungen und ihrer praktischen Anwendung. Es bewertet Stärken und Schwächen des Systems und diskutiert mögliche Verbesserungen oder Reformbedarf.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Thema Organschaft?
Die Schlüsselwörter umfassen: Organschaft, Steuerrecht, Gewinnabführung, Verlustübernahme, Einkommensteuergesetz (EStG), finanzielle Eingliederung, Gewinnabführungsvertrag, Ausgleichszahlungen, Mehr- und Minderabführungen, steuerliche Auswirkungen, kritische Würdigung.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für Personen gedacht, die sich einen Überblick über die Organschaft im Steuerrecht verschaffen möchten. Es dient als akademisches Hilfsmittel zur Analyse und eignet sich insbesondere für Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Dokument selbst verweist nicht auf weiterführende Literatur oder Quellen. Für detailliertere Informationen wird die Konsultation von Fachliteratur und Gesetzestexten empfohlen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Voraussetzungen und steuerliche Auswirkungen körperschaftsteuerlicher Organschaften. Besondere Berücksichtigung von Mehr- und Minderabführungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520103