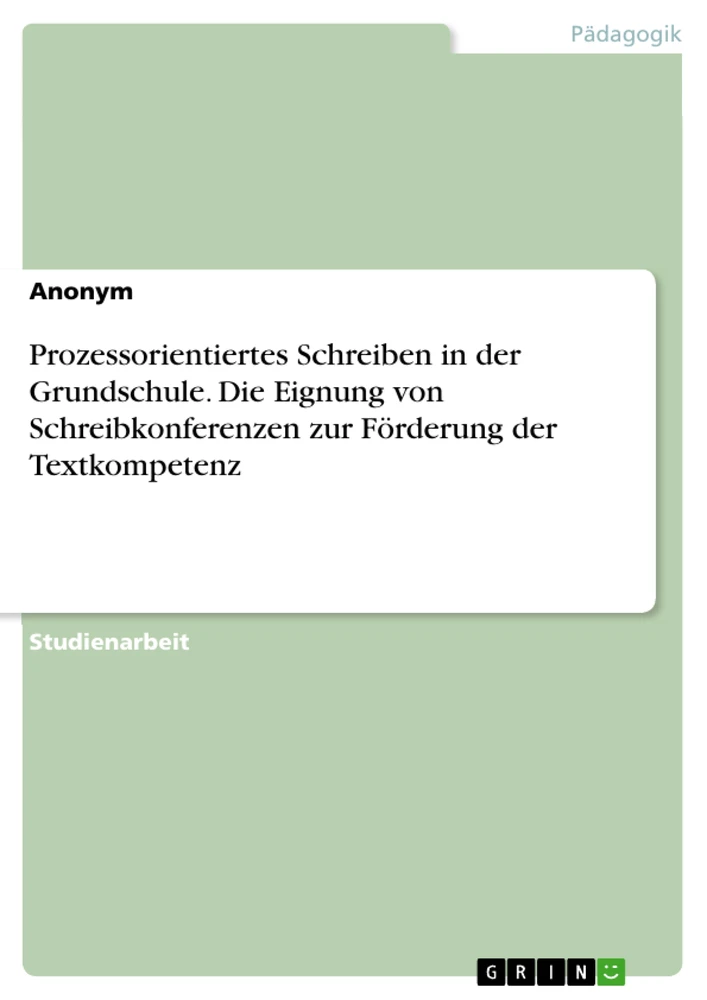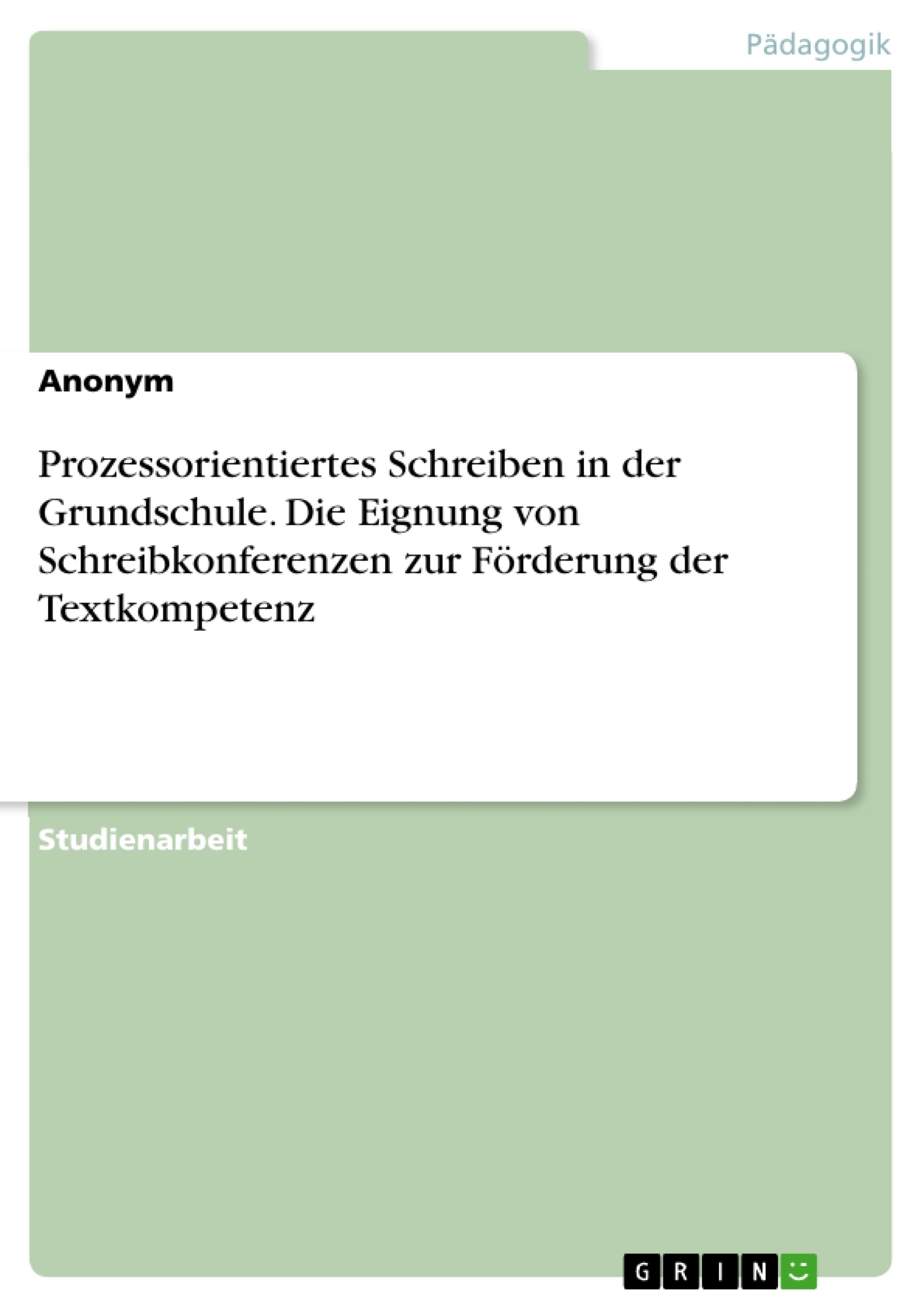Einer Studie zufolge, die im Rahmen des DFG-Projekts KoText den Einfluss von zwei unterschiedlich strukturierten Schreibumgebungen auf die Qualität der Schülertexte untersucht, verweisen diejenigen Texte, welche in einer Schreibkonferenz besprochen wurden, auf eine deutlich bessere Qualität als diese, die mit der Textlupe überarbeitet wurden. Genau an dieses Potential und die bisherigen Befunde im Hinblick auf das Konzept der Schreibkonferenzen gilt es mit der vorliegenden Ausarbeitung anzuknüpfen. Konkret soll die Frage verfolgt werden, ob sich Schreibkonferenzen als Fördermaßnahme zur Entwicklung der Textkompetenz eignen.
Die Ergebnisse der DESI-Studie des Schuljahres 2003/04, welche im Auftrag der Kultusministerkonferenz (im Folgenden KMK) die sprachlichen Leistungen in den Fächern Deutsch und Englisch untersucht, zeigen, dass ca. ein Drittel der 11.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der neunten Jahrgangsstufe aller Schulformen "nicht in der Lage [ist], einen verständlichen Text zu schreiben" (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2012, S. 64). Für das Verstehen eines Textes essentiell sei nach Berning nämlich das Beachten von Rechtschreibnormen, da nur richtig Geschriebenes auch störungsfrei gelesen werden kann. Dadurch ergibt sich für die schreibende Person ein besonderer Stellenwert der Rechtschreibung, sofern es ihr ein Anliegen ist, sich durch Schrift mitzuteilen und verstanden werden zu wollen. Damit ein Text verstanden werden kann, müssen jedoch auch seine sprachlichen Elemente schlüssig aufeinander bezogen, sowie ausreichend viele Kohäsionsmittel eingesetzt werden. Die Schreibkompetenz ist demnach vorrangig ein Bedingungsgefüge aus Rechtschreibkompetenz und Textkompetenz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlage
- 2.1 Schreibprozessmodell nach Hayes und Flower
- 2.2 Bedeutung der Schreibmotivation
- 2.3 Textkompetenz
- 2.4 Die Entwicklung der Aufsatzdidaktik
- 2.5 Schwerpunkte der wirksamen Schreibförderung
- 3. Schreibkonferenz
- 3.1 Konzept und Organisation
- 3.2 Ablauf
- 3.3 Leistungsbeurteilung
- 3.4 Grenzen und Möglichkeiten
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht die Eignung von Schreibkonferenzen als Fördermaßnahme zur Entwicklung der Textkompetenz in der Grundschule.
- Analyse des Schreibprozesses und seiner kognitiven Teilprozesse
- Bedeutung der Schreibmotivation für die Textproduktion
- Definition und Relevanz von Textkompetenz
- Historische Entwicklung der Aufsatzdidaktik und die Herausforderungen der Schreibförderung
- Konzept und Organisation von Schreibkonferenzen als effektive Fördermethode
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in die Thematik der Textkompetenzentwicklung in der Grundschule ein und beleuchtet die Ergebnisse der DESI-Studie zur Schreibfähigkeit.
- Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen des Schreibens und erläutert das Schreibprozessmodell nach Hayes und Flower, welches die kognitiven Prozesse des Schreibens beschreibt. Außerdem werden die Bedeutung der Schreibmotivation und die Definition von Textkompetenz erläutert. Weiterhin werden die historische Entwicklung der Aufsatzdidaktik und wichtige Schwerpunkte der Schreibförderung dargestellt.
- Kapitel 3 fokussiert auf das Konzept der Schreibkonferenz und ihre Organisation. Es werden die Organisation der Schreibkonferenz, die Rolle der Leistungsbeurteilung und die Vorteile sowie Grenzen der Schreibkonferenz als Fördermaßnahme untersucht.
Schlüsselwörter
Schreibkonferenz, Textkompetenz, Schreibprozess, Schreibmotivation, Aufsatzdidaktik, kooperatives Schreiben, Grundschule, Fördermaßnahme
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Schreibkonferenz in der Grundschule?
Es ist eine kooperative Methode, bei der Schüler ihre Texte gemeinsam besprechen und sich gegenseitig Feedback zur Überarbeitung geben.
Wie fördern Schreibkonferenzen die Textkompetenz?
Durch den Austausch lernen Kinder, ihre Texte aus der Leserperspektive zu betrachten und sprachliche Elemente schlüssiger zu gestalten.
Warum ist Schreibmotivation für den Lernerfolg wichtig?
Nur motivierte Schüler sind bereit, den kognitiv anspruchsvollen Prozess des Planens, Formulierens und Überarbeitens von Texten zu durchlaufen.
Sind Schreibkonferenzen besser als die „Textlupe“?
Studien (wie das Projekt KoText) deuten darauf hin, dass Texte nach Schreibkonferenzen oft eine höhere Qualität aufweisen als nach der Arbeit mit der Textlupe.
Welche Rolle spielt die Rechtschreibung für die Textkompetenz?
Rechtschreibung ist essenziell, damit ein Text störungsfrei gelesen werden kann; sie ist neben der inhaltlichen Logik ein Hauptpfeiler der Schreibkompetenz.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Prozessorientiertes Schreiben in der Grundschule. Die Eignung von Schreibkonferenzen zur Förderung der Textkompetenz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520461