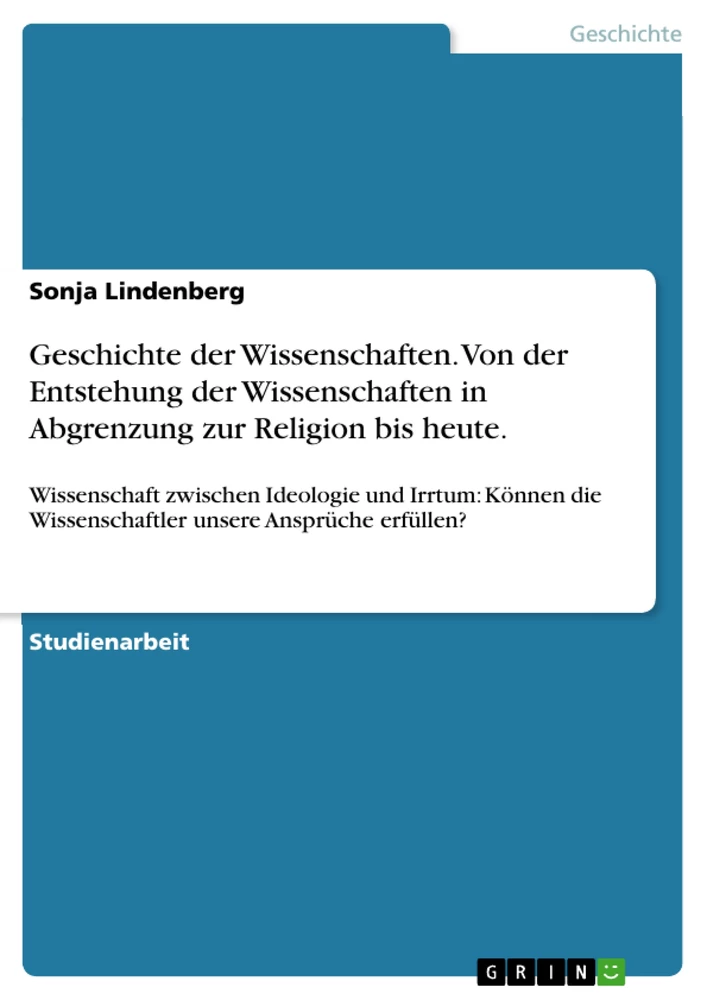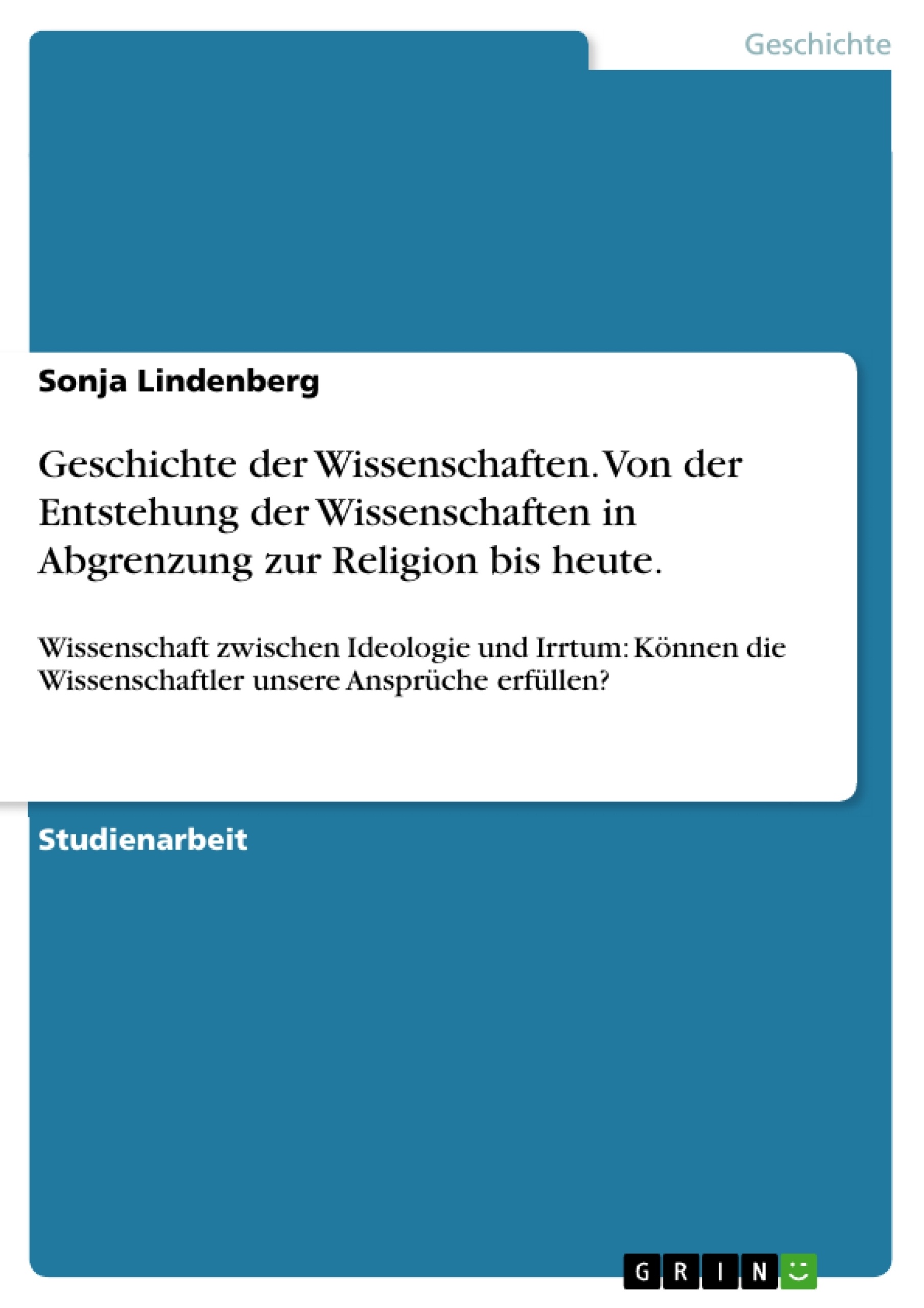Die Lage ist ruhig und scheinbar entspannt. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Naturwissenschaft und Theologie kämpferisch und gegenseitig die Richtigkeit ihrer Ansätze absprachen. Heute handele es sich viel mehr um ein Verhältnis „friedlichuninteressierter Koexistenz“ zweier Lager. Im Laufe der Geschichte ist die Wissenschaft zu einem immer wichtigeren Bestandteil unseres Lebens geworden. Schon seit den Anfängen der Wissenschaften durch Galilei, Keppler und Newton ist mit wissenschaftlichen Erkenntnissen eine zentrale Hoffnung verbunden: „Dies war vor allem eine grandiose Versprechung, die Ungewißheit der Weltläufe, die Unvorhersagbarkeit der künftigen Ereignisse durch Einsicht in die Naturgesetze zu überwinden, das, was sich ereignen könnte, berechenbar, das heißt vor allem vorausberechenbar und damit beherrschbar zu machen.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aufstieg der Wissenschaften
- Der Kampf mit der Kirche
- Die Parole: Wissenschaft als Weltgesinnung
- Das Dogma der Wissenschaften
- Popularisierung der Wissenschaft
- Ungetrübter Fortschrittsglaube
- Szientismus - wenn Wissenschaft zur Ideologie wird
- Wissenschaft als Irrweg?
- Der Autoritätsverlust
- Die Ambivalenz des Fortschritts
- Der Wunsch nach Irrtumslosigkeit
- Das Risiko des Nichtwissens
- Auf dem Weg zu einer besseren Wissenschaft?
- Der Umgang mit wissenschaftlichem Nichtwissen
- Pluralisierung des Wissens
- Wissenschaft im politischen Prozess
- Gegenentwurf und Warnung: Kreationismus
- Der alte Glaubensstreit heute
- Geht es nicht ohne Wissenschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Wissenschaften von ihrem Ursprung im Konflikt mit der Religion bis zur modernen Wissensgesellschaft. Sie analysiert die Ansprüche der Gesellschaft an die Wissenschaft und deren Vereinbarkeit mit den Möglichkeiten wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung. Ein zentrales Thema ist der Wandel des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Laufe der Zeit.
- Der historische Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion
- Die Entwicklung des Fortschrittsglaubens und des Szientismus
- Der zunehmende Autoritätsverlust der Wissenschaft
- Der Umgang mit wissenschaftlichem Nichtwissen und die Pluralisierung des Wissens
- Der Kreationismus als Gegenentwurf zur wissenschaftlichen Weltsicht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den scheinbar friedlichen Zustand zwischen Naturwissenschaft und Religion im Gegensatz zu früheren Zeiten. Sie skizziert die zentrale Hoffnung, die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbunden ist – die Überwindung von Ungewissheit durch die Beherrschung der Naturgesetze. Gleichzeitig werden die Kosten und Nebenwirkungen von Forschung und Fortschritt thematisiert, sowie die daraus resultierende Verantwortung der Wissenschaftler. Die Arbeit untersucht die Ansprüche der Gesellschaft an die Wissenschaft und deren Vereinbarkeit mit den Möglichkeiten der Wissenschaft, wobei das Verhältnis zwischen "Ideologie und Irrtum" im Fokus steht. Die Arbeit verfolgt einen chronologischen Aufbau, beginnend mit dem Konflikt mit der Kirche und endend mit der Wissenschaft in der Wissensgesellschaft. Ein Beispiel für das heutige Verhältnis von Wissenschaft und Religion soll abschliessend beleuchtet werden.
Der Aufstieg der Wissenschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Religion, beginnend mit der Kontroverse um Galileo Galilei. Es wird gezeigt, wie die Kirche neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse oft ablehnte, aus Angst vor einer Bedrohung der traditionellen Lehre. Beispiele wie die Auseinandersetzung mit Kopernikus und Darwin veranschaulichen die ablehnende Haltung der Kirche gegenüber radikal neuen Ideen. Das Kapitel beschreibt, wie die Naturwissenschaften oft als radikal angesehen wurden, weil sie überliefertes Wissen in Frage stellten. Schliesslich wird der Einfluss von Francis Bacon auf das Verständnis von Wissenschaft als Weltgesinnung und dem Streben nach Beherrschung der Natur durch wissenschaftliche Erkenntnis beschrieben.
Das Dogma der Wissenschaft: Dieses Kapitel beschreibt die Popularisierung der Wissenschaft und die damit verbundene Ablösung des dogmatisch-kirchlichen Weltbilds. Es wird die neue Auffassung von Wirklichkeit im Lichte der wissenschaftlichen Erkenntnis erläutert. Das Kapitel behandelt den ungetrübten Fortschrittsglauben und den Szientismus, bei dem Wissenschaft zur Ideologie wird. Es werden auch die Grenzen und möglichen Irrwege der Wissenschaft diskutiert.
Der Autoritätsverlust: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ambivalenz des Fortschritts, dem Wunsch nach Irrtumslosigkeit und dem Risiko des Nichtwissens im Kontext wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es analysiert, wie der Fortschrittsglaube durch die Wahrnehmung von negativen Folgen von wissenschaftlichen Entwicklungen in Frage gestellt wird. Der zunehmende Zweifel an der Allmacht der Wissenschaft und die Schwierigkeit, alle Risiken vorherzusehen, wird als zentrales Thema behandelt.
Auf dem Weg zu einer besseren Wissenschaft?: Dieses Kapitel thematisiert den Umgang mit wissenschaftlichem Nichtwissen, die Pluralisierung des Wissens und die Rolle der Wissenschaft im politischen Prozess. Es wird die Notwendigkeit diskutiert, die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis anzuerkennen und verschiedene Wissensformen zu berücksichtigen. Die Einbettung der Wissenschaft in den politischen Prozess und die damit verbundenen Herausforderungen werden beleuchtet.
Gegenentwurf und Warnung: Kreationismus: Dieses Kapitel beleuchtet den Kreationismus als Gegenentwurf zur wissenschaftlichen Weltsicht und diskutiert den anhaltenden Glaubensstreit zwischen Wissenschaft und Religion. Es wird die Frage gestellt, ob ein Leben ohne wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt denkbar ist.
Schlüsselwörter
Wissenschaftsgeschichte, Religion, Naturwissenschaft, Fortschrittsglaube, Szientismus, Autoritätsverlust, Wissenschaft und Gesellschaft, Risiko, Nichtwissen, Pluralisierung des Wissens, Kreationismus.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Wissenschaft, Gesellschaft und der Glaube
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Geschichte der Wissenschaften, ihren Aufstieg, ihren Einfluss auf die Gesellschaft und die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht. Er beleuchtet den historischen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion, die Entwicklung des Fortschrittsglaubens und des Szientismus, den Autoritätsverlust der Wissenschaft sowie den Umgang mit wissenschaftlichem Nichtwissen und die Pluralisierung des Wissens. Der Kreationismus wird als Gegenentwurf zur wissenschaftlichen Weltsicht diskutiert.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Zentrale Themen sind der historische Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion (z.B. Galileo Galilei, Kopernikus, Darwin), die Entwicklung des Fortschrittsglaubens und seine Grenzen (Szientismus), der Verlust an Autorität der Wissenschaft aufgrund von Risiken und unerwarteten Folgen wissenschaftlicher Fortschritte, der Umgang mit wissenschaftlichem Nichtwissen, die Pluralisierung des Wissens und die Rolle der Wissenschaft im politischen Prozess, sowie der Kreationismus als Gegenmodell zur wissenschaftlichen Weltsicht.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist chronologisch aufgebaut, beginnend mit dem Konflikt zwischen Wissenschaft und Kirche und endend mit der Wissenschaft in der modernen Wissensgesellschaft. Er beinhaltet eine Einleitung, Kapitelübersichten, eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die Zielsetzung und die wichtigsten Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Welche Kapitel enthält der Text?
Der Text umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Der Aufstieg der Wissenschaften, Das Dogma der Wissenschaften, Der Autoritätsverlust, Auf dem Weg zu einer besseren Wissenschaft?, Gegenentwurf und Warnung: Kreationismus.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text untersucht die Geschichte der Wissenschaften und analysiert das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Er befasst sich mit den Ansprüchen der Gesellschaft an die Wissenschaft und deren Vereinbarkeit mit den Möglichkeiten wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung. Im Mittelpunkt steht der Wandel des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Laufe der Zeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Wissenschaftsgeschichte, Religion, Naturwissenschaft, Fortschrittsglaube, Szientismus, Autoritätsverlust, Wissenschaft und Gesellschaft, Risiko, Nichtwissen, Pluralisierung des Wissens, Kreationismus.
Welche Rolle spielt der Kreationismus im Text?
Der Kreationismus wird als Gegenentwurf zur wissenschaftlichen Weltsicht dargestellt und als Beispiel für den anhaltenden Glaubensstreit zwischen Wissenschaft und Religion diskutiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Leben ohne wissenschaftliche Erkenntnisse denkbar ist.
Wie wird der Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion dargestellt?
Der Text beschreibt den historischen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion ausführlich, beginnend mit der Auseinandersetzung zwischen der Kirche und Wissenschaftlern wie Galileo Galilei. Es wird gezeigt, wie die Kirche neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse oft ablehnte, aus Angst vor einer Bedrohung der traditionellen Lehre. Beispiele wie die Auseinandersetzung mit Kopernikus und Darwin verdeutlichen dies.
Was ist Szientismus?
Der Text beschreibt Szientismus als eine Ideologie, in der die Wissenschaft als allmächtige und fehlerfreie Quelle von Wahrheit und Erkenntnis betrachtet wird, was zu einem ungetrübten Fortschrittsglauben führt und die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis vernachlässigt.
Wie wird der Autoritätsverlust der Wissenschaft thematisiert?
Der Text behandelt den Autoritätsverlust der Wissenschaft im Kontext der Ambivalenz des Fortschritts, des Wunsches nach Irrtumslosigkeit und dem Risiko des Nichtwissens. Der Fortschrittsglaube wird durch negative Folgen wissenschaftlicher Entwicklungen in Frage gestellt. Der zunehmende Zweifel an der Allmacht der Wissenschaft und die Schwierigkeit, alle Risiken vorherzusehen, sind zentrale Themen.
- Citar trabajo
- Sonja Lindenberg (Autor), 2005, Geschichte der Wissenschaften. Von der Entstehung der Wissenschaften in Abgrenzung zur Religion bis heute., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52544