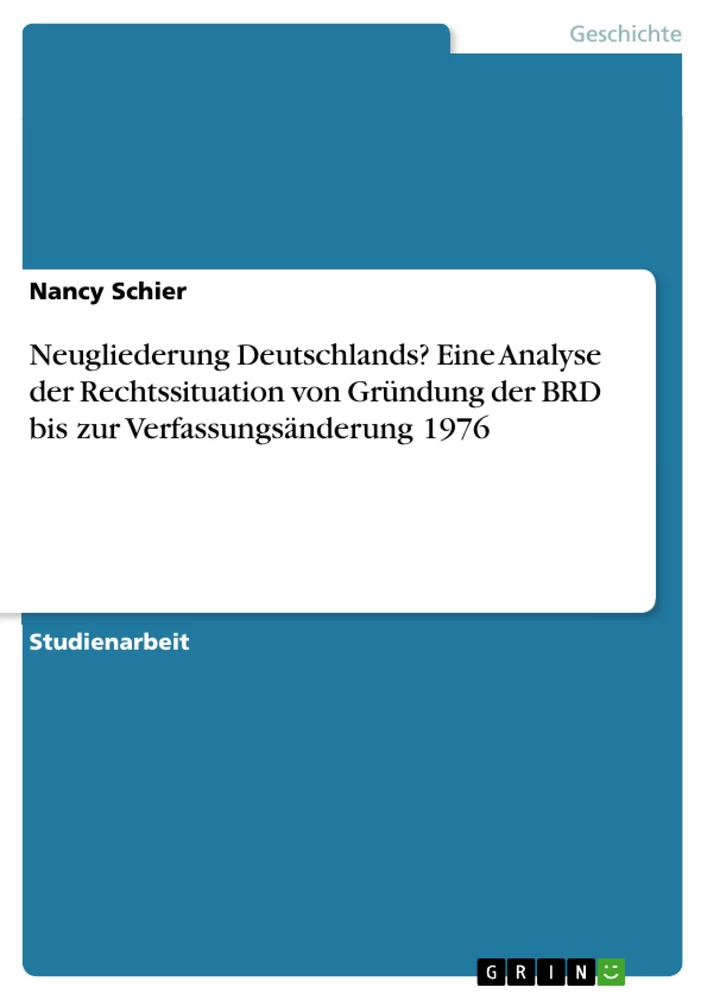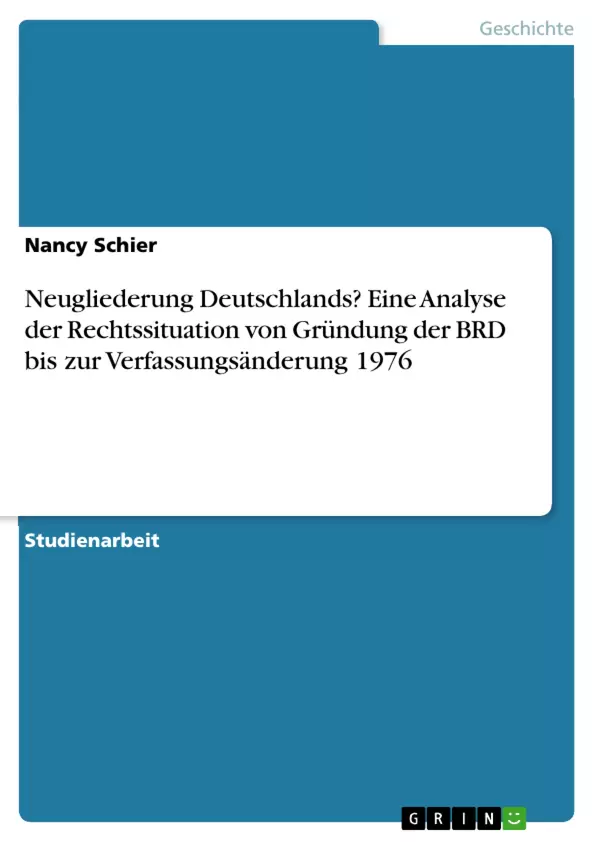Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderativer Staat, doch über ihre bestehenden innergebietlichen Ländergrenzen herrschte bei weitem nicht immer Einigkeit. Unmittelbar nach der deutschen Kapitulation und der Besetzung durch die Alliierten teilten die vier Besatzungsmächte die Grenzen der Zonen vor allem nach militärischen Aspekten ein. Somit wurden neue Länder geschaffen (z.B. Württemberg-Baden), Gebiete abgetrennt (z.B. die Pfalz von Bayern), Länder verloren ihre Eigenständigkeit (z.B. Schaumburg-Lippe) oder wurden gar ganz aufgelöst (z.B. Preußen). Um diese willkürliche Einteilung der Alliierten später zu korrigieren verankerte der Parlamentarische Rat Artikel 29 im Grundgesetz, der sich ausschließlich um die Neugliederung Deutschlands kümmern sollte.
Doch über all die Jahre hinweg entstanden immer nur wieder Debatten und Probleme um die Neugliederungsdiskussion, gehandelt hat die Bundesregierung selten. Hierbei ließ sie Paragraphen und Fristen außer Acht, verzögerte Volksentscheide oder setzte sich gar über sie hinweg. Durch das Erlassen neuer Bundesgesetze wurde altes Fehlverhalten korrigiert, oft nur grenzwärtig am Verfassungsbruch vorbei. Auch heute, 57 Jahre nach der Gründung der BRD, kam es zu keiner Neugliederung aufgrund von Artikel 29. Diese Seminararbeit soll die Rechtssituation der Neugliederung der BRD darstellen, von ihren Anfängen – mit dem in Kraft treten des Grundgesetzes – über die Volksbegehren bis zum Hessen-Urteil 1961 und den langen Weg zu den Volksentscheiden 1970 und 1975 bis hin zu der Kann-Bestimmung 1976, welche die Diskussion über die Neugliederung vorerst beruhigte. Dargestellt werden soll auch die einzig gelungene Fusion – die Entstehung des Südweststaates –, welche jedoch bei weitem kein Mustermodell war. Die Thematisierung der Seminararbeit orientiert sich hierbei immer streng am Grundgesetz und an der vorgebenden Rechtslage. Welche Fehler hat die Bundesregierung begangen? Welche Fristen hat sie nicht eingehalten? Welche Vorgaben von Artikel 29 wurden überschritten? War das Handeln der Regierung hierbei noch weitestgehend legal, oder machte sie sich gar einem Verfassungsbruch schuldig?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung von Artikel 29 GG
- 3. Ein geglücktes Modell: Der Südweststaat
- 4. Der unerfüllte Verfassungsauftrag
- 4.1. Die Volksbegehren bis zum Urteil 1961
- 4.2. Die Verfassungsänderung 1969
- 4.3. Die Kann-Bestimmung als Lösung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Rechtssituation der Neugliederung der Bundesrepublik Deutschland seit Inkrafttreten des Grundgesetzes bis zur Verfassungsänderung 1976. Sie untersucht die Umsetzung (oder Nicht-Umsetzung) von Artikel 29 GG und die damit verbundenen Herausforderungen und politischen Prozesse.
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der Neugliederung nach Artikel 29 GG
- Bewertung der Handlungen der Bundesregierung im Hinblick auf die Einhaltung von Fristen und Vorgaben
- Untersuchung der Volksbegehren und Volksentscheide im Kontext der Neugliederungsdebatte
- Auswertung des Erfolgsmodells des Südweststaates und seiner Bedeutung für die bundesdeutsche Geschichte
- Bewertung der "Kann-Bestimmung" von 1976 als Lösung des Problems
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der willkürlichen Grenzziehung der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg dar und führt in die Thematik der Neugliederung der Bundesrepublik Deutschland ein. Sie beschreibt den Hintergrund der Verfassung von Artikel 29 GG als Korrekturmaßnahme und zeigt die anhaltende Problematik der Umsetzung dieser Bestimmung auf. Die Arbeit skizziert den Fokus auf die rechtliche Situation, die Fehler der Bundesregierung und die Frage nach einem möglichen Verfassungsbruch.
2. Einführung von Artikel 29 GG: Dieses Kapitel beschreibt die Vorgeschichte von Artikel 29 GG, beginnend mit den Zweifeln an der alliierten Grenzziehung und den Versuchen der Ministerpräsidentenkonferenz, eine Lösung zu finden. Es beleuchtet die Debatten im Parlamentarischen Rat über die Kompetenzen des Bundes, der Länder und der Bevölkerung und erklärt die Entstehung und den Wortlaut von Artikel 29 GG mit seinen sieben Absätzen, der Volksabstimmung und den Fristen für die Neugliederung. Der Abschnitt analysiert die Unklarheiten in der Formulierung des Artikels hinsichtlich landsmannschaftlicher Verbundenheit, kultureller Zusammenhänge und wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit.
3. Ein geglücktes Modell: Der Südweststaat: Dieses Kapitel analysiert den Südweststaat als einziges Beispiel einer erfolgreichen Länderfusion. Es wird darauf eingegangen, inwiefern dieser Prozess als Musterbeispiel dienen konnte, und gleichzeitig werden die Grenzen und die fehlende Übertragbarkeit auf andere Bundesländer herausgearbeitet. Die Analyse konzentriert sich auf die besonderen Umstände und Bedingungen, die diese Fusion ermöglichten, und untersucht, warum sich dieses Modell nicht auf andere Bundesländer übertragen ließ.
4. Der unerfüllte Verfassungsauftrag: Dieses Kapitel behandelt die unzureichende Umsetzung von Artikel 29 GG. Es beschreibt die Volksbegehren, die Verfassungsänderung 1969 und die "Kann-Bestimmung" von 1976. Der Abschnitt untersucht im Detail, wie die Bundesregierung mit den Fristen und Vorgaben des Artikels umgegangen ist und welche rechtlichen und politischen Gründe zur Nicht-Umsetzung führten. Die Analyse geht auf die jeweiligen Volksbegehren ein, beleuchtet die Gründe für deren Erfolg oder Misserfolg und stellt die Bedeutung des Hessen-Urteils von 1961 dar. Die "Kann-Bestimmung" wird als Versuch der Lösung der Problematik analysiert und ihre Wirkung beurteilt.
Schlüsselwörter
Artikel 29 GG, Neugliederung Deutschlands, Föderalismus, Bundesrepublik Deutschland, Volksbegehren, Volksentscheid, Bundesregierung, Verfassungsrecht, Südweststaat, Hessen-Urteil 1961, "Kann-Bestimmung" 1976, landsmannschaftliche Verbundenheit, kulturelle Zusammenhänge, wirtschaftliche Zweckmäßigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Artikel 29 GG und die Neugliederung Deutschlands
Was ist das Thema dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Rechtssituation der Neugliederung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Umsetzung (oder Nicht-Umsetzung) von Artikel 29 Grundgesetz (GG) und die damit verbundenen Herausforderungen und politischen Prozesse von der Verfassung bis zur Verfassungsänderung 1976.
Welche Aspekte werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen der Neugliederung nach Artikel 29 GG, bewertet die Handlungen der Bundesregierung hinsichtlich der Einhaltung von Fristen und Vorgaben, analysiert Volksbegehren und Volksentscheide im Kontext der Neugliederungsdebatte, bewertet das Erfolgsmodell des Südweststaates und untersucht die „Kann-Bestimmung“ von 1976 als Lösungsansatz.
Was ist der Inhalt der einzelnen Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Problematik der willkürlichen Grenzziehung nach dem Krieg dar und führt in die Thematik ein. Kapitel 2 (Einführung von Artikel 29 GG) beschreibt die Vorgeschichte, Debatten im Parlamentarischen Rat und die Unklarheiten in der Formulierung des Artikels. Kapitel 3 (Ein geglücktes Modell: Der Südweststaat) analysiert die erfolgreiche Länderfusion im Südwesten und ihre Übertragbarkeit. Kapitel 4 (Der unerfüllte Verfassungsauftrag) behandelt die unzureichende Umsetzung von Artikel 29 GG, Volksbegehren, die Verfassungsänderung 1969 und die „Kann-Bestimmung“ von 1976. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt Artikel 29 GG in der Seminararbeit?
Artikel 29 GG steht im Mittelpunkt der Arbeit. Er wird als Korrekturmaßnahme zur willkürlichen Grenzziehung der Alliierten betrachtet, und die Seminararbeit analysiert, inwiefern seine Bestimmungen umgesetzt wurden und welche Herausforderungen sich dabei stellten.
Welche Bedeutung hat das Beispiel des Südweststaates?
Der Südweststaat wird als einziges Beispiel einer erfolgreichen Länderfusion im Kontext von Artikel 29 GG betrachtet. Die Arbeit untersucht die besonderen Umstände, die diese Fusion ermöglichten, und warum dieses Modell nicht auf andere Bundesländer übertragbar war.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Seminararbeit?
Die zentralen Ergebnisse beziehen sich auf die unzureichende Umsetzung von Artikel 29 GG, die Rolle der Volksbegehren und Volksentscheide, die Bewertung der Handlungen der Bundesregierung und die Analyse der „Kann-Bestimmung“ von 1976 als versuchter Lösungsansatz für die Problematik der Neugliederung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Artikel 29 GG, Neugliederung Deutschlands, Föderalismus, Bundesrepublik Deutschland, Volksbegehren, Volksentscheid, Bundesregierung, Verfassungsrecht, Südweststaat, Hessen-Urteil 1961, „Kann-Bestimmung“ 1976, landsmannschaftliche Verbundenheit, kulturelle Zusammenhänge, wirtschaftliche Zweckmäßigkeit.
- Citar trabajo
- Nancy Schier (Autor), 2006, Neugliederung Deutschlands? Eine Analyse der Rechtssituation von Gründung der BRD bis zur Verfassungsänderung 1976, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52734