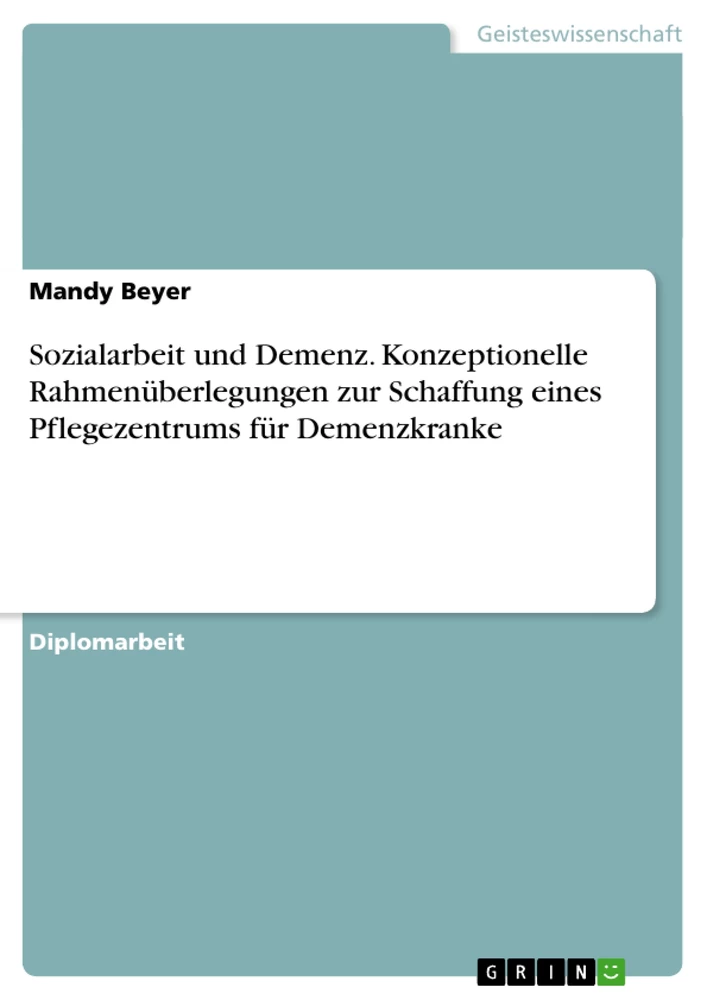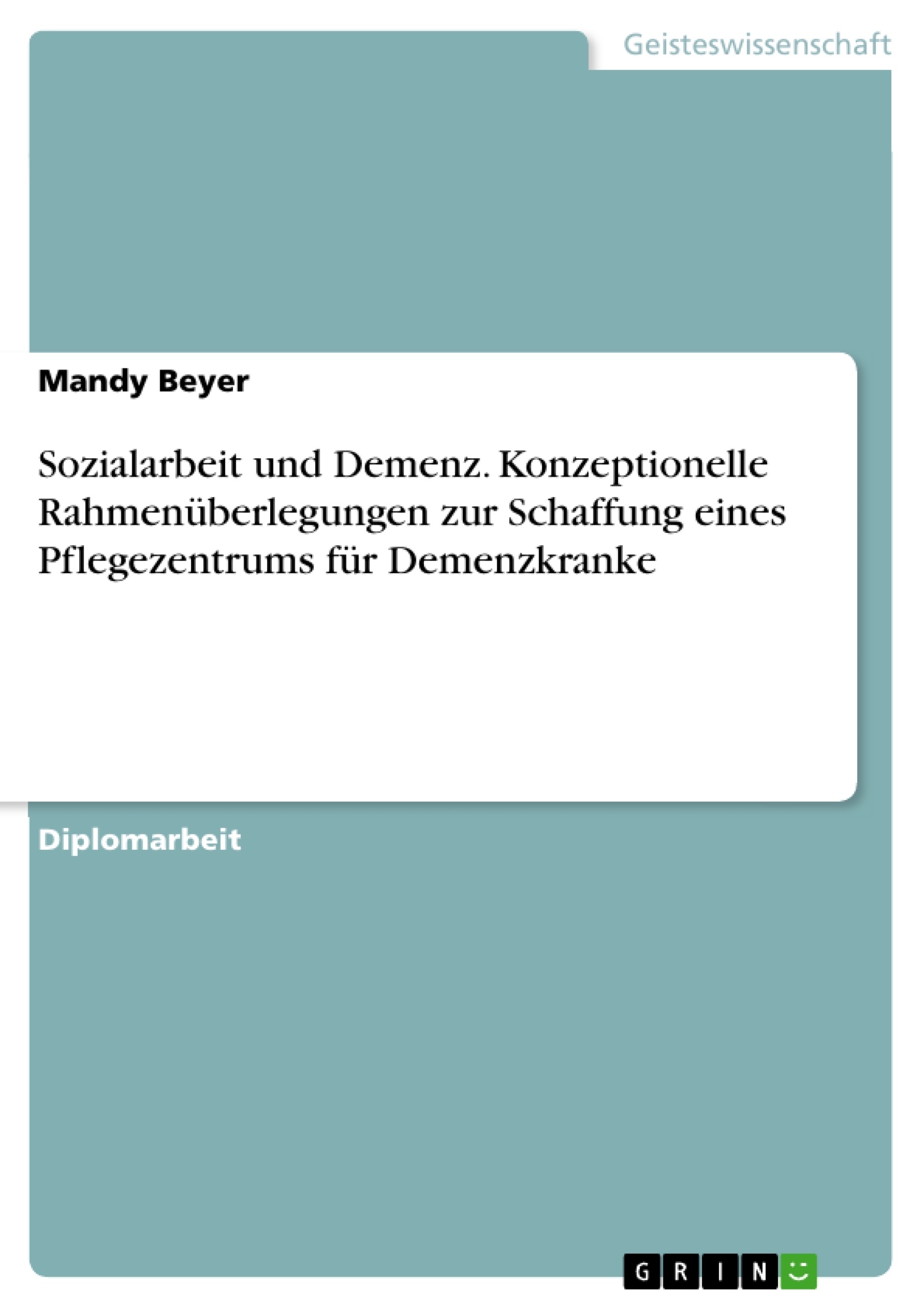Menschen, die unter einer Demenz leiden, werden heute oft als schwerstbeeinträchtigte, leidende und hilfsbedürftige Personen angesehen, die beschützt werden müssen.
Betroffene Familien sehen darin "das große Unglück", die Gesellschaft ein finanzielles Fiasko.
Nur selten unterscheidet jemand zwischen den einzelnen Demenzformen oder zwischen den vielfältigen, sehr unterschiedlichen Schwankungsbreiten dieser Erkrankung. "Wer dement ist, kann nichts mehr", ist ein übliches pauschaliertes Vorurteil.
Die Demenz wird heutzutage immer noch als rein organische Störung angesehen, "bei der man nichts mehr machen kann". Dabei wirken sich vielfältige Dienstleistungsmöglichkeiten positiv auf die Lebensqualität von Menschen mit Demenz aus. Untersuchungen des Kuratoriums deutsche Altershilfe belegen, dass der Verlauf einer Demenzerkrankung nicht nur von organischen, sondern auch von psychischen und sozialen Faktoren abhängig ist.
Doch in Wirklichkeit versucht die Umgebung von Demenzkranken nicht den Verlauf zu begünstigen, sondern tut, einfach gesagt, "alles, damit der Kranke noch kränker wird und seine Behinderungen möglichst rasch fortschreiten".
Das Umfeld wird immer starrer, reizloser und unüberschaubarer und es bleibt nicht aus, dass Menschen, die mit ihrer Orientierung und ihrem Selbstbild vermehrte Schwierigkeiten haben, noch einsamer, abhängiger und hilfloser werden, als dies wirklich aufgrund des Beschwerdebildes notwendig wäre.
Es bedarf also noch größerer Anstrengungen, damit ein alter Mensch mit einer Demenzerkrankung als Mensch wahrgenommen wird und nicht als Schwerkranker ohne eigenen Willen. Es ist wichtig, den Demenzkranken als Individuum wahrzunehmen und seine Ressourcen zu fördern. Man muss lernen, neue Wege zu gehen.
Einen solchen "neuen Weg" soll die folgende Arbeit darstellen, die sich mit speziellen konzeptionellen Rahmenbedingungen für die Betreuung von Demenzkranken beschäftigen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Diagnose: Demenz
- Begriffsklärung: Demenz
- Verschiedene Formen von Demenz
- Entstehung einer Demenz
- Der Verlauf
- Das Anfangsstadium
- Die mittlere Phase
- Das dritte Stadium
- Vorstellung von Testverfahren zur Einordnung einer Demenz
- Der Mehrfachwahl-Wortschatztest (MWT-B)
- Die Mini-Mental State-Examination (MMSE)
- Der Uhrentest
- Die Epidemiologie der Demenz
- Prävalenz
- Inzidenz
- Geschlechtsunterschiede
- Demographische Entwicklung
- Der Alltag von Demenzkranken
- Einblick in das täglich Leben eines Demenzkranken
- Spezifische Verhaltensweisen von Demenzkranken
- Aggressivität
- Angst
- Antriebslosigkeit
- Probleme mit der Verständigung
- Bewegungsdrang
- Grundregeln für die Betreuung von Demenzkranken
- Die Tatsachen akzeptieren
- Auf Unerwartetes einstellen
- Gewohnheiten erhalten
- Kommunikation
- Finanzielle Hilfen für den Betreuungsalltag
- Finanzielle Leistungen, die unabhängig vom Einkommen sind
- Hilfen bei anerkannter Behinderung nach dem Schwerbehindertengesetz
- Finanzielle Hilfen, die nur bei niedrigem Einkommen gewährt werden
- Befreiung von Zuzahlungen
- Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz
- Finanzielle Leistungen, die unabhängig vom Einkommen sind
- Sozialpädagogische Handlungsfelder und therapeutische Betreuungsmöglichkeiten bei der Arbeit mit Demenzkranken
- Lerntheoretische Handlungsansätze
- Das Realitäts-Orientierungs-Training (ROT)
- Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET)
- Die Erinnerungstherapie
- Der verstehende Umgang zum dementiell Erkrankten
- Validation
- Biographiearbeit
- Angehörigenarbeit
- Begleitende Angebote in der Betreuung Demenzkranker
- Basale Stimulation
- Kunst- und Musiktherapie
- Lerntheoretische Handlungsansätze
- Strukturelle Anforderungen an den institutionellen Wohn- und Lebensraum von Demenzkranken. Milieu Gestaltung
- Betreuungsmodelle
- Anforderungen an das architektonische Milieu
- Entwurfsprinzipien für die Gestaltung der Umgebung für Verwirrte
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die konzeptionellen Rahmenbedingungen für die Schaffung eines Pflegezentrums für Demenzkranke. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Erkrankung Demenz, der Bedürfnisse der Betroffenen und der notwendigen sozialpädagogischen und therapeutischen Maßnahmen zu entwickeln. Die Arbeit soll als Grundlage für die Planung und Gestaltung eines solchen Pflegezentrums dienen.
- Diagnose und Verlauf von Demenz
- Epidemiologie und demografische Entwicklung der Demenz
- Alltag und spezifische Bedürfnisse von Demenzkranken
- Sozialpädagogische und therapeutische Handlungsansätze
- Gestaltung eines demenzfreundlichen Wohn- und Lebensraums
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beginnt mit einem Gedicht von Rainer Maria Rilke, das den Verlust der vertrauten Welt durch Demenz symbolisiert. Die Autorin beschreibt ihre Erfahrungen mit Demenzkranken und betont die Notwendigkeit von Wissen und Verständnis für eine erfolgreiche Betreuung.
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und skizziert die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung des Themas hervor und verweist auf den Bedarf an spezialisierten Pflegeeinrichtungen für Demenzkranke.
Diagnose: Demenz: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die Demenz. Es umfasst die Begriffsklärung, verschiedene Demenzformen, Entstehungsmechanismen, den Verlauf der Erkrankung in verschiedenen Stadien, und die Vorstellung relevanter Testverfahren wie MWT-B, MMSE und den Uhrentest zur Diagnose.
Die Epidemiologie der Demenz: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Häufigkeit (Prävalenz und Inzidenz) von Demenz, betrachtet geschlechtsspezifische Unterschiede und analysiert die demografische Entwicklung im Kontext des steigenden Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung, was die Bedeutung von angemessenen Pflegeeinrichtungen unterstreicht.
Der Alltag von Demenzkranken: Dieses Kapitel gibt einen detaillierten Einblick in den Alltag von Demenzkranken, beschreibt spezifische Verhaltensweisen wie Aggressivität, Angst, Antriebslosigkeit, Kommunikationsprobleme und Bewegungsdrang. Es legt zudem Grundregeln für die Betreuung fest und informiert über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und ihre Angehörigen.
Sozialpädagogische Handlungsfelder und therapeutische Betreuungsmöglichkeiten bei der Arbeit mit Demenzkranken: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene sozialpädagogische und therapeutische Ansätze im Umgang mit Demenzkranken. Es behandelt lerntheoretische Ansätze wie ROT, SET und Erinnerungstherapie, sowie den verstehenden Umgang durch Validation, Biographiearbeit und Angehörigenarbeit. Zusätzlich werden begleitende Angebote wie basale Stimulation und Kunst-/Musiktherapie vorgestellt.
Strukturelle Anforderungen an den institutionellen Wohn- und Lebensraum von Demenzkranken. Milieu Gestaltung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die strukturellen Anforderungen an ein Pflegezentrum für Demenzkranke. Es behandelt verschiedene Betreuungsmodelle und die Anforderungen an das architektonische Milieu, inklusive Gestaltungsprinzipien für eine demenzfreundliche Umgebung.
Schlüsselwörter
Demenz, Pflegezentrum, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Therapie, Validation, Biographiearbeit, Angehörigenarbeit, Milieu Gestaltung, Demenzfreundliche Umgebung, ROT, SET, Erinnerungstherapie, basale Stimulation, Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Konzeptionelle Rahmenbedingungen für die Schaffung eines Pflegezentrums für Demenzkranke
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die konzeptionellen Rahmenbedingungen für die Schaffung eines Pflegezentrums für Demenzkranke. Sie bietet ein umfassendes Verständnis der Erkrankung Demenz, der Bedürfnisse der Betroffenen und der notwendigen sozialpädagogischen und therapeutischen Maßnahmen. Die Arbeit dient als Grundlage für die Planung und Gestaltung eines solchen Pflegezentrums.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Diagnose und Verlauf von Demenz, Epidemiologie und demografische Entwicklung der Demenz, Alltag und spezifische Bedürfnisse von Demenzkranken, sozialpädagogische und therapeutische Handlungsansätze sowie die Gestaltung eines demenzfreundlichen Wohn- und Lebensraums.
Welche Diagnoseverfahren für Demenz werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Testverfahren zur Diagnose von Demenz, darunter der Mehrfachwahl-Wortschatztest (MWT-B), die Mini-Mental State-Examination (MMSE) und der Uhrentest.
Wie wird der Alltag von Demenzkranken beschrieben?
Die Arbeit gibt einen detaillierten Einblick in den Alltag von Demenzkranken, beschreibt typische Verhaltensweisen (Aggressivität, Angst, Antriebslosigkeit, Kommunikationsprobleme, Bewegungsdrang) und erläutert Grundregeln für die Betreuung. Zusätzlich werden finanzielle Hilfsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige vorgestellt.
Welche sozialpädagogischen und therapeutischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ansätze, darunter lerntheoretische Ansätze wie Realitäts-Orientierungs-Training (ROT), Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET) und Erinnerungstherapie. Weiterhin werden der verstehende Umgang durch Validation, Biographiearbeit und Angehörigenarbeit behandelt. Zusätzliche begleitende Angebote wie basale Stimulation und Kunst-/Musiktherapie werden vorgestellt.
Welche Anforderungen werden an den Wohn- und Lebensraum von Demenzkranken gestellt?
Die Arbeit beschreibt strukturelle Anforderungen an ein Pflegezentrum für Demenzkranke, verschiedene Betreuungsmodelle und die Anforderungen an das architektonische Milieu, inklusive Gestaltungsprinzipien für eine demenzfreundliche Umgebung.
Welche Informationen zur Epidemiologie der Demenz werden gegeben?
Die Arbeit behandelt die Häufigkeit von Demenz (Prävalenz und Inzidenz), geschlechtsspezifische Unterschiede und die demografische Entwicklung im Kontext des steigenden Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, beginnend mit dem Vorwort und der Einleitung, über die Diagnose und den Verlauf der Demenz, die Epidemiologie, den Alltag von Demenzkranken, sozialpädagogische und therapeutische Ansätze, bis hin zu den strukturellen Anforderungen an den Wohnraum und einer Schlussbemerkung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demenz, Pflegezentrum, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Therapie, Validation, Biographiearbeit, Angehörigenarbeit, Milieu Gestaltung, Demenzfreundliche Umgebung, ROT, SET, Erinnerungstherapie, basale Stimulation, Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz.
- Quote paper
- Mandy Beyer (Author), 2002, Sozialarbeit und Demenz. Konzeptionelle Rahmenüberlegungen zur Schaffung eines Pflegezentrums für Demenzkranke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5330