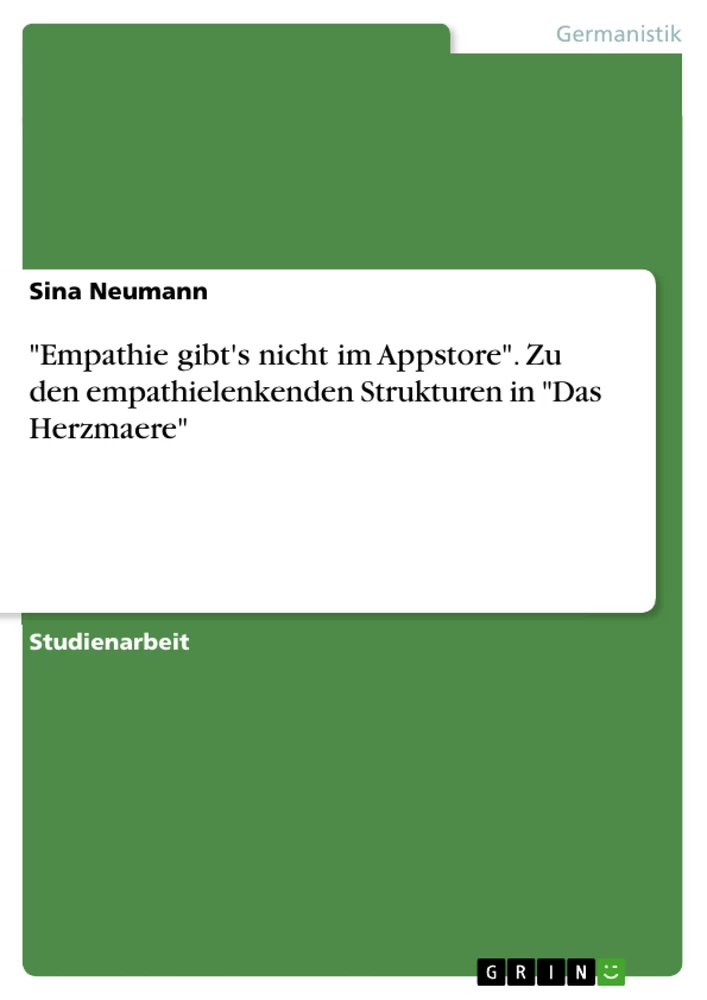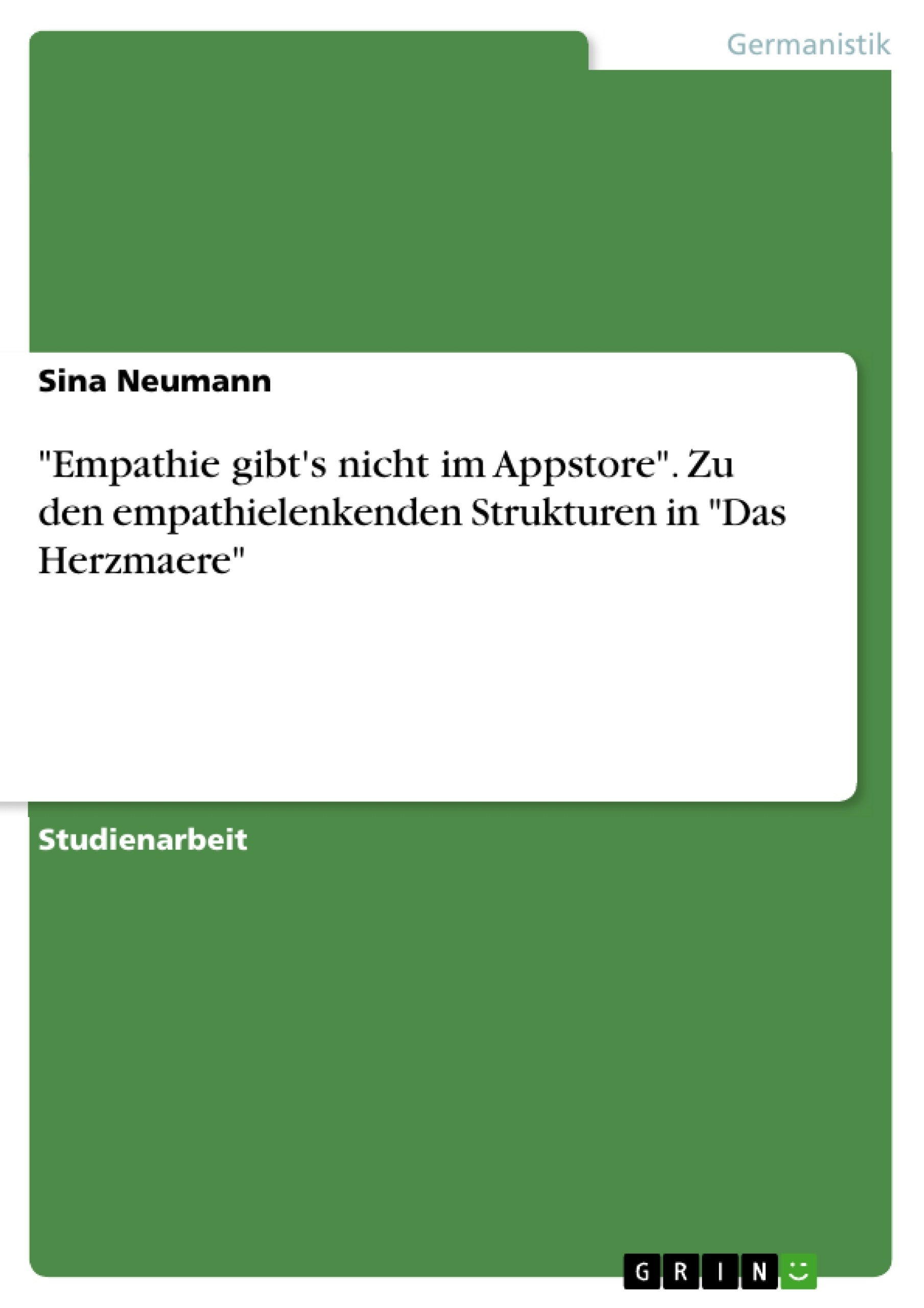In der heutigen Zeit kann der Eindruck entstehen, dass das, wie fast alles, durch einen Download einer App problemlos und schnell erledigt werden kann. Natürlich kann niemand wirklich sehen, hören, fühlen was und wie ein anderer Mensch sieht, hört und fühlt. Es ist aber möglich, das, was wir von uns selbst kennen, nachzufühlen, also wie es sich für einen anderen Menschen anfühlt, anhört, aussieht. Fühlen muss man können und wollen. Ohne dieses Hineinfühlen in Andere ist das gemeinschaftliche Leben nur schwer möglich. Empathie bedeutet auch, zu verstehen, warum andere so und nicht anders reagieren und Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen zu registrieren und ernst zu nehmen. Sicher ist, dass wir diese Kompetenzen auch beim Lesen oder Hören und Verstehen von literarischen Texten benötigen. Und beim Schreiben wenden wir dementsprechende Techniken an.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Empathie. Mitleid. Sympathie. Definition der Grundlagenbegriffe
- 2.1 Empathie - Der wertneutrale „Als-ob-Zustand❝
- 2.2 Mitleid - Die intensive Emotion
- 2.3 Sympathie - Die positive Wertschätzung
- 3 Modell zur Analyse von empathiefördernden Textstrukturen nach Verena Barthel
- 4 Analyse der empathiefördernden Strukturen in „Das Herzmaere“
- 4.1 Die Ebene des epischen Berichts in „Das Herzmaere“
- 4.2 Die Ebene der persönlichen Erzählinstanz in „Das Herzmaere“
- 4.3 Die Ebene der Figurenrede in „Das Herzmaere“
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die empathiefördernden Strukturen in Konrads von Würzburgs mittelhochdeutscher Versnovelle „Das Herzmaere“. Ziel ist es, zu verstehen, wie der Text den Leser emotional einbezieht und Empathie erzeugt. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Ebenen der Textstruktur, wie epischen Bericht, persönliche Erzählinstanz und Figurenrede, um die verschiedenen Techniken der Empathielenkung aufzudecken.
- Definition und Abgrenzung der zentralen Begriffe Empathie, Mitleid und Sympathie
- Analyse der empathiefördernden Textstrukturen nach dem Modell von Verena Barthel
- Anwendungen des Modells auf "Das Herzmaere" und Identifizierung von spezifischen Techniken der Empathielenkung
- Diskussion der Bedeutung der Empathieförderung im Kontext mittelalterlicher Literatur
- Bedeutung von Empathie im Hinblick auf die Rezeption literarischer Texte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt den Begriff der Empathie in den Mittelpunkt und beleuchtet seine Relevanz in der heutigen Zeit sowie im Kontext der Literatur. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und ihre Ziele.
Kapitel 2 widmet sich der Definition und Abgrenzung der zentralen Begriffe Empathie, Mitleid und Sympathie, die als Grundlage für die Analyse der Textstrukturen dienen. Hier wird die Empathie als ein wertneutraler „Als-ob-Zustand“ beschrieben, während Mitleid als eine intensive Emotion und Sympathie als positive Wertschätzung dargestellt werden.
Kapitel 3 erläutert das Modell von Verena Barthel zur Analyse von empathiefördernden Textstrukturen. Dieses Modell dient als Werkzeug für die anschließende Analyse der Versnovelle „Das Herzmaere“.
Kapitel 4 analysiert die empathiefördernden Strukturen in „Das Herzmaere“ auf verschiedenen Ebenen, nämlich auf der Ebene des epischen Berichts, der persönlichen Erzählinstanz und der Figurenrede. Hier werden die Techniken untersucht, mit denen der Text den Leser emotional einbezieht und Empathie erzeugt.
Schlüsselwörter
Empathie, Mitleid, Sympathie, Textanalyse, empathiefördernde Strukturen, Versnovelle, „Das Herzmaere“, Konrad von Würzburg, Verena Barthel, mittelalterliche Literatur, Rezeption, emotionale Einbindung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Versnovelle „Das Herzmaere“?
„Das Herzmaere“ von Konrad von Würzburg ist eine mittelalterliche Erzählung, die emotionale Themen behandelt und den Leser durch spezifische Textstrukturen zur Empathie anregt.
Wie wird Empathie in dieser Arbeit definiert?
Empathie wird als ein wertneutraler „Als-ob-Zustand“ definiert, bei dem man die Gefühle anderer nachvollzieht, ohne sie zwangsläufig selbst als eigene Emotion zu übernehmen.
Was ist der Unterschied zwischen Empathie, Mitleid und Sympathie?
Während Empathie wertneutral ist, beschreibt Mitleid eine intensive geteilte Emotion und Sympathie eine positive Wertschätzung gegenüber einer Person.
Welches Modell wird zur Textanalyse verwendet?
Die Analyse nutzt das Modell von Verena Barthel zur Untersuchung von empathiefördernden Textstrukturen.
Auf welchen Ebenen wird die Empathielenkung in „Das Herzmaere“ untersucht?
Die Untersuchung erfolgt auf drei Ebenen: dem epischen Bericht, der persönlichen Erzählinstanz und der Figurenrede.
- Citar trabajo
- Sina Neumann (Autor), 2019, "Empathie gibt's nicht im Appstore". Zu den empathielenkenden Strukturen in "Das Herzmaere", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535542