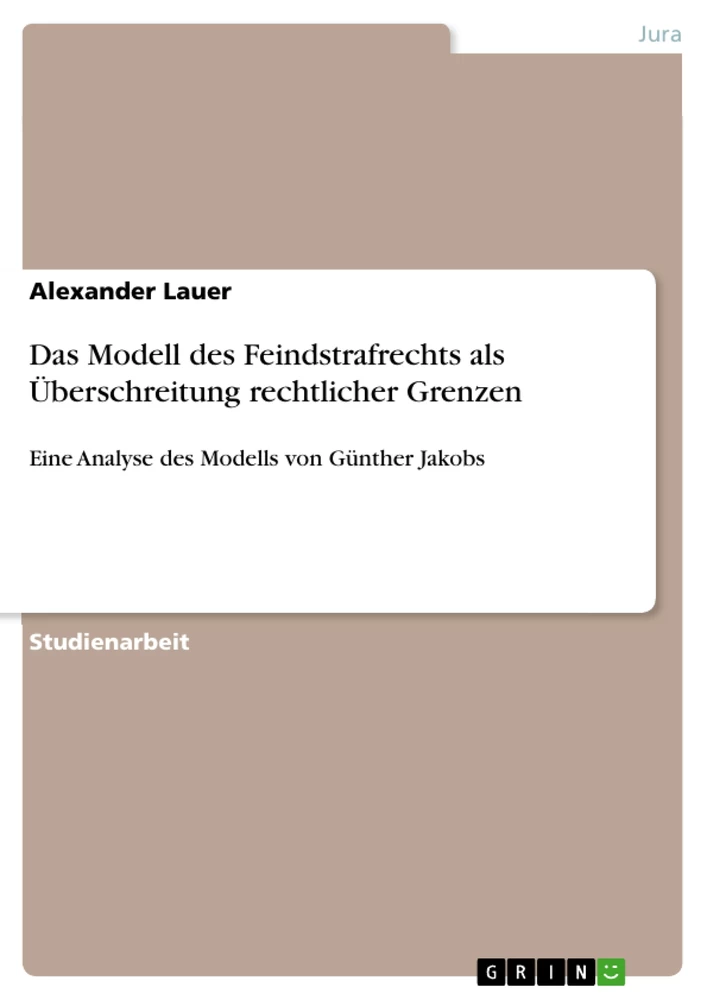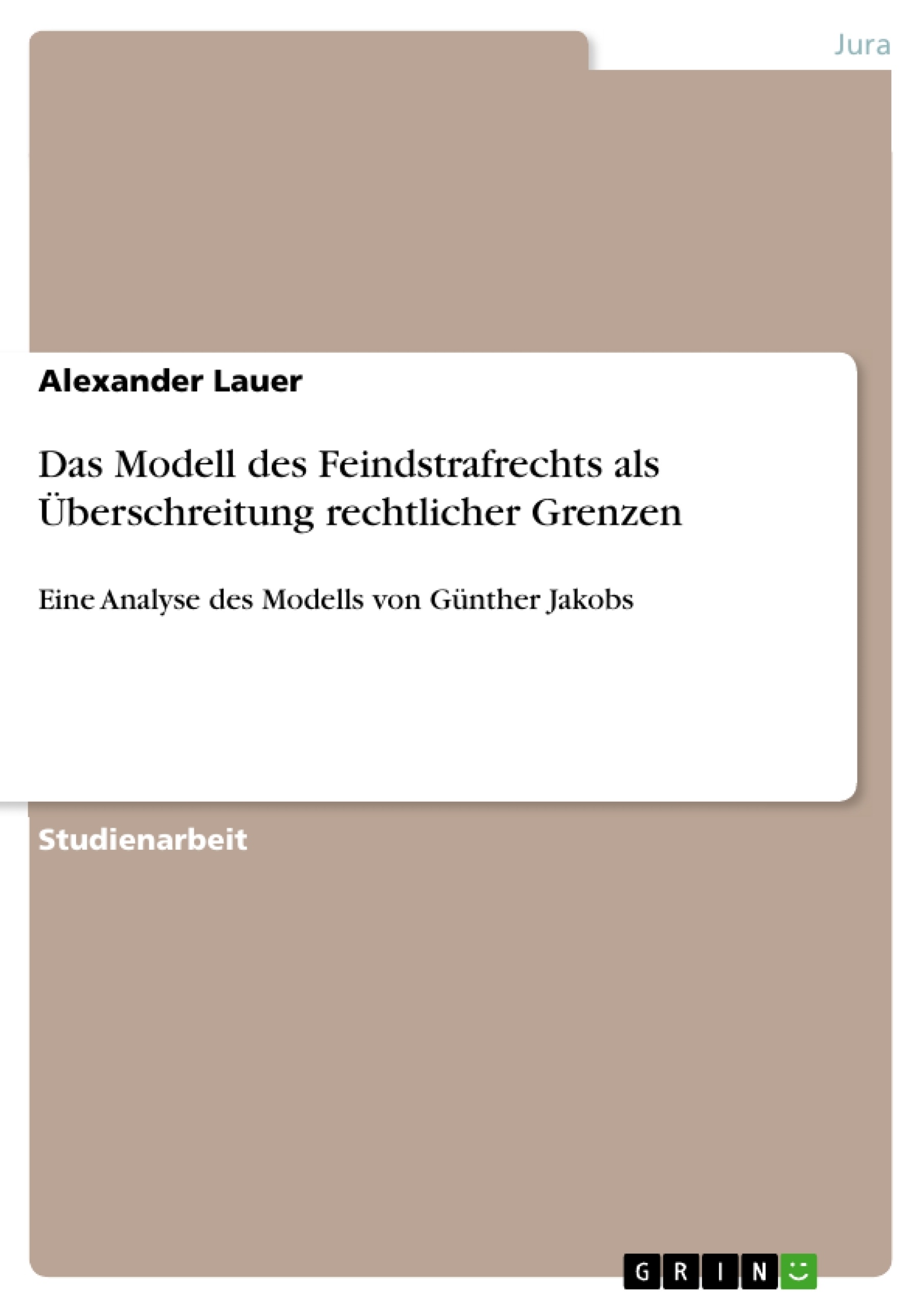In dieser Arbeit geht es um die Bestimmung des Feindbegriffs und um die Frage der Vertretbarkeit von Günther Jakobs’ Modell des Feindstrafrechts. Dafür ist diese Modell zunächst darzustellen, wobei der Schwerpunkt auf Jakobs’ Abgrenzung von Feind und Bürger liegen wird. In einem zweiten Schritt ist das Modell des Feindstrafrechts dann einer Kritik zu unterziehen. Hierbei soll wiederum der Begriff des Feindes im Vordergrund stehen. Außerdem wird in diesem Rahmen danach zu fragen sein, ob Jakobs’ Thesen als bloße Beschreibung der ‚wirklichen‘ Rechtslage oder doch als ‚normatives Programm‘ aufzufassen sind, da im Schrifttum die Kritik unter der einen Prämisse gravierend von derjenigen unter der anderen abweicht.
Eines der wichtigsten Mittel, die dem Staat zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen zur Verfügung stehen, ist das Strafrecht, das gemeinhin als sein schärfstes Schwert gilt. Als Jurist kann man sich jedoch fragen, ob das geltende (deutsche) Strafrecht überhaupt auf derartige Kriminalität ausgelegt ist und hierauf angemessen reagieren kann oder ob es dafür nicht eine ganz andere als seine herkömmliche, ‚überlieferte‘ Gestalt annehmen müsste oder ob es eine solche andere Gestalt bereits angenommen hat.
Von den unterschiedlichen Antworten, die auf diese Frage gegeben worden sind, ist das vor allem im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts diskutierte und stets mit dem Namen Günther Jakobs verbundene Modell des Feindstrafrechts zu gewisser Bekanntheit gelangt. Jenes Modell handelt davon, innerhalb welcher Grenzen das Strafrecht operieren darf, um (noch) als rechtsstaatlich gelten zu können, und ob es ein Strafrecht jenseits dieser Grenzen, mithin ein Feindstrafrecht, gibt oder gar geben muss. Gleichzeitig ist Jakobs’ Modell eine Grenzziehung immanent, mit der es steht und fällt: Wer ist der Feind und damit dem Feindstrafrecht unterworfen, und wer nicht? Ferner fordert die Theorie des Feindstrafrechts – nicht zuletzt wegen der ‚gnadenlosen‘ Art, in der Jakobs sie vorträgt – geradezu zum Nachdenken darüber heraus, ob sie selbst in unzulässiger Weise bestimmte Grenzen überschreitet, die dem Strafrecht eigen sind oder diesem letztlich vom Verfassungsrecht gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung und Untersuchung
- A. Das Feindstrafrecht nach Günther Jakobs
- I. Überblick über die Entwicklung des Modells
- 1. Grundlegung 1985
- 2. Weiterentwicklung seit 1999
- II. Begründung des Modells
- III. Nähere Ausgestaltung des Modells
- 1. Feindstrafrecht als gebändigter Krieg gegen Terroristen
- 2. Verhältnismäßigkeit und Beschränkungen des Feindstrafrechts
- B. Kritik des Feindstrafrechts
- I. Deskriptive und normative Ebene des Begriffs
- II. Befürwortende Stimmen auf beiden Ebenen
- 1. Ähnliche normative Modelle
- a) Gerd Roellecke – Stumme Gewaltanwendung gegen Terroristen
- b) Otto Depenheuer – Im Ernstfall Feindstrafrecht
- c) Cornelius Prittwitz – Risikostrafrecht
- 2. Argumente für die Richtigkeit der deskriptiven Ebene
- III. Defizite auf beiden Ebenen
- 1. Defizite auf deskriptiver Ebene
- 2. Defizite auf normativer Ebene
- a) Empirische und strafzwecktheoretische Erwägungen
- b) Problematischer Feindbegriff
- aa) Keine Anlehnung an Carl Schmitt
- bb) Grenzenlose Unbestimmtheit
- cc) Verstoß gegen das Prinzip der Menschenwürde
- IV. Kein rein philosophisches Modell
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit dem Modell des Feindstrafrechts, wie es von Günther Jakobs entwickelt wurde, auseinander. Ziel ist es, die Entwicklung, Begründung und Ausgestaltung des Modells darzustellen und kritisch zu beleuchten.
- Entwicklung und Grundlegung des Feindstrafrechts
- Begründung des Modells: Unterscheidung zwischen Person und Individuum, Bürger und Feind
- Kritik des Feindstrafrechts auf deskriptiver und normativer Ebene
- Defizite des Feindstrafrechts: empirische und strafzwecktheoretische Erwägungen, problematischer Feindbegriff
- Abgrenzung des Feindstrafrechts von anderen Modellen und Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Die Arbeit stellt zunächst das Modell des Feindstrafrechts nach Günther Jakobs vor. Es wird die Entwicklung des Modells von seiner Grundlegung 1985 bis zu den aktuellen Weiterentwicklungen seit 1999 dargestellt. Im Anschluss werden die Begründungen des Modells, insbesondere die Unterscheidung zwischen Person und Individuum sowie zwischen Bürger und Feind, erläutert. Abschließend wird die nähere Ausgestaltung des Modells, insbesondere die Verwendung des Feindstrafrechts als gebändigten Krieg gegen Terroristen, sowie die Frage der Verhältnismäßigkeit und Beschränkungen thematisiert.
- Kapitel B: In diesem Kapitel wird das Feindstrafrecht kritisch beleuchtet. Es wird zwischen der deskriptiven und der normativen Ebene des Begriffs unterschieden. Es werden sowohl befürwortende Stimmen auf beiden Ebenen, darunter ähnliche normative Modelle wie von Gerd Roellecke, Otto Depenheuer und Cornelius Prittwitz, als auch Argumente für die Richtigkeit der deskriptiven Ebene betrachtet. Schließlich werden Defizite auf beiden Ebenen des Feindstrafrechts aufgezeigt, insbesondere auf deskriptiver Ebene sowie auf normativer Ebene im Hinblick auf empirische und strafzwecktheoretische Erwägungen und den problematischen Feindbegriff. Der problematische Feindbegriff wird anhand der Abgrenzung zu Carl Schmitt, der unbestimmten Grenzen und des Verstoßes gegen das Prinzip der Menschenwürde diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Konzepte des Strafrechts wie Feindstrafrecht, Rechtsstaatlichkeit, Terrorismusbekämpfung, Verhältnismäßigkeit, Menschenwürde und Strafzweck. Es werden insbesondere die Theorien von Günther Jakobs sowie kritische Stimmen zu seinem Modell des Feindstrafrechts beleuchtet. Weitere relevante Begriffe sind deskriptive und normative Ebene, empirische und strafzwecktheoretische Erwägungen, sowie der Vergleich mit anderen Modellen wie dem Risikostrafrecht.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Günther Jakobs unter „Feindstrafrecht“?
Es bezeichnet ein Modell, das Personen, die die Rechtsordnung grundsätzlich ablehnen (wie Terroristen), nicht mehr als Bürger mit vollen Rechten, sondern als „Feinde“ behandelt, gegen die der Staat zur Gefahrenabwehr Krieg führt.
Wie grenzt Jakobs den „Feind“ vom „Bürger“ ab?
Ein Bürger ist eine Person, die Erwartungssicherheit bietet und das Recht achtet. Der Feind hingegen hat sich durch sein Verhalten dauerhaft aus der Rechtsgemeinschaft verabschiedet.
Welche Kritik wird am Feindstrafrecht geübt?
Kritiker bemängeln die grenzenlose Unbestimmtheit des Feindbegriffs, einen möglichen Verstoß gegen die Menschenwürde und die Abkehr von rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Ist das Feindstrafrecht ein deskriptives oder normatives Programm?
Die Arbeit untersucht, ob Jakobs nur den Ist-Zustand bestimmter Gesetze beschreibt (deskriptiv) oder ob er fordert, dass ein solches Recht existieren sollte (normativ).
Welche Rolle spielt die Terrorismusbekämpfung in diesem Modell?
Das Feindstrafrecht wird oft als Instrument zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen diskutiert, da das herkömmliche Strafrecht hier an seine Grenzen stoßen könnte.
- Citation du texte
- Alexander Lauer (Auteur), 2019, Das Modell des Feindstrafrechts als Überschreitung rechtlicher Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535732