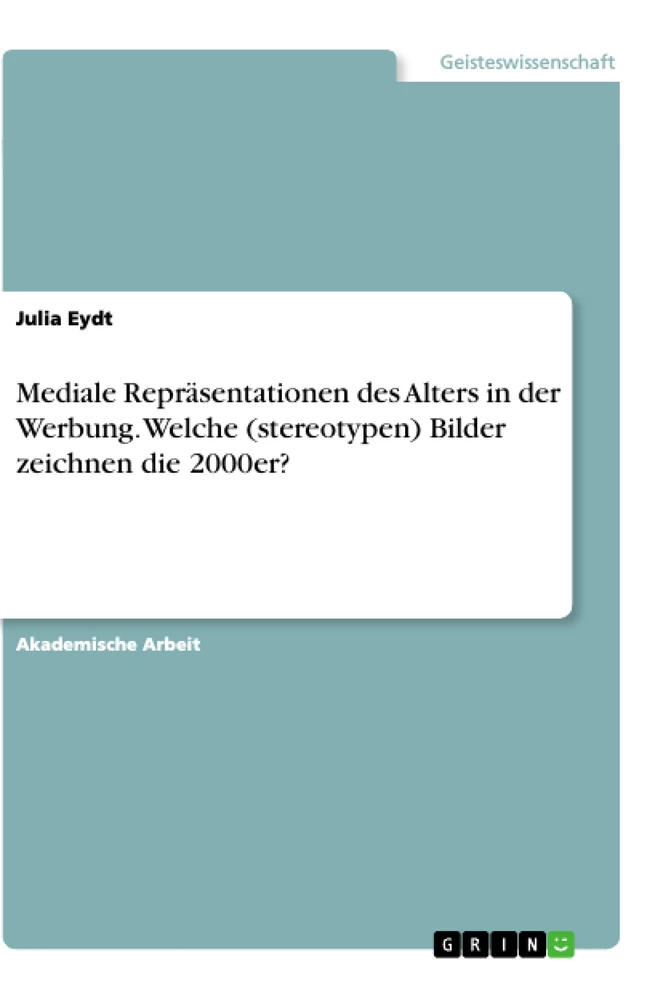Das Thema Alter ist nicht nur in Anbetracht sich verändernder gesellschaftlicher Umstände Gegenstand öffentlicher Debatten geworden, sondern treibt, neben den Printmedien, die sich vor allem als Streitorgan eines wachsenden Generationenkonfliktes hervorgetan haben, auch die Werbung an.
Diese nimmt das ältere Klientel seit den 1990er Jahren zunehmend als Zielgruppe war, die angesprochen werden möchte. Hierbei bedient sie sich unterschiedlicher Bilder und nicht allzu selten auch stereotyper Vorstellungen, wie das Alter und der Mensch im höheren Lebensalter zu sein haben.
Diese Stereotypen können von ganz unterschiedlicher Qualität sein, sich vermeintlich positiv oder negativ zeigen und den älteren Menschen in verschiedenen Rollen wahrnehmen.
Während bis in die 1990er Jahre hinein ältere Menschen als Protagonisten in der Werbung eher unterrepräsentiert und/ oder negativ visualisiert worden sind, ergab sich insbesondere seit den 2000ern ein grundlegender Wandel. Mit dem Aufkommen der Generation der „Best“ oder „Golden Agers“, der „Silver generation“ und der „Senior Models“ unterscheidet sich die jüngere kaum noch von der älteren Zielgruppe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was sind Stereotype und welche Funktionen übernehmen sie?
- 2.1 Was sind Altersstereotype?
- 3. Mediale Repräsentationsformen
- 3.1 Ältere Menschen als Werbeträger
- 3.1.1 Unterrepräsentation
- 3.1.2 Qualitätsträger für Vertrauensmarken
- 3.1.3 Positive Repräsentation
- 3.1.4 Alter als Kontrast
- 3.2 Ältere Protagonisten in altersspezifischer Werbung
- 3.1 Ältere Menschen als Werbeträger
- 4. Einflüsse und Auswirkungen medialer Altersstereotype
- 4.1 Sozialer Vergleich und Überforderung
- 4.2 Die Rolle der Werbemacher
- 5. Schlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mediale Darstellung des Alters in der Werbung der 2000er Jahre. Sie analysiert die Entwicklung von stereotypen Bildern und deren Wandel, insbesondere den zunehmenden Fokus auf positive Stereotypen. Die Arbeit fragt nach der Repräsentation aller Alterssegmente und der Rolle von Vertrauensmarken. Praktische Beispiele aus der Werbung veranschaulichen die gefundenen Tendenzen.
- Entwicklung stereotyper Altersrepräsentationen in der Werbung der 2000er Jahre
- Zunehmende Relevanz positiver Altersstereotype
- Repräsentation verschiedener Alterssegmente
- Rolle von Vertrauensmarken und deren Verwendung älterer Werbeträger
- Auswirkungen medialer Altersstereotype auf ältere Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die zunehmende Relevanz der Darstellung des Alters in der Werbung, besonders im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und des demografischen Wandels. Sie hebt den Wandel von unterrepräsentierten und negativen Darstellungen älterer Menschen hin zu einer zunehmenden positiven Stereotypisierung hervor, insbesondere seit den 2000er Jahren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklungen in den ausgehenden 2000ern und untersucht, ob alle Alterssegmente der Lebensphase "Alter" medial angemessen erfasst werden. Die Methode der Arbeit, die Analyse von Praxisbeispielen aus der Werbung, wird begründet.
2. Was sind Stereotype und welche Funktionen beinhalten sie?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Stereotyp" und seine Bedeutung im Kontext der menschlichen Wahrnehmung. Es erklärt, wie Stereotype als mentale Repräsentationen funktionieren und welche Orientierungsfunktion sie für Individuen haben. Der Fokus liegt auf der Zuweisung bestimmter Merkmale an Gruppen, beispielsweise "die Gruppe der Alten", und der damit verbundenen Vereinfachung und Ordnung von Wissen.
3. Mediale Repräsentationsformen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene mediale Repräsentationsformen des Alters in der Werbung. Es untersucht die Entwicklung der Rolle älterer Menschen als Werbeträger, von anfänglicher Unterrepräsentation bis hin zu positiven Darstellungen und ihrer Verwendung als Kontrast. Der Kapitel analysiert die Verwendung von älteren Protagonisten in altersspezifischer Werbung. Praktische Beispiele aus Werbefilmen verschiedener Marken veranschaulichen die verschiedenen Arten der Darstellung.
4. Einflüsse und Auswirkungen medialer Altersstereotype: Das Kapitel behandelt die Einflüsse und Auswirkungen der dargestellten Altersstereotype. Es untersucht die Rolle des sozialen Vergleichs und die potenzielle Überforderung, die aus der Konfrontation mit idealisierten Bildern resultieren kann. Weiterhin wird die Verantwortung der Werbemacher bei der Gestaltung von Altersbildern in den Medien beleuchtet.
Schlüsselwörter
Altersstereotype, Werbung, Mediale Repräsentation, 2000er Jahre, Positive Stereotypisierung, Vertrauensmarken, Altersspezifische Werbung, Sozialer Vergleich, Werbemacher.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Mediale Altersrepräsentation in der Werbung der 2000er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die mediale Darstellung von Alter in der Werbung der 2000er Jahre. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung von stereotypen Bildern älterer Menschen, insbesondere dem Wandel hin zu positiveren Stereotypen. Es wird untersucht, wie verschiedene Altersgruppen repräsentiert werden und welche Rolle Vertrauensmarken spielen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung stereotyper Altersrepräsentationen in der Werbung der 2000er Jahre, der zunehmenden Relevanz positiver Stereotype, der Repräsentation verschiedener Alterssegmente, der Rolle von Vertrauensmarken und deren Verwendung älterer Werbeträger sowie den Auswirkungen medialer Altersstereotype auf ältere Menschen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Altersdarstellung in der Werbung. Kapitel 2 definiert den Begriff "Stereotyp" und dessen Funktion. Kapitel 3 analysiert verschiedene mediale Repräsentationsformen des Alters in der Werbung, insbesondere die Rolle älterer Menschen als Werbeträger. Kapitel 4 behandelt die Einflüsse und Auswirkungen der dargestellten Altersstereotype, einschließlich des sozialen Vergleichs und der Verantwortung der Werbemacher. Kapitel 5 (Schlussreflexion) fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie werden ältere Menschen in der Werbung der 2000er Jahre dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Darstellung älterer Menschen in der Werbung, von anfänglicher Unterrepräsentation und negativen Stereotypen hin zu einer zunehmenden positiven Stereotypisierung. Es wird untersucht, wie ältere Menschen als Werbeträger eingesetzt werden (z.B. für Vertrauensmarken) und wie sie in altersspezifischer Werbung präsentiert werden. Die Arbeit nutzt Praxisbeispiele aus der Werbung zur Veranschaulichung.
Welche Rolle spielen Vertrauensmarken?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Vertrauensmarken und deren Verwendung älterer Werbeträger. Es wird analysiert, inwiefern ältere Menschen als Repräsentanten für Vertrauen und Glaubwürdigkeit eingesetzt werden und welche Auswirkungen dies hat.
Welche Auswirkungen haben mediale Altersstereotype?
Die Arbeit untersucht die potenziellen Auswirkungen medialer Altersstereotype, insbesondere den sozialen Vergleich und die mögliche Überforderung durch idealisierte Bilder. Die Verantwortung der Werbemacher bei der Gestaltung von Altersbildern in den Medien wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse von Praxisbeispielen aus der Werbung der 2000er Jahre, um die Entwicklung und den Wandel der medialen Altersrepräsentation zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Altersstereotype, Werbung, Mediale Repräsentation, 2000er Jahre, Positive Stereotypisierung, Vertrauensmarken, Altersspezifische Werbung, Sozialer Vergleich, Werbemacher.
- Arbeit zitieren
- Julia Eydt (Autor:in), 2018, Mediale Repräsentationen des Alters in der Werbung. Welche (stereotypen) Bilder zeichnen die 2000er?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535908