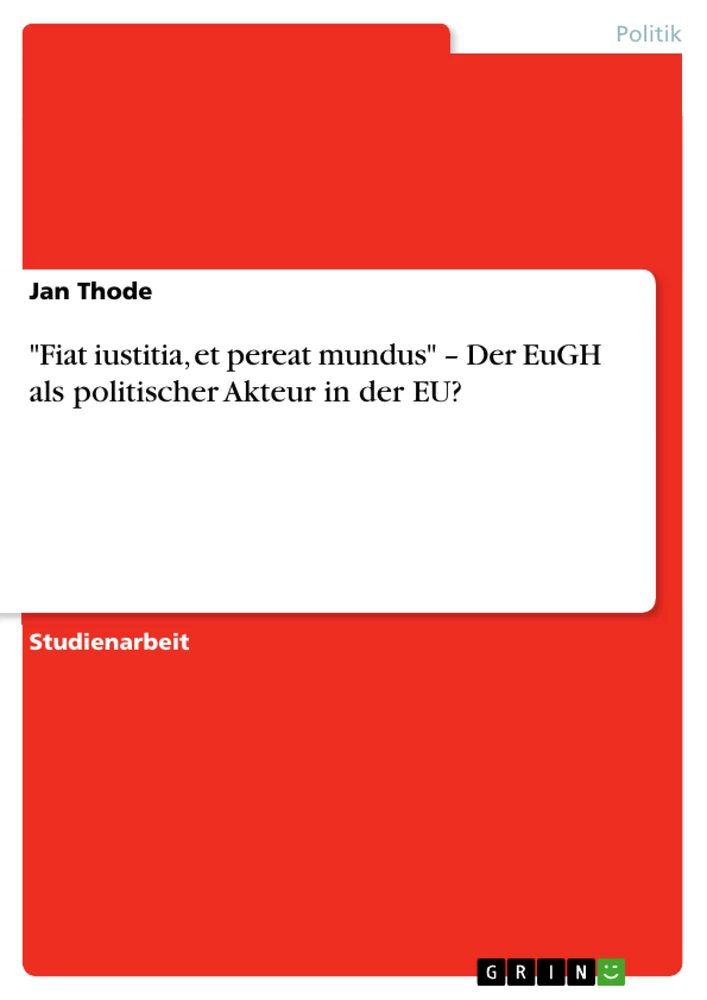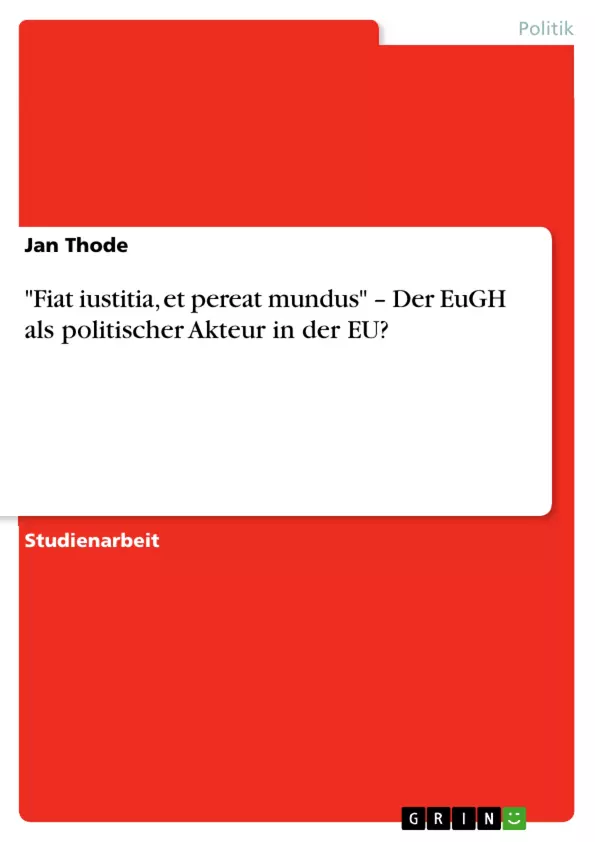„Fiat iustitia, et pereat mundus“. Dieses lateinische Zitat tauchte das erste Mal in den Zeiten Hadrians VI. auf, der gebeten wurde einen Mörder aus einer reichen römischen Familie zu verschonen. Er drückte mit diesem Zitat aus, dass selbst dann Gerechtigkeit geschehen solle, selbst wenn die Welt zugrunde geht. In dieser Arbeit wird die Frage aufgeworfen, ob der Europäische Gerichtshof mit der Aufnahme seiner Arbeit im Jahre 1954 sich zu einem Akteur im politischen System der Europäischen Union aufgebaut hat.
Den Begriff „Akteur“ definierte soziologisch Ferdinand Tönnies 1887 durch seine Willenstheorie. In dieser Schrift legte er da, dass das Handeln einer Person sich in einen kollektiven bzw., sozialen Kontext einbettet. Dies kann grundlegend definiert werden als einzelne Person (individueller Akteur) oder als Verbindung einzelner Akteure (überindividueller Akteur). Ein individueller Akteur ist der einzelne Mensch zu sehen, der durch sein Handeln einen Gemeinschaftssinn erfüllt oder seinen Selbstzweck darin sieht.
Individuelle Akteure sind in heutigen politischen Systemen nur noch selten anzutreffen. Ihr Handeln richtet sich meistens auf die kommunale Ebene aus, wo eine direkte Kommunikation zwischen Akteur und Wähler stattfindet. Als Beispiele gelten hier (Orts)Bürgermeister oder Stadt- oder Gemeinderatsmitglieder. Sobald das Handeln eines Akteurs einen größeren Rahmen bekommt, schließen sich mehrere Akteure zusammen und bilden damit einen überindividuellen Akteur.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Akteurszentrierter Institutionalismus
- 2.2 Integration durch Recht
- 3. Die EU
- 3.1 Geschichte der EU
- 3.2 Aufbau und Arbeitsweise der EU
- 3.3 Aufbau und Funktionsweise des EuGH
- 4. Verfahren und Urteile des EuGHs
- 4.1 Rs 26/62 Van Gend & Loos ./. Niederländische Finanzverwaltung
- 4.2 Rs 6/64 Flaminio Costa ./. E.N.E.L.
- 4.3 C-285/98 Kreil ./. Bundesrepublik Deutschland
- 4.4 C-163/17 Jawo ./. Bundesrepublik Deutschland
- 4.5 Einordnung aktueller Rechtsprechung im Kontext früherer Entscheidungen
- 4.6 Einschränkungen des EuGHs
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob der Europäische Gerichtshof (EuGH) seit seiner Gründung 1954 zu einem politischen Akteur im EU-System geworden ist. Sie definiert den Begriff des politischen Akteurs und beleuchtet den akteurszentrierten Institutionalismus im Vergleich zur Denkschule der „Integration durch Recht“. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung und Funktionsweise des EuGH anhand ausgewählter wegweisender Urteile.
- Der EuGH als politischer Akteur
- Akteurszentrierter Institutionalismus vs. Integration durch Recht
- Entwicklung und Funktionsweise des EuGH
- Einfluss bedeutender Urteile auf die EU
- Einschränkungen der Macht des EuGH
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt das lateinische Zitat „Fiat iustitia, et pereat mundus“ ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle des EuGH als politischer Akteur in der EU. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Definition des politischen Akteurs, den akteurszentrierten Institutionalismus und die „Integration durch Recht“ umfasst. Die Arbeit kündigt eine Analyse der Geschichte und Funktionsweise des EuGH sowie ausgewählter wegweisender Urteile an.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beginnt mit einer soziologischen Definition des Begriffs „Akteur“ nach Ferdinand Tönnies, differenziert zwischen individuellen und überindividuellen Akteuren und führt den akteurszentrierten Institutionalismus nach Mayntz und Scharpf ein. Im Kontrast dazu wird die Denkschule der „Integration durch Recht“ erläutert, die die Entwicklung der europäischen Integration durch Rechtssetzung und die Rolle des EuGH betont. Das Kapitel liefert somit das analytische Rüstzeug für die spätere Untersuchung des EuGH.
Schlüsselwörter
Europäischer Gerichtshof (EuGH), Politischer Akteur, Akteurszentrierter Institutionalismus, Integration durch Recht, EU-Recht, Rechtsprechung, Grundsatzentscheidungen, Supranationale Integration, Van Gend & Loos, Costa/ENEL, Kreil, Jawo.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Rolle des EuGH als politischer Akteur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob der Europäische Gerichtshof (EuGH) seit seiner Gründung 1954 zu einem politischen Akteur im EU-System geworden ist. Sie analysiert die historische Entwicklung und Funktionsweise des EuGH anhand ausgewählter wegweisender Urteile und betrachtet dabei verschiedene theoretische Perspektiven.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit vergleicht den akteurszentrierten Institutionalismus mit der Denkschule der „Integration durch Recht“, um die Rolle des EuGH zu analysieren. Der akteurszentrierte Institutionalismus betrachtet den EuGH als eigenständigen Akteur, während die „Integration durch Recht“ die Entwicklung der europäischen Integration primär durch Rechtssetzung und die Rolle des EuGH darin betont.
Welche Urteile werden analysiert?
Die Arbeit analysiert mehrere wegweisende Urteile des EuGH, darunter Rs 26/62 Van Gend & Loos ./. Niederländische Finanzverwaltung, Rs 6/64 Flaminio Costa ./. E.N.E.L., C-285/98 Kreil ./. Bundesrepublik Deutschland und C-163/17 Jawo ./. Bundesrepublik Deutschland. Die Analyse ordnet diese Urteile in den Kontext früherer Entscheidungen ein und beleuchtet deren Einfluss auf die EU.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (inkl. Akteurszentrierter Institutionalismus und Integration durch Recht), Die EU (Geschichte, Aufbau und Funktionsweise des EuGH), Verfahren und Urteile des EuGHs (inkl. Analyse der oben genannten Fälle und Einschränkungen des EuGH) und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Europäischer Gerichtshof (EuGH), Politischer Akteur, Akteurszentrierter Institutionalismus, Integration durch Recht, EU-Recht, Rechtsprechung, Grundsatzentscheidungen, Supranationale Integration, Van Gend & Loos, Costa/ENEL, Kreil, Jawo.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob der EuGH als politischer Akteur innerhalb des EU-Systems zu betrachten ist.
Welche Definition des „politischen Akteurs“ wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine soziologische Definition des Begriffs „Akteur“ nach Ferdinand Tönnies, die zwischen individuellen und überindividuellen Akteuren differenziert. Diese Definition bildet die Grundlage für die Analyse der Rolle des EuGH.
Welche Einschränkungen der Macht des EuGH werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht und beschreibt die Grenzen der Macht des EuGH im Kontext der europäischen Integration.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Bereich der europäischen Integration und der Rolle des EuGH.
- Quote paper
- Jan Thode (Author), 2019, "Fiat iustitia, et pereat mundus" – Der EuGH als politischer Akteur in der EU?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535952