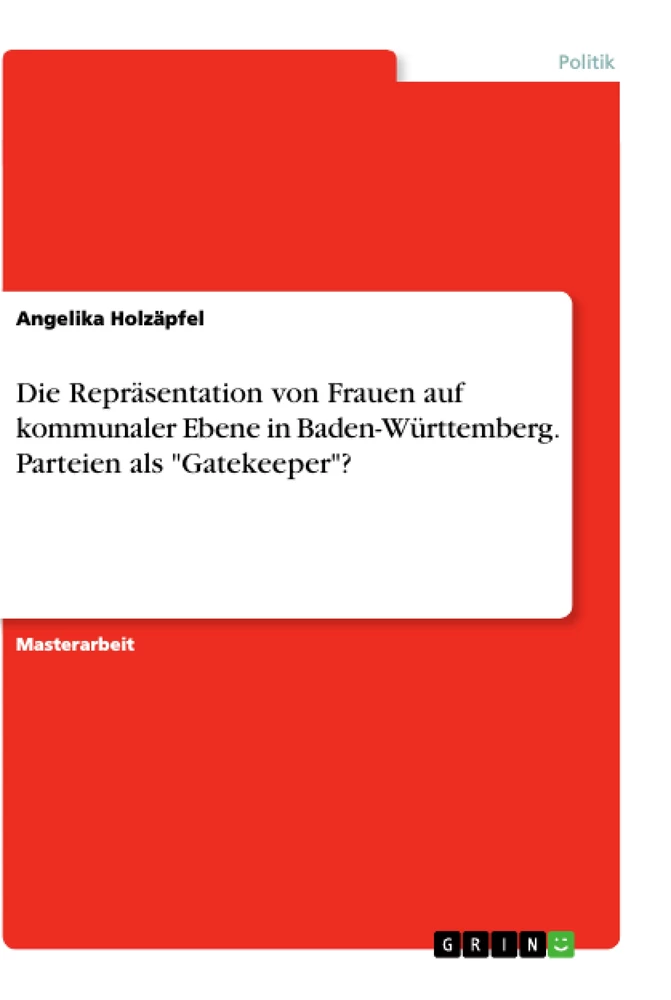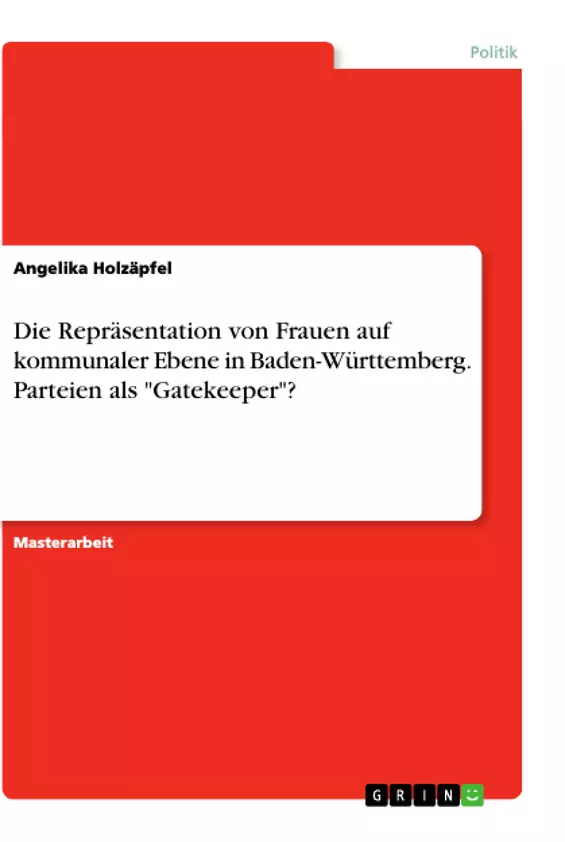Allem gesellschaftlichen Wandel zum Trotz tritt die parlamentarische Repräsentanz von Frauen in Deutschland auf der Stelle. Auf der Suche nach möglichen Gründen werden die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 in sechs kommunalen Gebietskörperschaften in Baden-Württemberg analysiert. Das Analysemodell basiert auf dem von Holtkamp et al. entwickelten Marktmodell, wonach drei Akteure die Repräsentation von Frauen in den Parlamenten maßgeblich beeinflussen: Kandidatinnenpool, Parteien und Wählermarkt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle der Parteien als Gatekeeper.
Das gewählte Analysemodell bietet den Vorteil, dass es den Dualismus von handlungsorientierten und institutionalistischen Ansätzen aufhebt und miteinander verzahnt. Die in verschiedenen Studien unter den Begriffen Sozialisations-, Abkömmlichkeits-, Sozialstruktur-, Diskriminierungs-, Quotenthese und Wählerverhalten herausgearbeiteten Erklärungsvariablen für die Unterrepräsentanz von Frauen, werden den drei oben genannten Adressaten zugeordnet.
Die Mandatsverteilung stellt sich in diesem Modell als Ergebnis eines Marktprozesses mit zwei Selektionsstufen dar. Eine zentrale Rolle spielen hierbei die Parteien bzw. Wählervereinigungen, die zum einen in parteiinternen Nominierungsprozessen Personen aus dem Kandidatenpool auswählen, und zum anderen diese zu einem Angebot für den Wählermarkt auf ihren Listen bündeln. Eine besondere Berücksichtigung erfahren in dieser Untersuchung auch die kommunalen Spezifika.
Die Untersuchung zeigt unter anderem, dass der Einfluss der Parteien zwar groß ist, durch das Wahlsystem in Baden-Württemberg aber auch eine deutliche Einschränkung erfährt, da hier die Rolle des Wählermarkts durch die Möglichkeit des Kummulierens und Panaschierens gestärkt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Analyserahmen
- 2.1 Forschungsstand zur kommunalen Frauenrepräsentanz
- 2.2 Erklärungsmodell für kommunale Frauenrepräsentanz auf Grundlage des akteurzentrierten Institutionalismus
- 2.2.1 Der akteurzentrierte Institutionalismus
- 2.2.2 Das Erklärungsmodell für kommunale Frauenrepräsentanz
- 2.3 Angewandte Untersuchungsmethode, Aufbau und Zielsetzung
- 3. Frauenunterrepräsentanz in den sechs kommunalen Untersuchungseinheiten
- 3.1 Sitzanteile und Frauenanteile
- 3.1.1 Gemeinderäte der Großstädte
- 3.1.2 Kreistage
- 3.2 Listenaufstellungen der Quoten- und Quorumsparteien für die Kommunalwahl 2014
- 3.2.1 Listenaufstellung der Grünen
- 3.2.2 Listenaufstellung der Linken
- 3.2.3 Listenaufstellung der SPD
- 3.2.4 Listenaufstellung der CDU
- 3.3 Betrachtung des Wählermarkts
- 3.3.1 Verhalten des Wählermarkts in den Großstädten
- 3.3.2 Verhalten des Wählermarkts in den Landkreisen
- 3.3.3 Das Verhalten des Wählermarkts und die Größe der Listenwahlkreise
- 3.4 Kandidatenpool: Auswahl der Kandidatinnen –Untersuchung auf Grundlage von Interviews
- 3.4.1 Sozialisationsthese
- 3.4.2 Abkömmlichkeitsthese
- 3.4.3 Sozialstrukturthese
- 4. Diskussion der Ergebnisse
- 4.1 Rückbezug auf die Hypothesen und die Forschungsfrage
- Hypothese H1
- Hypothese H2
- Hypothese H3
- Hypothese H4
- 4.2 Überlegungen zum Erklärungsmodell für kommunale Frauenrepräsentanz
- 4.2.1 Der Akteur Partei
- 4.2.2 Der Akteur Kandidatenpool
- 4.2.3 Der Akteur Wählermarkt
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Unterrepräsentanz von Frauen in kommunalen Gremien in Baden-Württemberg. Das Ziel ist es, die Rolle der Parteien als „Gatekeeper“ bei der Auswahl von Kandidatinnen und der Repräsentation von Frauen auf kommunaler Ebene zu analysieren.
- Analyse der Sitzanteile von Frauen in Gemeinderäten und Kreistagen in Baden-Württemberg
- Untersuchung der Listenaufstellungen von Parteien bei der Kommunalwahl 2014
- Betrachtung des Wählerverhaltens und seiner Auswirkungen auf die Repräsentanz von Frauen
- Analyse der Auswahlkriterien von Kandidatinnen durch Parteien
- Entwicklung eines Erklärungsmodells für die kommunale Frauenrepräsentanz unter Einbezug des akteurzentrierten Institutionalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand vor und erläutert die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 behandelt den theoretischen Analyserahmen. Hierbei wird der Forschungsstand zur kommunalen Frauenrepräsentanz zusammengefasst und ein Erklärungsmodell für die kommunale Frauenrepräsentanz auf Grundlage des akteurzentrierten Institutionalismus entwickelt. Kapitel 3 widmet sich der deskriptiven Analyse der Frauenunterrepräsentanz in sechs kommunalen Untersuchungseinheiten. Es werden die Sitzanteile von Frauen in Gemeinderäten und Kreistagen, die Listenaufstellungen der Parteien bei der Kommunalwahl 2014 und das Verhalten des Wählermarktes analysiert. Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Rolle der Parteien als „Gatekeeper“. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen.
Schlüsselwörter
Kommunale Frauenrepräsentanz, Parteien, „Gatekeeper“, akteurzentrierter Institutionalismus, Kommunalwahl 2014, Baden-Württemberg, Wählerverhalten, Kandidatenpool, Geschlechterungleichheit.
- Citar trabajo
- Angelika Holzäpfel (Autor), 2019, Die Repräsentation von Frauen auf kommunaler Ebene in Baden-Württemberg. Parteien als "Gatekeeper"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536257