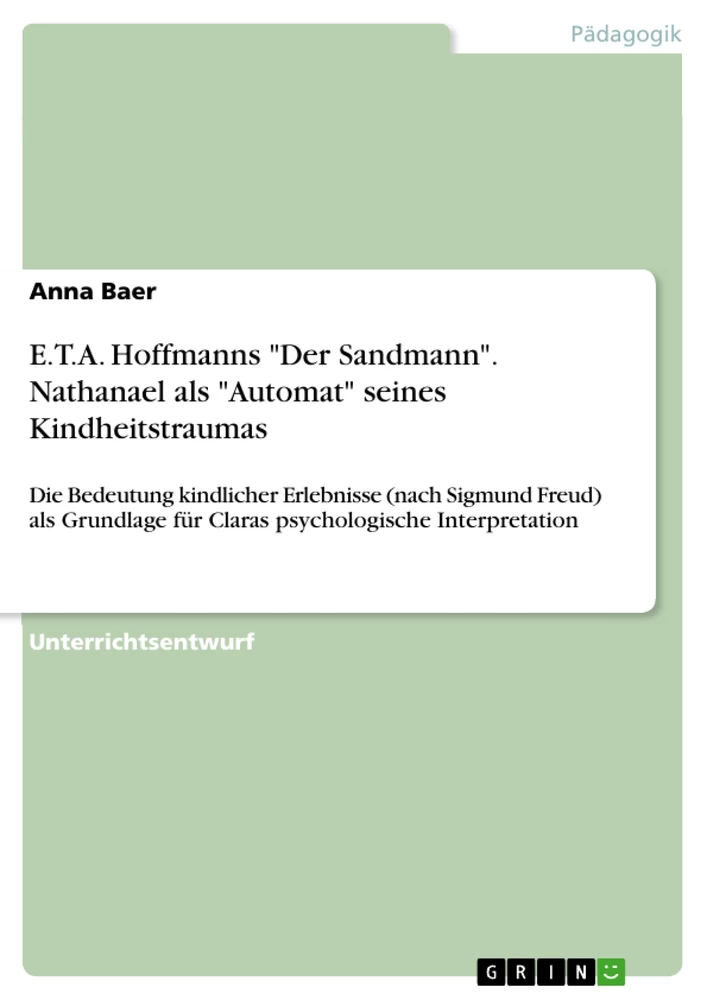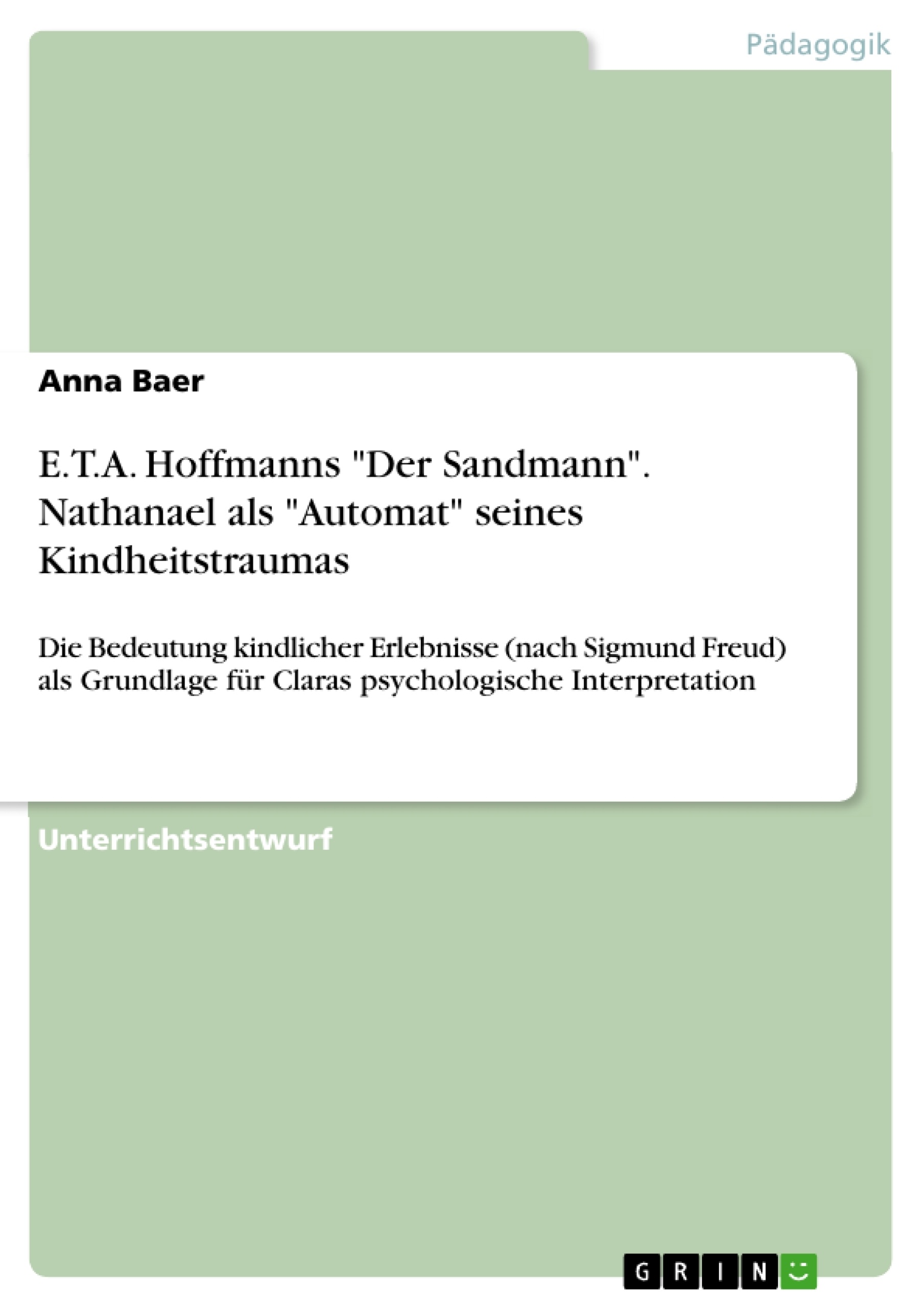Die Stunde wurde im Rahmen des Examens für einen Deutsch LK (Q1) geplant. Das Lernziel der Stunde ist, dass Schülerinnen und Schüler die psychologische Interpretation Claras, die Nathanaels Probleme durch das Einwirken innerer Mächte, die durch das Kindheitstrauma entstanden sind, begründet sieht, erklären, indem sie die psychologische Theorie Freuds zur Bedeutung kindlicher Erlebnisse am Erzähltext überprüfen.
Das Unterrichtsvorhaben "Im Labyrinth der unterschiedlichen Lesarten – Die Multiperspektivität und Bedeutungsvielfalt in E. T. A. Hoffmanns "Der Sandmann" " greift einen obligatorischen Gegenstand des Faches Deutsch für den Leistungskurs im Zentralabitur 2021 auf und lässt sich dem Inhaltsfeld Texte, genauer dem Feld "Strukturell unterschiedliche Erzähltexte aus unterschiedlichen historischen Kontexten", zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Tabellarische Auflistung der Stundenthemen
- Curriculare Legitimation
- Erläuterung der Intentionen und der Struktur des Vorhabens
- Überprüfung des Lern- und Kompetenzzuwachses
- Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
- Stundenziel und Teillernziele
- Beitrag der Stunde zum intendierten Kompetenzzuwachs
- Darstellung der didaktisch-methodischen Schwerpunkte der Stunde
- Verlaufsplan
- Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Arbeit befasst sich mit der Analyse von E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ und legt den Fokus auf die psychologische Interpretation von Nathanaels Kindheitstrauma durch Clara, basierend auf der Theorie Sigmund Freuds. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie kindliche Erlebnisse die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen beeinflussen können.
- Die Bedeutung von Kindheitserfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung
- Die multiperspektivische Analyse von „Der Sandmann“
- Die Rolle von Fantasie und Realität in der Erzählung
- Die Auseinandersetzung mit dem Motiv des Automatenmenschen
- Die Relevanz der Erzähltechnik für die Interpretation der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge - Dieses Kapitel stellt den Kontext der Unterrichtsstunde dar und erläutert die Bedeutung des gewählten Themas für die Entwicklung der Schüler*innen. Es wird die curriculare Legitimation der Unterrichtsreihe sowie die didaktische Intention erläutert.
- Kapitel 2: Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde - Dieses Kapitel beinhaltet die detaillierte Planung der Unterrichtsstunde, einschließlich des Stundenziels, der Teillernziele, der didaktisch-methodischen Schwerpunkte und des Verlaufsplans.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Schlüsselthemen wie E.T.A. Hoffmann, „Der Sandmann“, Kindheitstrauma, Sigmund Freud, psychologische Interpretation, multiperspektivische Analyse, Fantasie und Realität, Automatenmenschen, Erzähltechnik.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Fokus setzt die psychologische Interpretation von „Der Sandmann“?
Der Fokus liegt auf Nathanaels Kindheitstrauma. Basierend auf Freuds Theorien wird untersucht, wie verdrängte Kindheitserlebnisse als „innere Mächte“ das Verhalten und die Realitätswahrnehmung des Protagonisten steuern.
Wie interpretiert Clara Nathanaels Probleme?
Clara vertritt eine rationale, psychologische Sichtweise. Sie sieht Nathanaels Ängste nicht als reales Wirken dunkler Mächte, sondern als Projektionen seiner eigenen traumatisierten Psyche.
Was bedeutet das Motiv des „Automatenmenschen“ in der Erzählung?
Das Motiv (verkörpert durch Olimpia) steht für die Grenze zwischen Mensch und Maschine sowie für Nathanaels Unfähigkeit, zwischen lebendiger Realität und lebloser Projektion zu unterscheiden.
Welche Rolle spielt die Multiperspektivität in E.T.A. Hoffmanns Werk?
Durch verschiedene Erzählformen (Briefe, Berichte) werden unterschiedliche Lesarten angeboten, die den Leser zwischen einer fantastischen und einer psychologisch-realistischen Deutung schwanken lassen.
Ist das Unterrichtsvorhaben für das Zentralabitur relevant?
Ja, die Analyse von strukturell unterschiedlichen Erzähltexten wie „Der Sandmann“ ist ein obligatorischer Gegenstand für den Deutsch-Leistungskurs (Q1) im Zentralabitur.
- Quote paper
- Anna Baer (Author), 2020, E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann". Nathanael als "Automat" seines Kindheitstraumas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536778