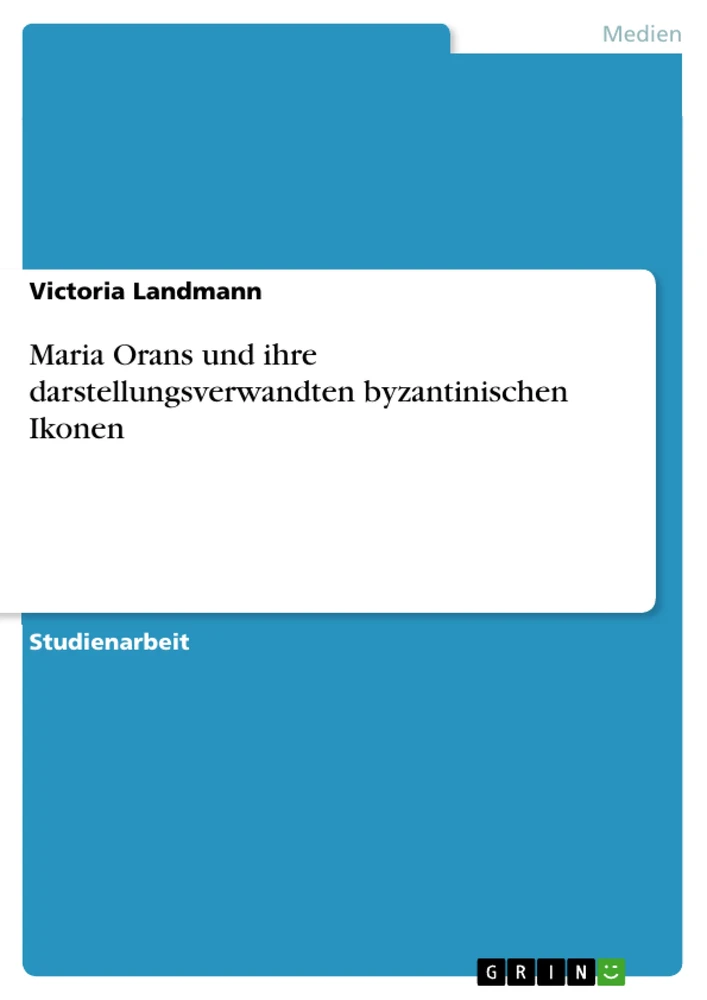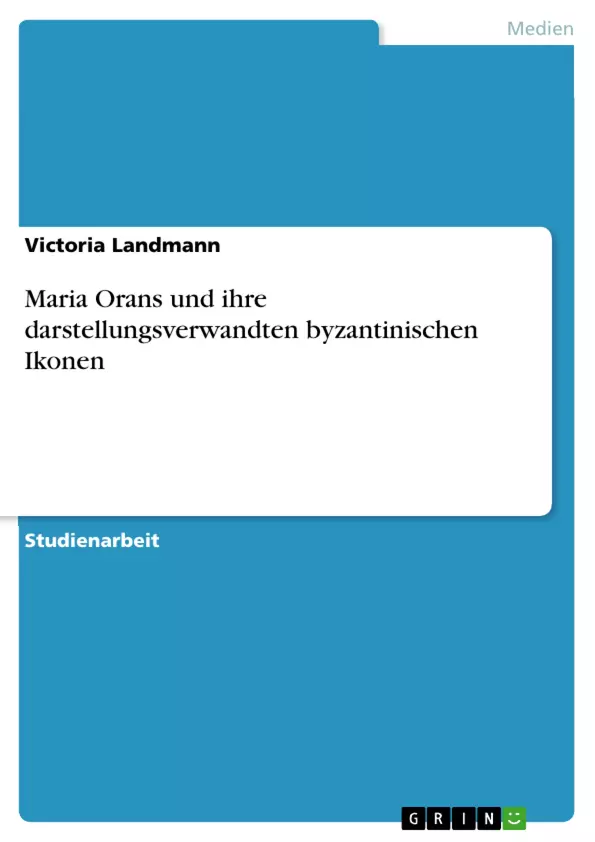In der folgenden Arbeit soll der Grundtypus der Maria Orans erläutert, sowie Parallelen zu darstellungsverwandten byzantinischen Ikonen, der Maria Platytera und Blachernitissa aufgezeigt werden.
Darüber hinaus werden Besonderheiten in Namensgebung und Darstellung der Ikonen herausgearbeitet. Da die Namensgebung byzantinischer Marienikonen eine besondere Stellung beim Verständnis der Ikonen einnimmt, wird diese erklärt, bevor dann die Ikonen der Maria Orans, der Platytera und der Blachernitissa, auch anhand von treffenden Beispielen, gedeutet werden
Schon Augustinus von Hippo schreibt in seinem Werk "De Trinitate VIII", dass kein einheitliches Bild der Mutter Gottes existiert. Von den verbliebenen Zeugen aus früh-, mittel- und spätbyzantinischer Zeit sind nur wenige Mariendarstellungen aus der Mosaik-, der Email-, sowie der Relief- und Elfenbeinkunst bekannt. Die derzeit noch existierenden, unterschiedlichen Darstellungsformen, sowie die uneinheitliche Namensgebung der byzantinischen Marienikonen evozieren die Frage nach den bestehenden Grundtypen und deren Weiterentwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Namensbestandteile byzantinischer Marienikonen
- Darstellungsverwandte Ikonen
- Maria Orans
- Maria Platytera
- Maria Blachernitissa
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der Maria Orans und ihrer darstellungsverwandten byzantinischen Ikonen. Sie untersucht die Entwicklung des Grundtypus der Maria Orans und beleuchtet die Parallelen zu Maria Platytera und Blachernitissa. Dabei werden die Besonderheiten in Namengebung und Darstellung der Ikonen herausgearbeitet. Insbesondere die Namensgebung byzantinischer Marienikonen spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der Ikonen und wird daher im Detail erklärt.
- Entwicklung des Grundtypus der Maria Orans
- Parallelen zu Maria Platytera und Blachernitissa
- Besonderheiten in Namengebung und Darstellung der Ikonen
- Die Bedeutung der Namensgebung byzantinischer Marienikonen
- Beispiele für die Darstellung der Ikonen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der unterschiedlichen Darstellungsformen und Namensgebungen byzantinischer Marienikonen dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie erläutert die Wichtigkeit der Analyse des Grundtypus der Maria Orans und seiner Verwandtschaft zu anderen Marienikonen.
Namensbestandteile byzantinischer Marienikonen
Dieses Kapitel beleuchtet die Namensgebung von Marienikonen seit der mittelbyzantinischen Zeit. Es erklärt die Bedeutung der Initialen MP OY und geht auf verschiedene Beinamen ein, die sich aus der Haltung Mariens, ihren Ehrentiteln oder Toponymen ableiten.
Darstellungsverwandte Ikonen
Maria Orans
Dieser Abschnitt widmet sich der Maria Orans und ihrer Entwicklung. Er erläutert die Entstehung der Ikone in der frühbyzantinischen Zeit und ihre Verbindung zur „Orans“, der altchristlichen Grabeskunst. Außerdem werden die verschiedenen Medien erwähnt, auf denen die Maria Orans dargestellt wurde, sowie ein frühes Beispiel aus dem 6. Jahrhundert aus Arles.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert den Ikonentypus der Maria Orans?
Die Maria Orans wird in einer betenden Haltung mit erhobenen Händen dargestellt, eine Form, die ihre Wurzeln in der altchristlichen Grabeskunst hat.
Was ist der Unterschied zwischen Maria Orans und Maria Platytera?
Während die Orans die betende Haltung betont, zeigt die Platytera („die Weiter-als-der-Himmel“) oft das Christuskind in einem Medaillon vor der Brust Mariens.
Welche Bedeutung hat die Namensgebung byzantinischer Ikonen?
Die Namen leiten sich oft von Ehrentiteln, der spezifischen Körperhaltung oder den Orten ihrer Verehrung (Toponyme) ab und sind entscheidend für das theologische Verständnis.
Was verbirgt sich hinter den Initialen MP OY?
Diese griechischen Initialen stehen für „Meter Theou“ und bedeuten „Mutter Gottes“, die Standardbezeichnung auf byzantinischen Marienikonen.
Was ist die Maria Blachernitissa?
Dieser Typus bezieht sich auf eine berühmte Ikone aus dem Blachernen-Kloster in Konstantinopel und ist eng mit dem Schutz der Stadt verbunden.
- Citation du texte
- Victoria Landmann (Auteur), 2014, Maria Orans und ihre darstellungsverwandten byzantinischen Ikonen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538659