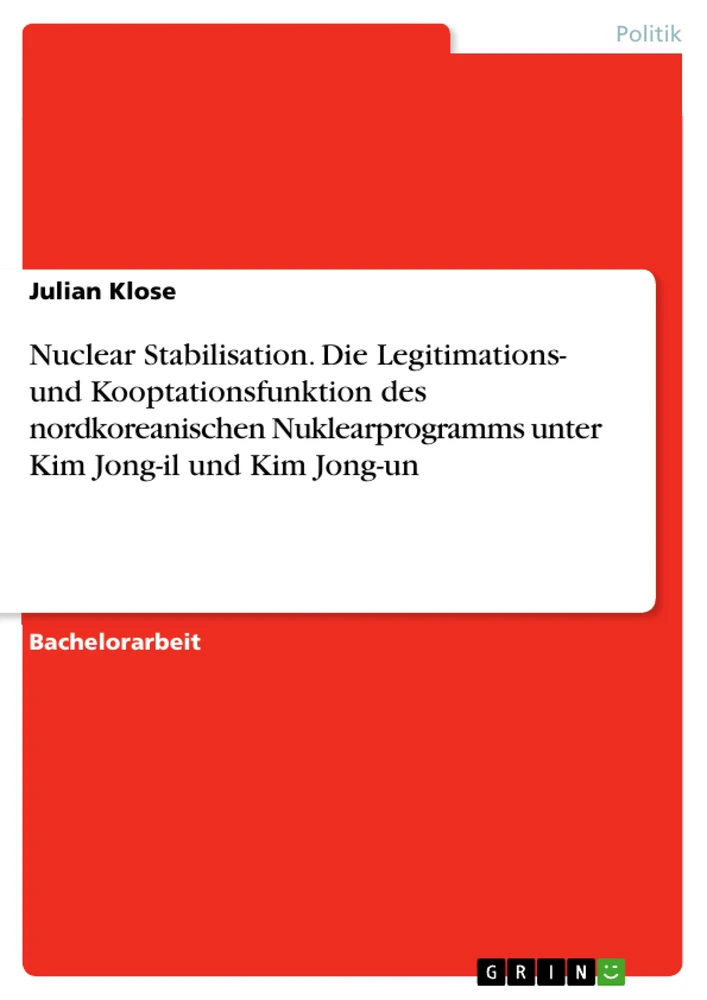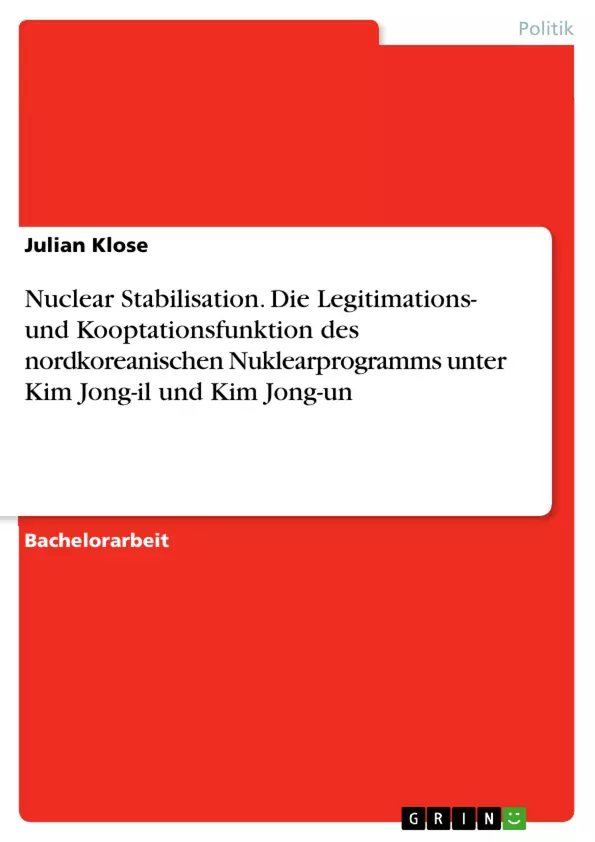Trotz seiner geographischen Abgelegenheit steht Nordkorea seit den 1990ern fest im Zentrum weltpolitischer Auseinandersetzungen. Erstens gehört Nordkorea zu den repressivsten Staaten der Welt. Zweitens ist es dem Land gelungen, sämtlichen Krisen und Sanktionen zum Trotz, ein eigenes Nuklearprogramm zu entwickeln. Seit Jahren werden die Hintergründe der nordkoreanischen Regimestabilität debattiert.
Eine wichtige Frage in der Nordkorea-Forschung ist daher die der Verbindung zwischen der Performanz des Landes und dem Nuklearprogramm. Im Kern geht es dabei um die Frage, was die Motivation hinter der nuklearen Aufrüstung Nordkoreas sein könnte. Ausgangspunkt der Forschung ist dabei eine im Detail unterschiedlich begründete Sicherheitsfunktion des Nuklearprogramms. Wenn es dem Kim-Regime letztendlich um das Überleben geht, dann bleibt unklar, welchen Beitrag ein Nuklearprogramm dazu leistet. Von außen betrachtet hängen die Sanktionen und die militärischen Drohungen der USA gegen Nordkorea gerade mit diesem Verhalten zusammen. Es erscheint daher vielversprechend, die Ursachen im politischen System Nordkoreas zu suchen. In Abgrenzung zur innerstaatlichen Forschung in den Internationalen Beziehungen soll nicht primär das außenpolitische Verhalten erklärt werden. Es soll stattdessen untersucht werden, wie das Nuklearprogramm beim Streben nach „regime survival“ hilft. Weiter soll mit der institutionellen Ausgestaltung des Programms ein soweit ersichtlich vernachlässigter Aspekt der politikwissenschaftlichen Forschung untersucht werden. Mit Hilfe des Drei-Säulen-Modells autokratischer Regimestabilität (Gerschewski 2013) wird daher untersucht, welchen Beitrag das nordkoreanische Nuklearprogramm zur Regimestabilität leistet. Konkret wird argumentiert, dass das Regime auf Grund seines Typs mit dem Programm versucht, sich zu legitimieren und Eliten zu kooptieren. Dies geschieht über die Bereitstellung von Gütern an die Bevölkerung und strategisch wichtige Akteure sowie die Einbindung in formelle und informelle Netzwerke. Nach der Vorstellung des Forschungsdesigns werden im dritten Kapitel die Grundlagen der nordkoreanischen Legitimation und Kooptation von Eliten dargelegt. Im vierten Kapitel wird gezeigt wie das Regime u.a. mithilfe des Nuklearprogramms Regimestabilität herbeiführt und warum vermeintliche Denuklearisierung in der Vergangenheit auch der Regimestabilität diente. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsdesign
- 2.1 Methodik der Kongruenzanalyse
- 2.2 Das Drei-Säulen-Modell nach Gerschewski (2013)
- 2.2.1 Legitimation
- 2.2.2 Kooptation
- 2.3 Legitimations- und Kooptationsfunktion
- 2.3.1 Konzeptualisierung Legitimationsfunktion
- 2.3.2 Konzeptualisierung Kooptationsfunktion
- 2.4 Datenerhebung und -analyse
- 2.4.1 Datenerhebung
- 2.4.2 Datenanalyse
- 2.5 Fallauswahl
- 3 Legitimation und Kooptation in Nordkorea
- 3.1 Legitimation
- 3.2 Kooptation
- 4 Empirische Analyse
- 4.1 Das Nuklearprogramm
- 4.2 Legitimations- und Kooptationsfunktion des Programms
- 4.2.1 Legitimationsfunktion
- 4.2.2 Kooptationsfunktion
- 5 Fazit
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Legitimations- und Kooptationsfunktion des nordkoreanischen Nuklearprogramms unter Kim Jong-il und Kim Jong-un. Ziel ist es, den Beitrag des Programms zur Regimestabilität zu analysieren und die zugrundeliegende Motivation Nordkoreas zu erklären. Dazu wird das Drei-Säulen-Modell autokratischer Regimestabilität von Gerschewski (2013) angewendet.
- Die Funktion des Nuklearprogramms für die Regimestabilität Nordkoreas
- Die Legitimationsstrategien des Regimes im Zusammenhang mit dem Nuklearprogramm
- Die Kooptationsmechanismen, die das Regime zur Stabilisierung seiner Macht einsetzt
- Die Rolle von Institutionen in der Stabilisation von autokratischen Regimen
- Der Beitrag der Arbeit zur politikwissenschaftlichen Debatte über Nordkorea und seine Nuklearpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Forschungsfeld und die zentrale Fragestellung der Arbeit vor, welche die Verbindung zwischen dem nordkoreanischen Nuklearprogramm und der Regimestabilität untersucht. Anschließend wird das Forschungsdesign vorgestellt, welches auf der Methodik der Kongruenzanalyse basiert. Es werden die theoretischen Grundlagen des Drei-Säulen-Modells erläutert, mit dem die Legitimations- und Kooptationsfunktion des Programms analysiert wird.
Kapitel 3 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Legitimation und Kooptation in Nordkorea. Es werden die zentralen Mechanismen untersucht, die das Regime zur Sicherung seiner Macht einsetzt. Kapitel 4 analysiert empirisch die Legitimations- und Kooptationsfunktion des Nuklearprogramms unter Kim Jong-il und Kim Jong-un. Es werden konkrete Beispiele aus der nordkoreanischen Politik und Gesellschaft aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Nordkorea, Nuklearprogramm, Legitimation, Kooptation, Regimestabilität, Drei-Säulen-Modell, Kongruenzanalyse, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Autokratisches Regime, Institutionelle Ausgestaltung
- Quote paper
- Julian Klose (Author), 2019, Nuclear Stabilisation. Die Legitimations- und Kooptationsfunktion des nordkoreanischen Nuklearprogramms unter Kim Jong-il und Kim Jong-un, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539321