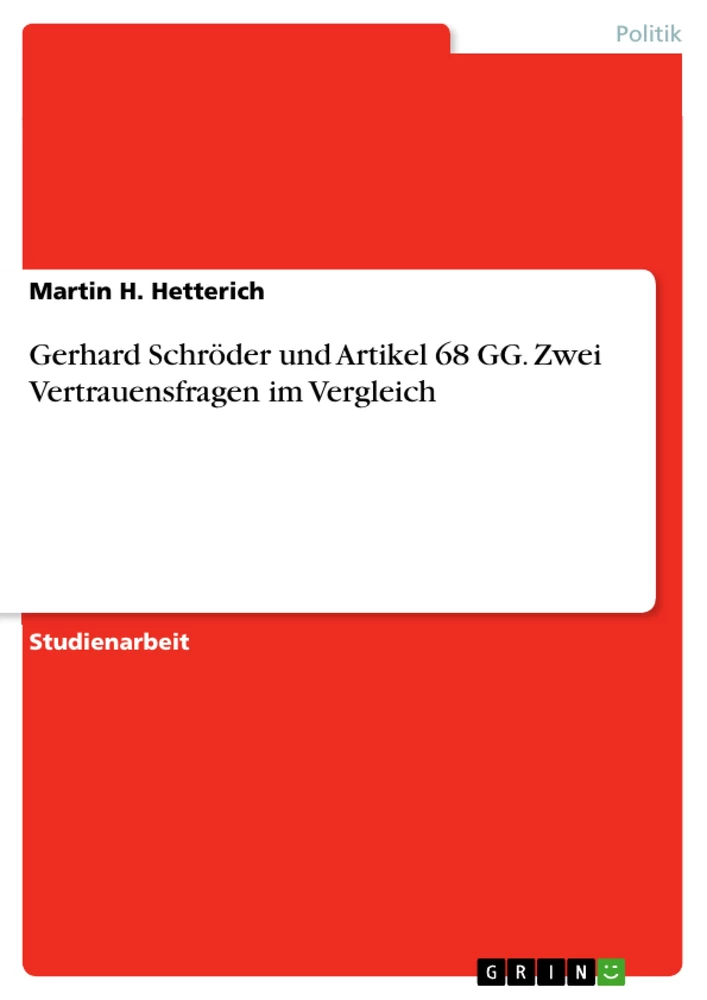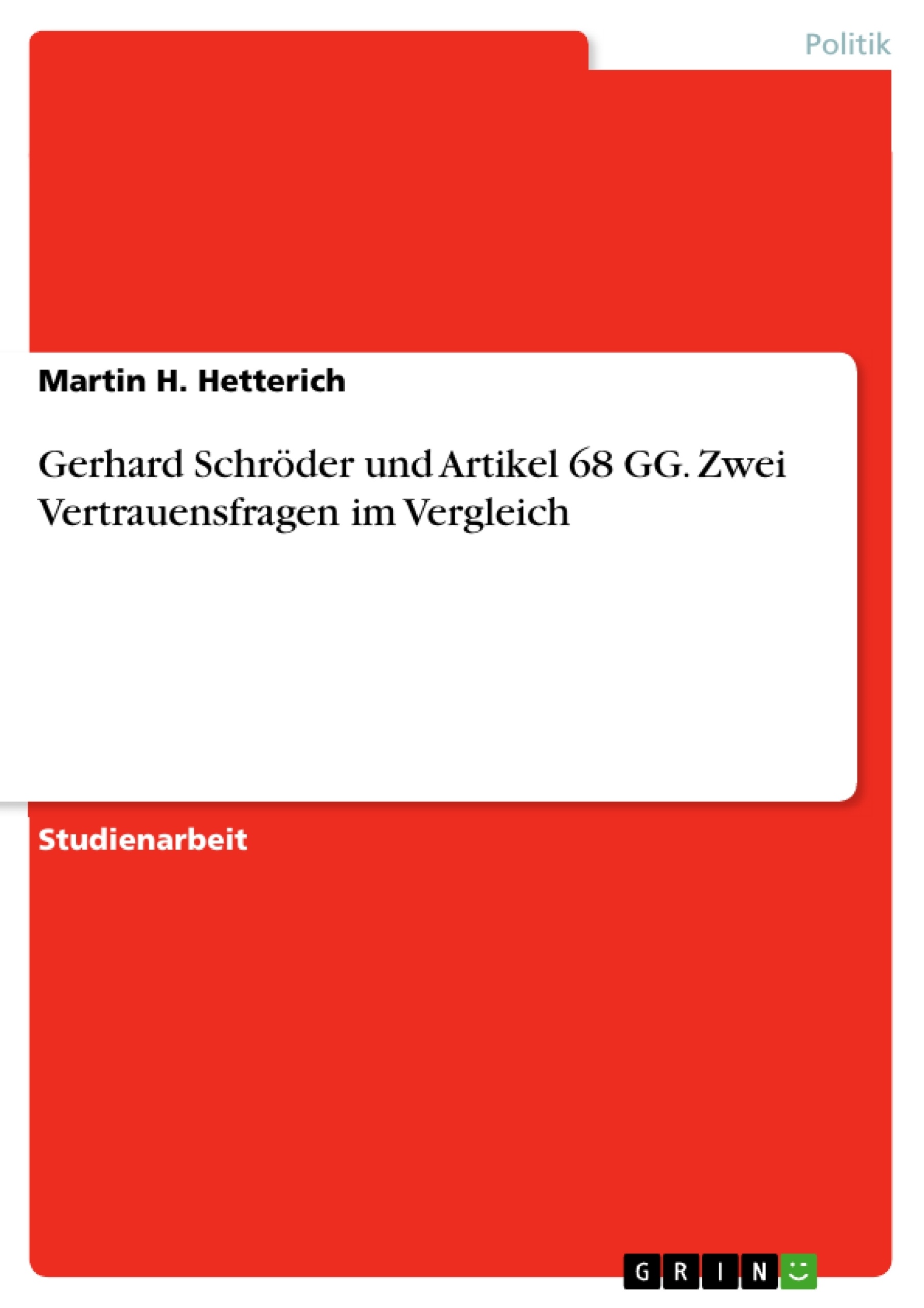„Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen.“
Vier verschiedene Bundeskanzler machten in drei verschiedenen Jahrzehnten, mit unterschiedlichen Ausgangslagen, unterschiedlichen Absichten und ebenso unterschiedlichen Ergebnissen von Artikel 68 des Grundgesetzes Gebrauch, wonach der Bundeskanzler bei ausdrücklich bekundetem fehlendem Rückhalt im Parlament zusammen mit dem Bundespräsidenten Neuwahlen einleiten kann. Willy Brandt stellte im September 1972 die Vertrauensfrage, um nach dem Verlust der Mehrheit im Parlament Neuwahlen einzuleiten. Das Vertrauen wurde ihm nicht ausgesprochen, und Brandt konnte nach der anschließenden Bundestagswahl und erfolgreicher Wiederwahl das Amt des Bundeskanzlers weiter ausüben. Helmut Schmidt setzte im Februar 1982 die Vertrauensfrage dazu ein, die Fraktion des Koalitionspartners F.D.P., aber auch seine eigene Fraktion wieder fest auf den politischen Kurs des Kanzlers zu trimmen. Er erhielt das Vertrauen, konnte es aber nur wenige Monate aufrechterhalten und musste nach dem Koalitionswechsel des Partners durch ein konstruktives Misstrauensvotum aus dem Amt weichen. Helmut Kohl, der seinen Vorgänger Schmidt vom Posten verdrängt hatte, strebte im Dezember 1982 an, durch Neuwahlen, welche sich einer bewusst gescheiterten Vertrauensfrage anschließen sollten, sich zu einer demokratischen Legitimation zu verhelfen, welche er zuvor nicht im gewünschten Umfang gegeben sah, da er durch das oben beschriebene Misstrauensvotum an die Macht gekommen war. Sein Vorhaben ging auf und er erreichte bei der Bundestagswahl die zweithöchste Zustimmung, die das Volk der Bundesrepublik jemals einer Partei gegeben hatte. Gerhard Schröder schließlich war der erste Kanzler der Bundesrepublik, der zweimal auf den Artikel 68 GG zurückgriff. Im November 2001 und im Juli 2005 machte er vom Recht des Kanzlers Gebrauch, das Parlament danach zu fragen, ob es noch Vertrauen in den Kanzler und seine Politik hat. Aber unter welchen Voraussetzungen tat er dies?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Vertrauensfrage vom 16. November 2001
- 2.1 Die Bundestagswahl vom 27. September 1998
- 2.2 Die Haltung der rot-grünen Regierung zu Bundeswehreinsätzen
- 2.3 Die Anschläge vom 11. September 2001
- 2.3.1 Die Anschläge
- 2.3.2 Die Reaktionen in der deutschen Politik
- 2.4 Die Militärschläge gegen Afghanistan
- 2.5 Der deutsche Beitrag zum „Krieg gegen den Terror”
- 2.6 Abweichende Haltungen in der Regierungskoalition
- 2.6.1 Abweichler in der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen
- 2.6.2 Abweichler in der Fraktion der SPD
- 2.6.3 Auf dem Weg zur Vertrauensfrage
- 2.6.4 Die weiteren Überzeugungsversuche
- 2.7 Die Vertrauensfrage
- 3 Die Vertrauensfrage vom 1. Juli 2005
- 3.1 Die Bundestagswahl vom 22. September 2002
- 3.2 Die Reformprojekte der Regierung
- 3.3 Die Wahlen zu Länderparlamenten während der 15. Legislaturperiode
- 3.3.1 Die Wahlen zu Länderparlamenten im Jahr 2003
- 3.3.2 Die Wahlen zu Länderparlamenten im Jahr 2004
- 3.3.3 Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein
- 3.3.4 Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen
- 3.3.5 Ein Überblick über die Situation in den Länderparlamenten und im Bundesrat
- 3.4 Die Vertrauensfrage
- 4 Vergleich beider Vertrauensfragen
- 4.1 Die Vergleichbarkeit beider Fälle
- 4.2 Vergleich der politischen Situationen
- 4.2.1 Vergleich der politischen Vorhaben
- 4.2.2 Vergleich der Macht- und Gesinnungsverschiebungen
- 4.2.3 Vergleich der Handlungsgründe des Kanzlers
- 5 Sinn oder Doppelsinn der Vertrauensfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die beiden Vertrauensfragen von Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahr 2001 und 2005. Ziel ist es, die politischen Hintergründe, die jeweiligen Situationen und die Folgen der Abstimmungen zu beleuchten und zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Analyse der politischen Motive Schröders und der Bewertung der strategischen Wirksamkeit seines Vorgehens unter Berücksichtigung des Artikels 68 des Grundgesetzes.
- Analyse der politischen Konstellationen vor den Vertrauensfragen
- Bewertung der strategischen Motive Schröders
- Vergleich der politischen Ereignisse und Folgen beider Vertrauensfragen
- Interpretation des Artikels 68 des Grundgesetzes im Kontext der beiden Fälle
- Untersuchung der langfristigen politischen Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung präsentiert die Thematik der Arbeit: die Analyse der beiden Vertrauensfragen von Gerhard Schröder im Lichte des Artikels 68 des Grundgesetzes. Sie skizziert kurz die vorherigen Anwendungen dieses Artikels durch andere Bundeskanzler und betont den besonderen Fall Schröders mit zwei Vertrauensfragen. Die Arbeit verspricht eine historische Schilderung der Ereignisse, einen Vergleich der beiden Fälle und eine abschließende Reflexion über Sinn und Zweck des Artikels 68.
2 Die Vertrauensfrage vom 16. November 2001: Dieses Kapitel beschreibt die politische Situation nach der Bundestagswahl 1998, die die rot-grüne Koalition hervorbrachte. Es beleuchtet die Haltung der Regierung zu Bundeswehreinsätzen, insbesondere im Kontext der Anschläge vom 11. September 2001 und der anschließenden Intervention in Afghanistan. Die verschiedenen Meinungen innerhalb der Koalition und die Herausforderungen für Schröder werden ausführlich dargestellt, um die Notwendigkeit der Vertrauensfrage zu verdeutlichen. Der Verlauf der Abstimmung und deren unmittelbare Folgen werden ebenfalls geschildert.
Schlüsselwörter
Vertrauensfrage, Artikel 68 Grundgesetz, Gerhard Schröder, rot-grüne Koalition, Bundeswehreinsätze, Afghanistan, 11. September 2001, politische Krise, Regierungsstabilität, Vergleichende Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Vertrauensfragen von Gerhard Schröder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die beiden Vertrauensfragen, die Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahr 2001 und 2005 gestellt hat. Sie untersucht die politischen Hintergründe, die jeweiligen Situationen vor den Abstimmungen, den Ablauf der Abstimmungen selbst und die Folgen der Vertrauensfragen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich beider Fälle und der Bewertung der strategischen Entscheidungen Schröders im Kontext von Artikel 68 des Grundgesetzes.
Welche Vertrauensfragen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Vertrauensfrage vom 16. November 2001 und die vom 1. Juli 2005. Beide Vertrauensfragen wurden von Bundeskanzler Gerhard Schröder gestellt und stehen im Mittelpunkt der vergleichenden Analyse.
Welche politischen Hintergründe werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die politischen Konstellationen vor beiden Vertrauensfragen. Für die Vertrauensfrage von 2001 werden die Bundestagswahl 1998, die Haltung der rot-grünen Regierung zu Bundeswehreinsätzen, die Anschläge vom 11. September 2001 und die anschließende Intervention in Afghanistan detailliert untersucht. Die Vertrauensfrage von 2005 wird im Kontext der Bundestagswahl 2002, der Reformprojekte der Regierung und der Wahlen zu Länderparlamenten während der 15. Legislaturperiode analysiert.
Wie werden die Vertrauensfragen verglichen?
Der Vergleich umfasst die politischen Situationen vor den Vertrauensfragen, die politischen Vorhaben der Regierung, die Macht- und Gesinnungsverschiebungen innerhalb der Koalition, sowie die Handlungsgründe des Kanzlers. Die Arbeit untersucht, inwiefern die beiden Fälle vergleichbar sind und welche Unterschiede bestehen.
Welche Rolle spielt Artikel 68 des Grundgesetzes?
Artikel 68 des Grundgesetzes bildet den rechtlichen Rahmen für die Vertrauensfragen. Die Arbeit interpretiert diesen Artikel im Kontext der beiden Fälle und untersucht seine Bedeutung für die Regierungsstabilität und die Entscheidungsfindung im politischen Prozess.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Neben der Analyse der politischen Hintergründe und des Vergleichs der beiden Vertrauensfragen, befasst sich die Arbeit mit der Zielsetzung und den Themenschwerpunkten der Analyse, bietet Kapitelzusammenfassungen und nennt Schlüsselwörter zur besseren Orientierung und zum besseren Verständnis des komplexen Themas.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die politischen Motive Schröders zu analysieren und die strategische Wirksamkeit seines Vorgehens zu bewerten. Sie untersucht die langfristigen politischen Auswirkungen der Vertrauensfragen und reflektiert über den Sinn und Zweck des Artikels 68 des Grundgesetzes.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für deutsche Politik, insbesondere für die Regierungsbildung und -stabilität interessieren. Sie eignet sich für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich eingehender mit dem politischen Wirken Gerhard Schröders und dem Instrument der Vertrauensfrage auseinandersetzen wollen. Die Arbeit ist auf eine akademische Leserschaft ausgerichtet.
- Citation du texte
- Diplom-Politologe Martin H. Hetterich (Auteur), 2006, Gerhard Schröder und Artikel 68 GG. Zwei Vertrauensfragen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53967