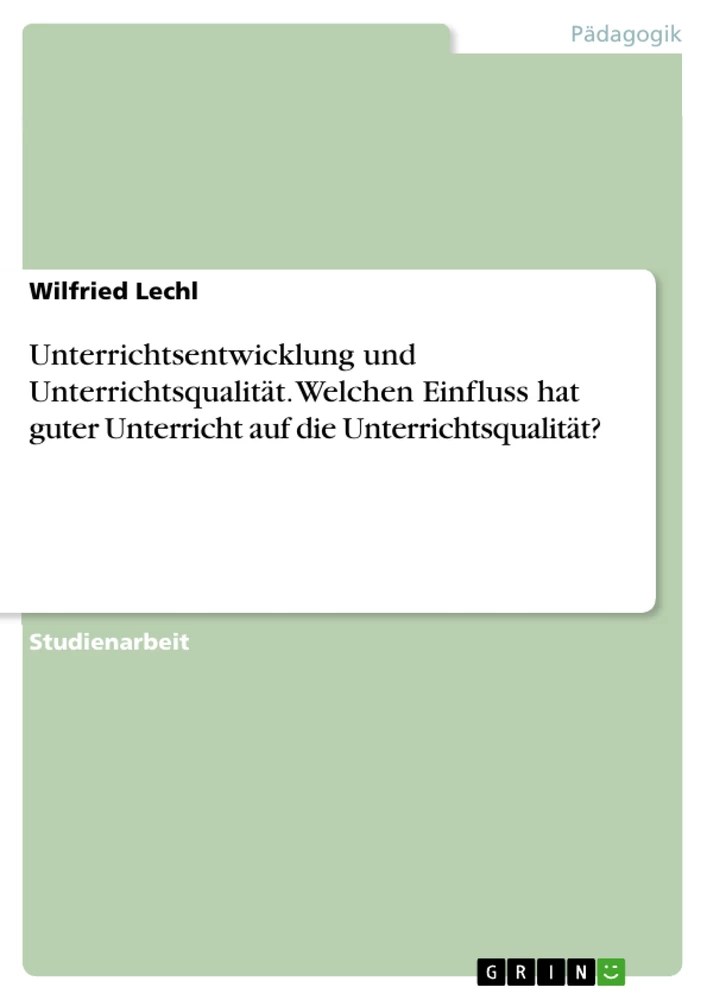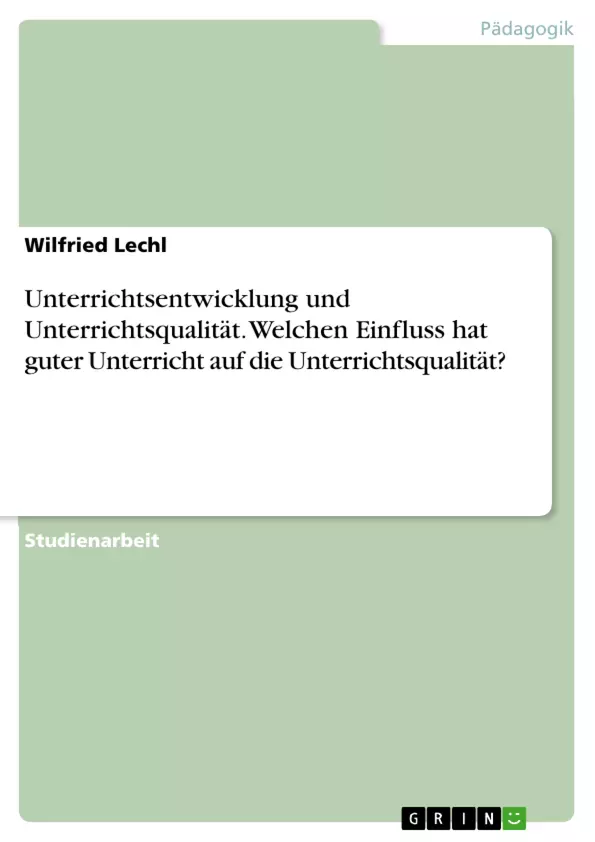Die vorliegende Arbeit befasst sich mit folgender Fragestellung: "Guter Unterricht als wesentlicher Bestandteil für Unterrichtsentwicklung. Welchen Einfluss hat guter Unterricht auf die Unterrichtsqualität?" Der Text konzentriert sich dabei auf den Einfluss guten Unterrichts auf die Unterrichtsqualität. Es wird die aktuelle Literatur unter der Fragestellung der Hausarbeit analysiert. Eine umfassende Literaturrecherche dient als Grundlage. Ausgehend von der Hypothese, dass guter Unterricht einen Einfluss auf die Unterrichtsqualität nimmt, nähert sich der Autor der Kernfrage dieser Arbeit. Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel.
Die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 lösten in Deutschland ein Umdenken in der Bildungspolitik aus, weil sie einen Reformbedarf verdeutlichten. Nach dem Bildungsbericht 2001 schnürte 2002 die Kultusministerkonferenz sieben Handlungsfelder, aus denen die Länder Reformmaßnahmen entwickelten. Insbesondere das fünfte Handlungsfeld ist für die Unterrichtsforschung von Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsverständnis Guter Unterricht
- Bildungsstandards, Bildungs- und Lernziele des Unterrichts
- Bildungsziele und Bildungsstandards der KMK
- Bildungsziele der Schule nach Weinert
- Wichtige Klassifikationen von Lernzielen
- Guter Unterricht und dessen Einfluss auf die Unterrichtsqualität
- Unterrichtsforschung und Lehr-Lern-Forschung
- Befunde zu Merkmale von Unterrichtsqualität
- Das Prozess-Produkt-Paradigma
- Das Experten-Paradigma
- Variablenzentrierter und personenzentrierter Ansatz
- Mögliche Orientierungen zu Qualität des Unterrichts
- Standpunkt der Methodenorientierung
- Perspektive der Wirkungsorientierung
- Auffassung der Prozessorientierung
- Qualitätskriterien guten Unterrichts
- Ein Angebots-Nutzungs-Modell der Wirkungsweise des Unterrichts nach Helmke u. Weinert
- Konzept der vier Schlüsselkompetenzen nach Weinert (1996b)
- Sachkompetenzen
- Didaktische Kompetenzen
- Diagnostische Kompetenzen
- Klassenführungskompetenzen
- Ableitung möglichen Einfluss guten Unterrichts auf die Unterrichtsqualität
- Unterrichtsforschung und Lehr-Lern-Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von gutem Unterricht für die Unterrichtsentwicklung. Ziel ist es, den Einfluss von gutem Unterricht auf die Unterrichtsqualität zu analysieren. Dabei werden verschiedene Definitionen von gutem Unterricht betrachtet, sowie die Ergebnisse relevanter Forschungsarbeiten zum Thema Unterrichtsqualität aufgezeigt.
- Definitionen von „gutem Unterricht“
- Zusammenhang von gutem Unterricht und Unterrichtsqualität
- Aktuelle Forschungsergebnisse zur Unterrichtsqualität
- Bedeutung von Bildungsstandards und Lernzielen für die Unterrichtsqualität
- Schlüsselkompetenzen für guten Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Die Einleitung führt das Thema „Guter Unterricht“ ein, stellt die Kernfrage der Hausarbeit dar und erläutert die methodische Vorgehensweise. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriffsverständnis „guten Unterrichts“ und analysiert verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs. Im dritten Kapitel werden Bildungsstandards, Bildungsziele und die Taxonomie von Lernzielen betrachtet. Das vierte Kapitel untersucht den Einfluss von gutem Unterricht auf die Unterrichtsqualität, indem verschiedene Forschungsperspektiven und Modelle beleuchtet werden. Das fünfte Kapitel, das Fazit, fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und leitet mögliche Konsequenzen ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe „guter Unterricht“, „Unterrichtsqualität“, „Bildungsstandards“, „Lernziele“, „Unterrichtsforschung“ und „Schlüsselkompetenzen“. Die zentrale Fragestellung behandelt den Einfluss von gutem Unterricht auf die Unterrichtsqualität, wobei verschiedene Perspektiven und Forschungsansätze betrachtet werden.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat „guter Unterricht“ auf die Unterrichtsqualität?
Die Arbeit geht von der Hypothese aus, dass guter Unterricht ein wesentlicher Bestandteil der Unterrichtsentwicklung ist und die Qualität maßgeblich steigert. Dies wird anhand aktueller Literatur und Forschungsbefunde analysiert.
Was versteht man unter Unterrichtsqualität?
Unterrichtsqualität wird durch verschiedene Merkmale definiert, wie z. B. Prozessorientierung, Wirkungsorientierung und Methodenorientierung. Sie wird oft über das Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke und Weinert erklärt.
Welche Rolle spielten die PISA-Ergebnisse für die Unterrichtsforschung?
Die PISA-Studie 2000 deckte Reformbedarf in Deutschland auf. Dies führte zur Festlegung von sieben Handlungsfeldern durch die KMK, wobei die Verbesserung der Unterrichtsqualität ein zentrales Ziel wurde.
Was sind die vier Schlüsselkompetenzen für guten Unterricht nach Weinert?
Zu den Schlüsselkompetenzen gehören Sachkompetenz, didaktische Kompetenz, diagnostische Kompetenz und Klassenführungskompetenz.
Was ist der Unterschied zwischen Bildungsstandards und Lernzielen?
Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben haben sollen. Lernziele beziehen sich konkreter auf die Inhalte und angestrebten Ergebnisse einer einzelnen Unterrichtseinheit.
Welche Paradigmen prägen die moderne Lehr-Lern-Forschung?
Die Arbeit beleuchtet unter anderem das Prozess-Produkt-Paradigma (Zusammenhang von Lehrerverhalten und Schülerleistung) sowie das Experten-Paradigma (Fokus auf die Kompetenz der Lehrkraft).
- Quote paper
- Wilfried Lechl (Author), Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsqualität. Welchen Einfluss hat guter Unterricht auf die Unterrichtsqualität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539688