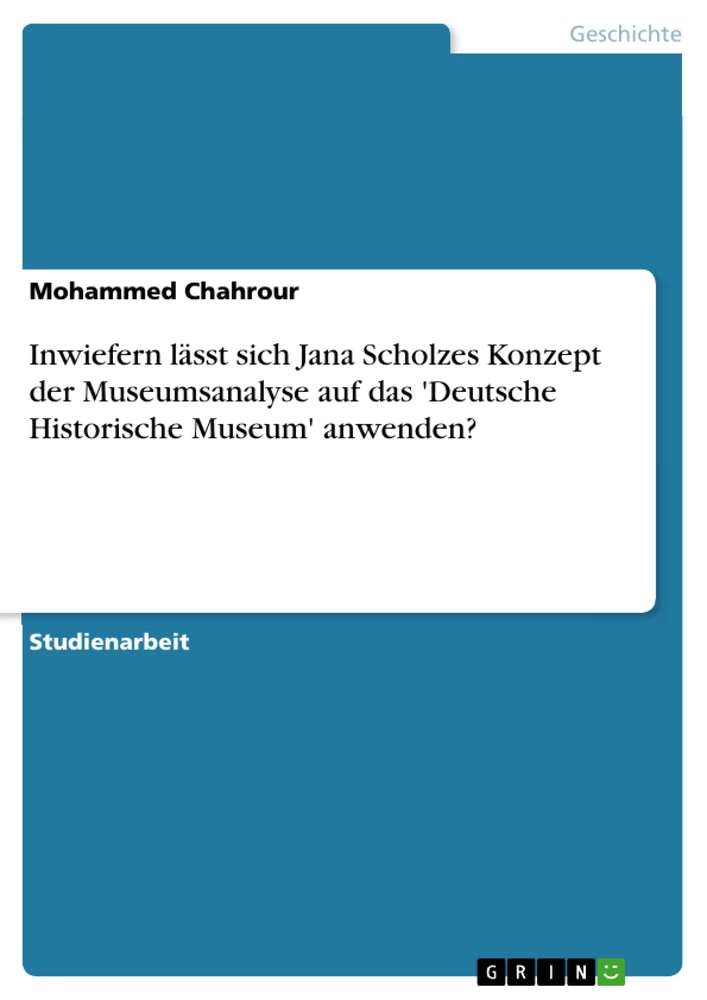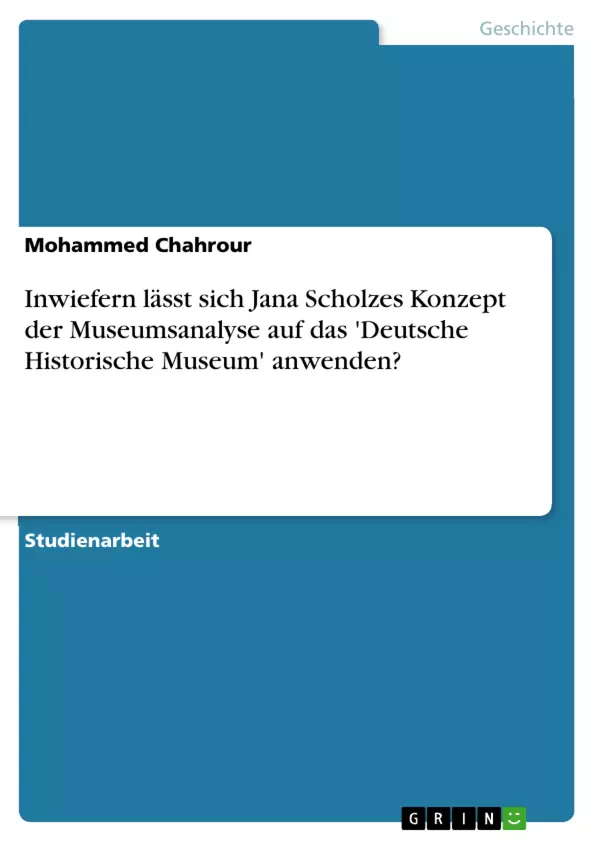Wie schön ist es doch, wenn so etwas Abstraktes wie Geschichte zum Greifen nah ist? Etliche Museen teilen mit den Menschen diese Faszination und stillen scheinbar das Bedürfnis des Menschen, seine Spezies in allen Lagen und Geschehnissen zu beobachten. Der Mensch hat heutzutage eben jenes Privileg, einem Zeitwanderer gleich, durch die Geschichte zu reisen, und wie jeder Reisende brauchen auch Geschichtsinteressierte die passenden Instrumente, um für die Reise gewappnet zu sein.
Es ist wichtig, dass den Museumsbesucher*innen ein gewisses Instrumentarium dargeboten wird, da man sonst Gefahr läuft, sich in einen konstruierten Raum zu begeben und diesen unkritisch und unreflektiert zu durchlaufen. So kann es sein, dass die Besucher*innen unbewusst beeinflusst werden und jenes Geschichtsbild der Kuratoren in die eigene Welt mitnehmen. Somit könnte schlimmstenfalls eine exponentielle Verbreitung eines Gedankengutes erfolgen, das sich schädlich auf die demokratischen Werte auswirken kann.
Demnach ist es umso entscheidender, ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln, um für jene ‚unsichtbaren Gefahren‘ gegenüber, sprich abstraktes Gedankengut, sensibler zu werden.
Hierfür bieten sich zahlreiche Methoden an, wovon zwei im Folgenden kurz erläutert werden sollen, um letztlich zu begründen, weswegen sich Jana Scholzes Methode besser eignet als die anderen beiden.
Als erstes wird die Methode des Historikers Thomas Thiemeyer kurz dargestellt. Dieser untersucht mittels der klassischen geschichtswissenschaftlichen Methode der Quellenkritik das Museum und dessen Objekte. Thiemeyer erstellt zur Vereinfachung einen Fragekatalog, um die historisch-kritische Museumsanalyse durchzuführen. Einen weiteren methodischen Ansatz bietet Eric Gable an, der mit ethnologischen Methoden das Museum untersucht. Damit rücken die implizierten Handlungen der Kuratoren in den Mittelpunkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jana Scholzes Methode
- Deskription - Präsentationsform
- Denotation - Gebrauchsfunktion
- Konnotation - Sekundäres Zeichensystem
- Metakommunikation - Zeichen außerhalb des Ausstellungskontextes
- Methodische Anwendung - Trabi und VW Käfer
- Deutsches Historisches Museum
- Deskription
- Denotation
- Konnotation
- Metakommunikation
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Museumsanalyse, insbesondere mit Jana Scholzes Konzept, um dessen Anwendbarkeit auf das Deutsche Historische Museum (DHM) zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung der in Museen präsentierten Objekte und ihrer Botschaftsvermittlung.
- Jana Scholzes Methode zur Museumsanalyse
- Die Bedeutung von Objekten als Träger von Zeichen und Konnotationen
- Die Analyse von Objekten wie dem Trabant und dem VW Käfer im DHM
- Die Rolle von Kontext und Metakommunikation in der Museumsanalyse
- Die Frage, ob Jana Scholzes Methode geeignet ist, um ein kritisches Bewusstsein für die Botschaftsvermittlung in Museen zu fördern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der Museumsanalyse im Kontext historischer Sinnbildung und kritischer Auseinandersetzung mit der Geschichtsdarstellung heraus. Sie skizziert die Schwächen klassischer Analysemethoden (Thiemeyer, Gable) und erläutert die Vorteile von Jana Scholzes Ansatz.
- Jana Scholzes Methode: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Erläuterung von Jana Scholzes Methodik, die auf den theoretischen Grundlagen von Umberto Eco und Roland Barthes basiert. Die Konzepte der Deskription, Denotation, Konnotation und Metakommunikation werden vorgestellt und ihre Bedeutung für die Analyse von Museumsexponaten erklärt.
- Methodische Anwendung - Trabi und VW Käfer: Dieses Kapitel widmet sich der konkreten Anwendung von Jana Scholzes Methode auf das Deutsche Historische Museum (DHM) anhand der Objekte "Trabant" und "VW Käfer". Es werden die Deskription, Denotation, Konnotation und Metakommunikation dieser beiden Exponate analysiert, um die Botschaftsvermittlung und deren Deutungsmöglichkeiten im DHM zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Museumsexponate, Museumsanalyse, Semiotik, Jana Scholze, Deskription, Denotation, Konnotation, Metakommunikation, Deutsche Historisches Museum (DHM), Trabant, VW Käfer, Botschaftsvermittlung, Kontext, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Jana Scholzes Museumsanalyse?
Ziel ist es, ein kritisches Bewusstsein für die Art und Weise zu entwickeln, wie Museen durch die Präsentation von Objekten bestimmte Geschichtsbilder und Ideologien vermitteln.
Was bedeuten Deskription und Denotation in diesem Kontext?
Deskription beschreibt die äußere Form und Präsentation eines Objekts, während Denotation die primäre Gebrauchsfunktion des Gegenstands bezeichnet.
Wie werden Trabi und VW Käfer im DHM analysiert?
Anhand dieser Objekte wird gezeigt, wie sie im Deutschen Historischen Museum nicht nur als Fahrzeuge, sondern als Symbole für politische Systeme und Lebensgefühle (Konnotationen) inszeniert werden.
Was versteht man unter Metakommunikation in der Museumsanalyse?
Metakommunikation bezieht sich auf Zeichen und Informationen außerhalb des direkten Ausstellungskontextes, die die Wahrnehmung der Exponate beeinflussen.
Warum ist eine kritische Museumsanalyse wichtig?
Ohne kritisches Instrumentarium laufen Besucher Gefahr, konstruierte Geschichtsbilder unreflektiert zu übernehmen, was die Verbreitung einseitiger Sichtweisen fördern kann.
- Citar trabajo
- Mohammed Chahrour (Autor), 2018, Inwiefern lässt sich Jana Scholzes Konzept der Museumsanalyse auf das 'Deutsche Historische Museum' anwenden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540310