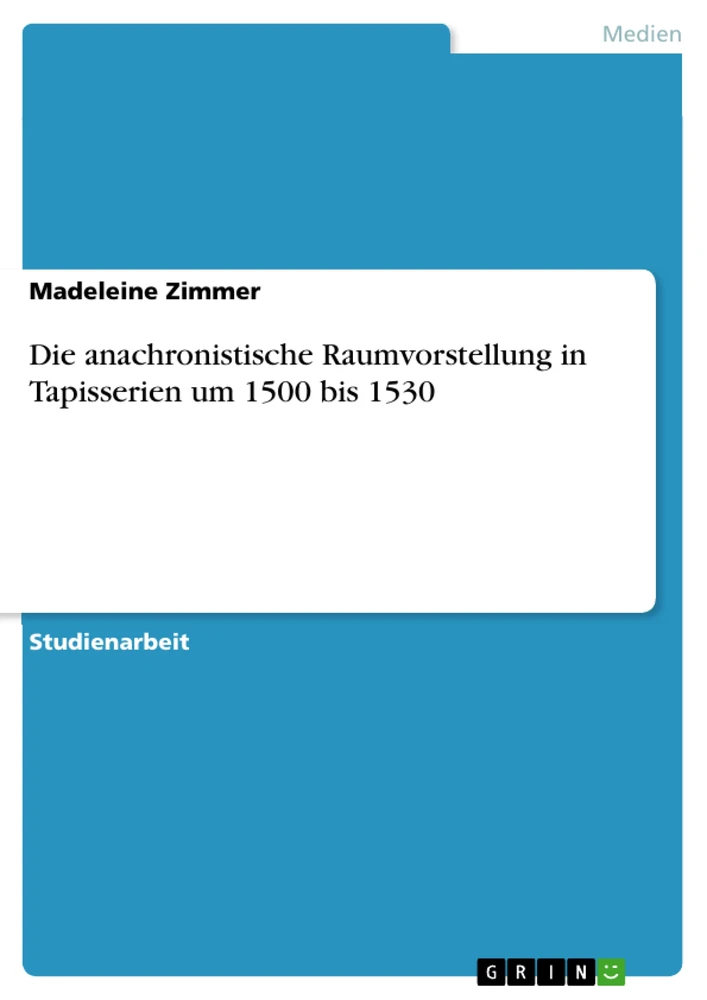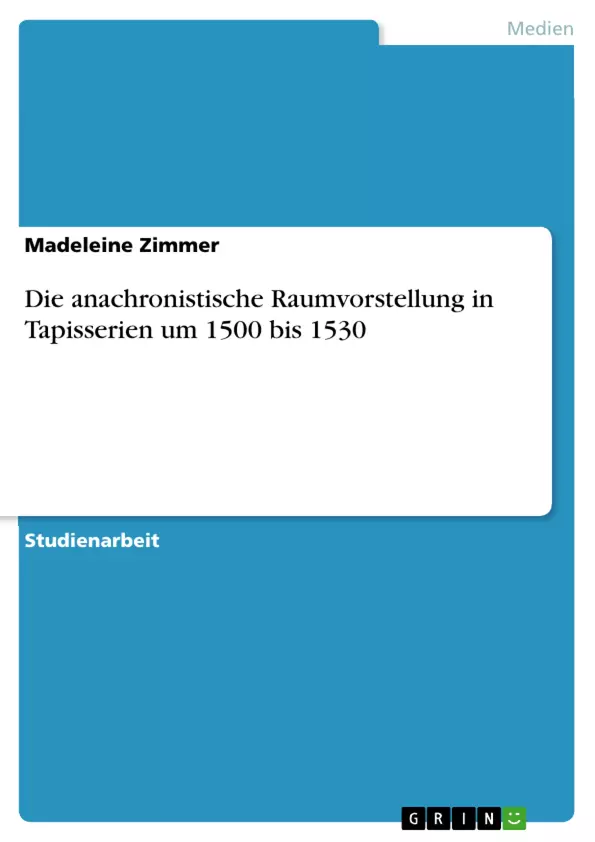Diese Seminararbeit befasst sich mit Tapisserien entstanden in dem Zeitraum von 1500 bis 1530. Dabei geht es um das Phänomen der anachronistische Raumwirkung der Tapisserien, die sich nicht an der Tiefenwirkung und Erfindung der Zentralperspektive orientierte.
Anhand ausgewählter Beispiele und ausgehend von Weddigens Beispiel der Cluny Tapisserienserie, wird die ikonographische Tradition der anachronistischen Raumkonstruktion (im französischen Raum) analysiert und weitere Tapisserien die eine stilistische Ähnlichkeit zu ihr aufweisen und um die gleiche Zeit entstanden sind, vorgestellt. Schließlich wird anhand von der "Lérian et Lauréolle" Tapisserienserie die Wirkungsmacht der anachronistischen Darstellung und das Zusammenspiel der Tapisserien mit anderen Medien analysiert.
In seinem Aufsatz "Textile Bildräume: Antike/Neuzeit" versucht Tristan Weddigen sich anhand von Tapisserien vom dominanten kunstgeschichtlichen Diskurs, welcher die Kunst und ihrer Interpretation fernab der Materialität der Kunstwerke betrachtet, zu lösen und auf eine „medial vielfältige Kunstgeschichte“ aufmerksam zu machen. Trotz der gängigen Ausschreibung des Materials aus der Geschichte der neuzeitlichen Kunst, verweist die Vielzahl an Tapisserien aus dieser Zeit und deren Wirkungsmacht auf eine andere Lebens- und Bilderwelt, welche dieser entmaterialisierten Vorstellung von Kunst widerspricht.
In seiner Auseinandersetzung mit Tapisserien aus der Zeit um 1520 verweist Weddigen auf die Existenz mehrerer paralleler Erzählungen der Kunst der Renaissance. Diese Überlegung bezieht sich nicht nur auf die Einbeziehung des Materials in die Interpretation der frühneuzeitlichen Kunst, sondern auch auf die anachronistische Raumwirkung der Tapisserien, die sich nicht an der Tiefenwirkung und Erfindung der Zentralperspektive orientierte.
Weddigen bezeichnet diesen Anachronismus als medienspezifisch und analysiert die Raumvorstellung am Beispiel von (spät)mittelalterlichen nordalpinen Tapisserien (Verduren) und italienischen Groteskenteppichen der Renaissance. Dabei suggeriert er eine Umschreibung der Kunstgeschichte aus der Sicht der behandelten Fallbeispiele und der in ihnen vorkommenden anachronistischen Raumkonstruktion. Zudem betonen die folgenden Beispiele wie das Haptische, also das Material des Kunstwerks und das körperliche Erlebnis des Betrachters auch Teil der damaligen Kunstrezeption waren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die Tapisserienserie „Das herrschaftliche Leben“ (1520)
- 2.1 Millefleurs Tapisserien
- 3. Die Chaumont Tapisserienserie (1510) und ikonographische Vorläufer
- 4. Die Tapisserienserie „Die Geschichte von Lérian et Lauréolle“ (1528)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die anachronistische Raumvorstellung in Tapisserien der Zeit um 1500 bis 1530, basierend auf dem Aufsatz von Tristan Weddigen. Die Arbeit analysiert, wie die Materialität der Tapisserien und deren medienspezifische Eigenschaften die Raumdarstellung und die Rezeption der Kunstwerke beeinflussten. Es wird der Versuch unternommen, die künstlerischen Entscheidungen im Kontext der damaligen Hofkultur und der zeitgenössischen künstlerischen Strömungen zu verstehen.
- Die medienspezifische Raumvorstellung in Tapisserien der frühen Neuzeit.
- Der Einfluss mittelalterlicher Traditionen auf die Raumgestaltung in Renaissance-Tapisserien.
- Die Rolle der Materialität (Textil) in der Interpretation frühneuzeitlicher Kunst.
- Der Zusammenhang zwischen Tapisserien, Literatur und Hofkultur.
- Die Rezeption und Wirkungsmacht anachronistischer Darstellungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit setzt sich mit Tristan Weddigens Ansatz auseinander, die Kunstgeschichte unter Berücksichtigung der Materialität von Kunstwerken zu betrachten. Weddigen kritisiert den gängigen kunsthistorischen Diskurs, der die Materialität vernachlässigt. Die Arbeit wird anhand von Beispielen frühneuzeitlicher Tapisserien zeigen, wie die Materialität das räumliche Erleben und die Rezeption beeinflusst. Sie konzentriert sich auf die anachronistische Raumwirkung dieser Tapisserien, die im Gegensatz zur perspektivischen Darstellung der Malerei steht.
2. Die Tapisserienserie „Das herrschaftliche Leben“ (1520): Dieses Kapitel analysiert die sechsteilige Tapisserienserie „Das herrschaftliche Leben“, die im Cluny Museum in Paris ausgestellt ist. Die Arbeit untersucht die ikonographie der einzelnen Szenen (Jagd, Stickerin, Liebesszenen etc.) im Kontext der damaligen Hofkultur und des Liebesdiskurses. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Verhältnis von Figuren und Hintergrund, welches die Materialität und die „Selbstreflexivität“ des Mediums betont. Die scheinbar willkürliche Anordnung der Figuren wird als bewusste Gestaltungsentscheidung interpretiert, die die immersive Erfahrung des Betrachters fördert und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lässt.
2.1 Millefleurs Tapisserien: Dieser Abschnitt vertieft die Analyse der „Das herrschaftliche Leben“-Serie durch den Vergleich mit anderen Millefleurs-Tapisserien. Es wird die Schwierigkeit der Datierung und Zuordnung dieser Tapisserien thematisiert und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Raumkonstruktion und Ikonographie herausgearbeitet. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der Arbeitsteilung zwischen Malern und Webern auf die stilistischen Merkmale der Millefleurs-Tapisserien.
3. Die Chaumont Tapisserienserie (1510) und ikonographische Vorläufer: Dieses Kapitel vergleicht die Cluny-Serie mit der Chaumont-Serie und untersucht ikonographische Vorläufer. Es werden Parallelen zu früheren höfischen Darstellungen in Fresken, Manuskripten und anderen Medien hergestellt, um die anachronistische Raumgestaltung im Kontext der Tradition der höfischen Kunst zu beleuchten. Die Arbeit zeigt den Einfluss der Internationalen Gotik auf die stilistischen Merkmale der Tapisserien.
4. Die Tapisserienserie „Die Geschichte von Lérian et Lauréolle“ (1528): Das letzte Kapitel analysiert die Tapisserienserie „Die Geschichte von Lérian et Lauréolle“, die auf dem Buch „Das Gefängnis der Liebe“ basiert. Es wird die gestaffelte Komposition und die Simultandarstellung der Tapisserien untersucht und deren Beziehung zum literarischen Vorbild erörtert. Die Arbeit hebt die Performativität und Theatralität der Tapisserien hervor und zeigt, wie sie den Betrachter in eine immersive und individuelle Erfahrung einbeziehen. Die anachronistische Raumvorstellung wird als medienspezifisch interpretiert, die aus der Tradition der Hofkultur resultiert.
Schlüsselwörter
Tapisserien, Renaissance, Anachronismus, Raumvorstellung, Materialität, Textil, Hofkultur, Liebesdiskurs, Millefleurs, Internationale Gotik, Medialität, Rezeption, Ikonographie, Cluny-Tapisserien, Chaumont-Tapisserien, Lérian et Lauréolle.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Anachronistische Raumvorstellung in Tapisserien um 1500
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die anachronistische Raumvorstellung in Tapisserien der Zeit um 1500 bis 1530. Sie analysiert, wie die Materialität der Tapisserien und deren medienspezifische Eigenschaften die Raumdarstellung und die Rezeption der Kunstwerke beeinflussten, und setzt dies in den Kontext der damaligen Hofkultur und künstlerischen Strömungen.
Welche Tapisserien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Tapisserien-Serien, darunter „Das herrschaftliche Leben“ (1520), die Chaumont-Serie (1510) und „Die Geschichte von Lérian et Lauréolle“ (1528). Ein besonderer Fokus liegt auf den Millefleurs-Tapisserien.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Ansatz von Tristan Weddigen, der die Bedeutung der Materialität von Kunstwerken für deren kunsthistorische Interpretation betont. Es werden kunsthistorische Methoden angewendet, um die Ikonographie, Komposition und die medienspezifischen Eigenschaften der Tapisserien zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der medienspezifischen Raumvorstellung in Tapisserien der frühen Neuzeit, dem Einfluss mittelalterlicher Traditionen auf die Renaissance-Tapisserien, der Rolle der Materialität (Textil) in der Interpretation frühneuzeitlicher Kunst, dem Zusammenhang zwischen Tapisserien, Literatur und Hofkultur, sowie der Rezeption und Wirkungsmacht anachronistischer Darstellungen.
Wie werden die Kapitel aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den theoretischen Rahmen und die Forschungsfrage erläutert. Die folgenden Kapitel analysieren jeweils eine der oben genannten Tapisserien-Serien, wobei Kapitel 2.1 einen vertiefenden Blick auf Millefleurs-Tapisserien wirft. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Serie „Die Geschichte von Lérian et Lauréolle“.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt, wie die anachronistische Raumvorstellung in den untersuchten Tapisserien durch die Materialität und medienspezifische Eigenschaften des Mediums entsteht und wie diese Raumwirkung die Rezeption der Kunstwerke beeinflusst. Der Kontext der Hofkultur und der Bezug zu literarischen Vorbildern werden als wichtige Faktoren herausgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Tapisserien, Renaissance, Anachronismus, Raumvorstellung, Materialität, Textil, Hofkultur, Liebesdiskurs, Millefleurs, Internationale Gotik, Medialität, Rezeption, Ikonographie, Cluny-Tapisserien, Chaumont-Tapisserien, Lérian et Lauréolle.
- Quote paper
- Madeleine Zimmer (Author), 2020, Die anachronistische Raumvorstellung in Tapisserien um 1500 bis 1530, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540329