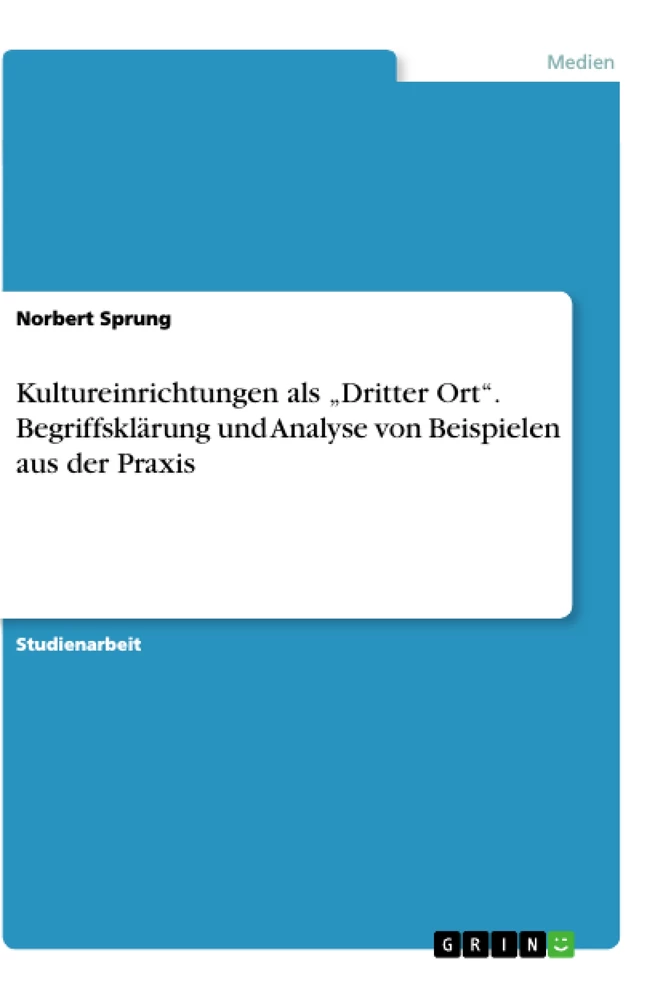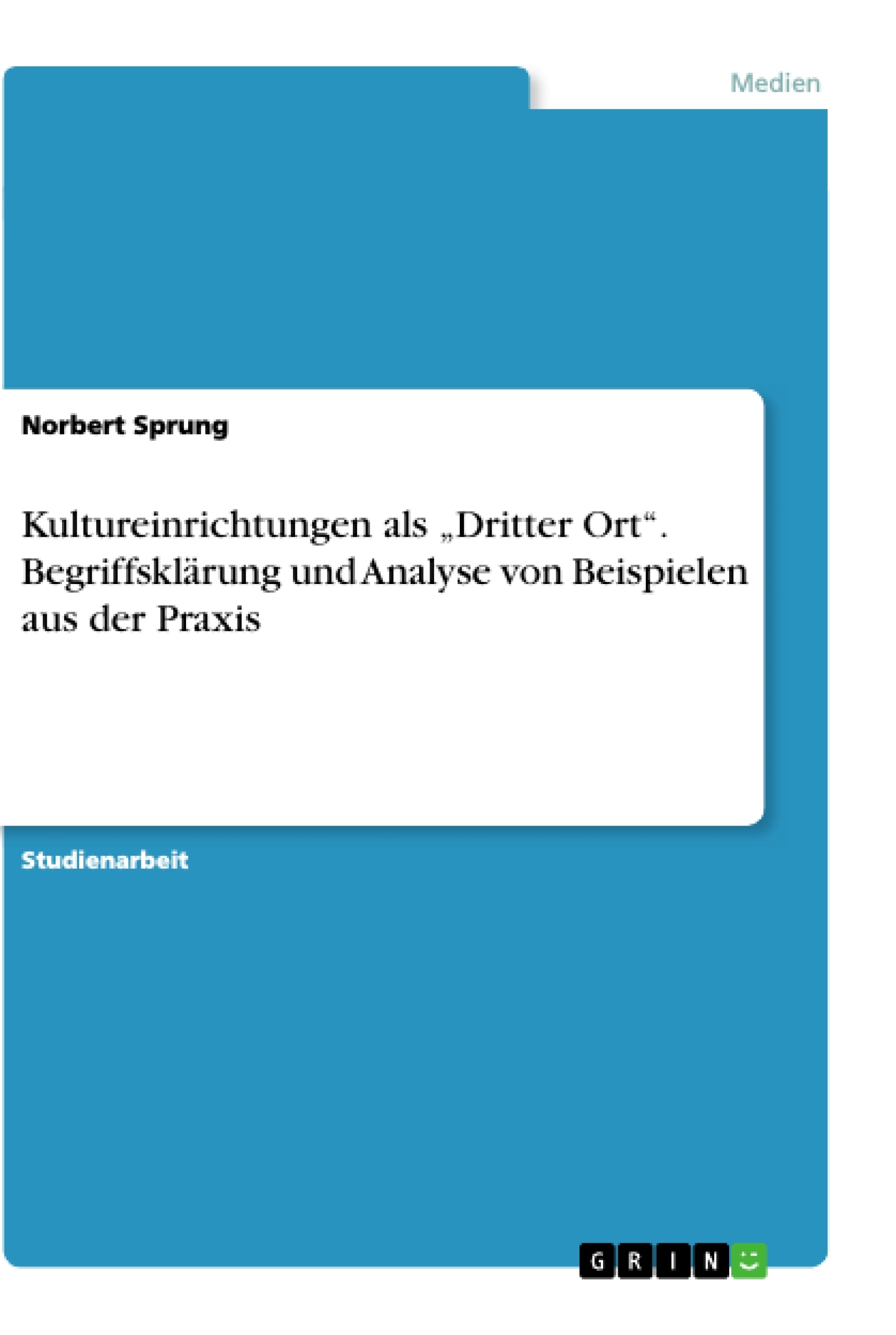Seit einigen Jahren entwickeln Kultureinrichtungen zunehmend Konzepte zum Aufenthalt, für die Begegnung und den Austausch ihrer Besucher. Sie verfolgen damit das Ziel, sich zu einem sogenannten „Dritten Ort“ zu transformieren. Doch warum eignen sich Kultureinrichtungen besonders gut als „Dritter Ort“? Diese Frage soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Hierzu ist es zunächst erforderlich, zu betrachten, was ein „Dritter Ort“ ist, wie der Begriff entstanden ist und wie dieser definiert wird. Anschließend soll untersucht werden, wie Kultureinrichtungen die Definition aufgreifen und mit welchen praktischen Konzepten sie den „Dritten Ort“ gestalten.
Dazu wird zunächst ein Bereich des deutschen Kulturbetriebs eingegrenzt. Danach werden die verschiedenen Kultureinrichtungen innerhalb dieses Bereichs und ihre Aktivitäten zum „Dritten Ort“ dargestellt. Diese Darstellungen werden zusätzlich mit Praxisbeispielen ergänzt. Anhand der Beschreibungen und der zugehörigen Praxisbeispiele soll dargestellt werden, inwieweit die ursprüngliche Intention des „Dritten Ortes“ in den Kultureinrichtungen wiederzufinden ist. Zudem soll ein Eindruck gewonnen werden, auf welche gesellschaftlichen Entwicklungen und Problemstellungen Kultureinrichtungen mit der Transformation zum „Dritten Ort“ reagieren. Dieser gesellschaftliche Kontext soll die besondere Eignung von Kultureinrichtungen als „Dritte“ Orte noch einmal verdeutlichen und zudem einen Ausblick auf weitere Entwicklungen in diesem Bereich ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Begriffs „Dritter Ort“
- Definition des dritten Ortes nach Ray Oldenburg
- Definition und Merkmale des dritten Ortes im Kulturbereich
- Öffentliche Bibliotheken als dritter Ort
- Praxisbeispiele Öffentlicher Bibliotheken als dritte Orte
- Andere Kultureinrichtungen als dritte Orte
- Praxisbeispiele anderer Kultureinrichtungen als dritte Orte
- Durch Kooperation zum dritten Ort
- Praxisbeispiele kooperativer Konzepte als dritte Orte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit Kultureinrichtungen sich zu einem „Dritten Ort“ entwickeln können. Sie analysiert den Begriff „Dritter Ort“ und seine Entstehung sowie die Merkmale, die ihn im Kulturbereich charakterisieren. Die Arbeit beleuchtet, wie Kultureinrichtungen praktische Konzepte entwickeln, um die Definition des „Dritten Ortes“ aufzugreifen.
- Definition und Entstehung des Begriffs „Dritter Ort“
- Merkmale des „Dritten Ortes“ im Kulturbereich
- Praxisbeispiele von Kultureinrichtungen als „Dritte Orte“
- Gesellschaftliche Entwicklungen und Problemstellungen, auf die Kultureinrichtungen mit der Transformation zum „Dritten Ort“ reagieren
- Potenzial und Herausforderungen von Kultureinrichtungen als „Dritte Orte“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Problematik der zunehmenden Entfremdung und Isolation in modernen Gesellschaften und stellt Kultureinrichtungen als potenzielle „Dritte Orte“ vor. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung des Begriffs „Dritter Ort“ durch den amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg, der ihn als Gegenentwurf zu den anonymen Wohnvierteln der amerikanischen Vorstadt entwickelte. In Kapitel 3 werden die Merkmale des „Dritten Ortes“ im Kulturbereich näher beleuchtet. Es werden Beispiele aus der Praxis vorgestellt, wie Bibliotheken und andere Kultureinrichtungen die Definition des „Dritten Ortes“ aufgreifen und mit konkreten Konzepten umsetzen. Die Analyse der Beispiele verdeutlicht, wie Kultureinrichtungen den Menschen Begegnung, Austausch und Gemeinschaft ermöglichen und gleichzeitig auf gesellschaftliche Entwicklungen und Problemstellungen reagieren können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Konzepte des „Dritten Ortes“ nach Ray Oldenburg und die Transformation von Kultureinrichtungen zu „Dritten Orten“. Wesentliche Schlüsselbegriffe sind „informelles öffentliches Leben“, „Neutraler Boden“, „Gemeinschaft“, „Begegnung“, „Austausch“ und „gesellschaftliche Entwicklungen“. Die Arbeit analysiert, wie Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und andere Kultureinrichtungen diese Konzepte in der Praxis umsetzen und wie sie damit auf Herausforderungen wie zunehmende Isolation und Anonymität in der Gesellschaft reagieren können.
- Citation du texte
- Norbert Sprung (Auteur), 2020, Kultureinrichtungen als „Dritter Ort“. Begriffsklärung und Analyse von Beispielen aus der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540604