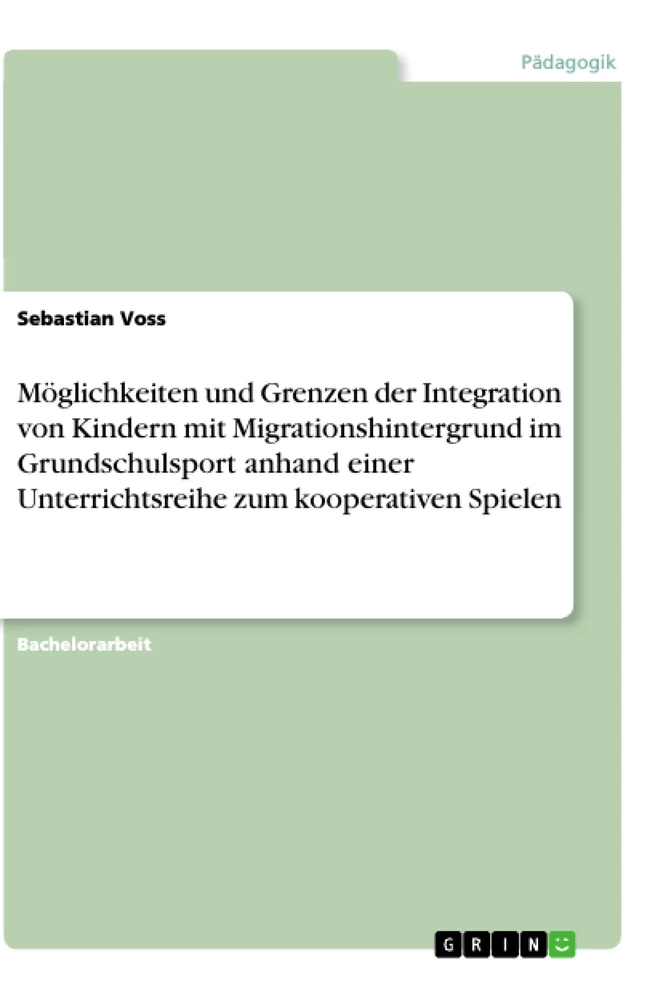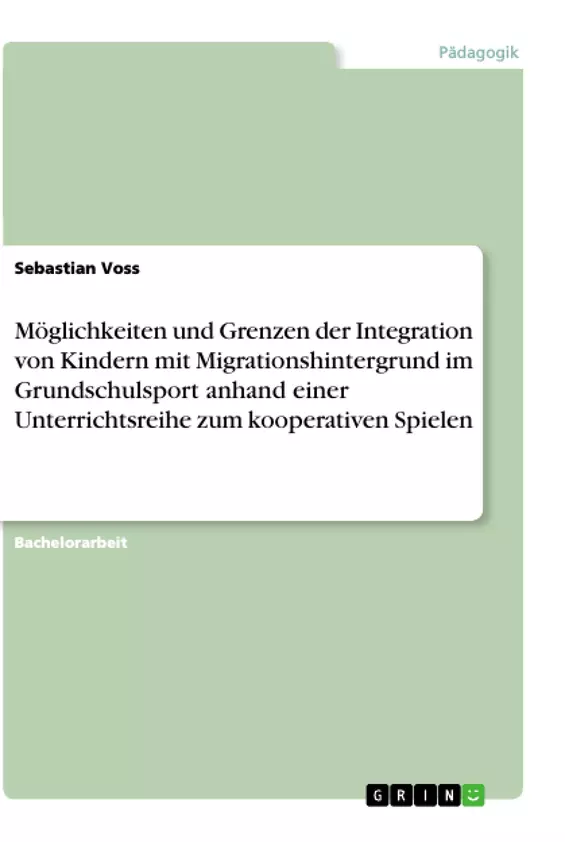Der Begriff Integration ist in Deutschland schon lange kein Fremdwort mehr. In der Bildungspolitik erfährt der integrative Unterricht eine immer größere Bedeutung und ist seit der im Jahr 2015 begonnenen Flüchtlingskrise an deutschen Schulen nicht mehr wegzudenken. Dabei wird besonders dem Sportunterricht die immer größere Aufgabe zu Teil, einen wertvollen Beitrag zur Integration ausländischer Schüler zu leisten. Der Sport bietet viele Möglichkeiten, Schüler mit Migrationshintergrund in spielerischer Form in die Gesellschaft einzugliedern. Bei kooperativen Spielen werden sprachliche Barrieren überwunden und alternative Verständigungsformen gefunden. Regelwerke haben oft kulturübergreifend dieselbe Bedeutung und kaum eine Aktivität schafft mehr Raum mit seinen Mitmenschen in Kontakt treten zu können, als der Sport. Doch wo der Schulsport Integrationsmöglichkeiten schafft, bauen sich unweigerlich auch Grenzen auf. Religiosität und kulturelle Wertvorstellung erlauben nicht allen Kindern die in den Schulen ausgeführte Form des Sporttreibens. Sprachbarrieren können zu Gestaltungsproblemen und Störungen im Unterrichtsablauf führen. In einer Zeit, in der das Vermitteln gesellschaftlicher Wertvorstellungen und das Integrieren in die Gesellschaft besonders den Aufgabenfeldern der Schulen zugeordnet wird, ist es umso wichtiger, das Potential des Schulsports als Integrationsinstanz zu nutzen.
Da Sport schon immer als das Ausgleichsfach zum Unterrichtsalltag fungierte, und es kaum einen mehr motivierenden und Spaß fördernden schulischen Bereich gibt, möchte ich mit dieser Ausarbeitung eine Situation anvisieren, die Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund den Einstieg in die Gesellschaft erleichtert. Ziel dieser Ausarbeitung ist es in Zukunft einen zielgruppengerechten Unterricht durchführen zu können, der die Integration ausländischer Schüler begünstigt und ein positiveres Klassenklima schafft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen zur Integration
- Begriffserklärung Integration
- Sozialintegration nach Hartmut Esser
- Deutschland als Einwanderungsland - Daten zur Einwanderung der letzten Jahre
- Grundschulsport als „Integrationsmotor“
- Integrationsmöglichkeiten durch den Grundschulsport
- Grenzen der Integrationsmöglichkeiten durch den Grundschulsport
- Zwischenfazit
- Integration durch eine Unterrichtsreihe am Beispiel kooperativer Spiele im Grundschulsport
- Die Rolle des Lehrers im kooperativen Sportunterricht
- Rahmenbedingungen der Unterrichtsreihe
- Lern- und Lehrvoraussetzung der Schülerinnen und Schüler
- Ziele der Unterrichtsreihe
- Vorstellung und Beobachtungen der Unterrichtsstunden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund im Grundschulsport am Beispiel einer Unterrichtsreihe zum kooperativen Spielen. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas Integration im Kontext von Schule und Sport und analysiert die Rolle des Sportunterrichts als „Integrationsmotor“.
- Definition und verschiedene Konzepte von Integration
- Der Stellenwert des Grundschulsports für die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund
- Die Herausforderungen und Grenzen der Integration im Sportunterricht
- Analyse einer Unterrichtsreihe zum kooperativen Spielen als Beispiel für gelungene Integration
- Die Rolle des Lehrers und die Bedeutung von didaktischen und methodischen Strategien im Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit ein. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas Integration im Kontext von Schule und Sport und stellt die Motivation des Autors für diese Arbeit dar. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur Integration beleuchtet. Der Begriff „Integration“ wird definiert und verschiedene Integrationskonzepte, insbesondere das von Hartmut Esser, werden vorgestellt. Außerdem werden statistische Daten zur Einwanderungssituation in Deutschland präsentiert.
Kapitel 3 widmet sich der Bedeutung des Grundschulsports als „Integrationsmotor“. Es werden die Möglichkeiten und Grenzen der Integration durch den Sportunterricht diskutiert. Dabei wird auf die Bedeutung von kooperativen Spielen für die Förderung der Integration eingegangen.
Im vierten Kapitel wird eine selbst entwickelte Unterrichtsreihe zum kooperativen Spielen vorgestellt und analysiert. Es werden die Rahmenbedingungen der Unterrichtsreihe, die Ziele, die Durchführung und die beobachteten Ergebnisse beschrieben.
Schlüsselwörter
Integration, Migrationshintergrund, Grundschulsport, kooperative Spiele, Unterrichtsreihe, Lehrerrolle, didaktische Strategien, soziales Lernen, interkulturelles Lernen, Sprachbarrieren, kulturspezifische Wertvorstellungen, Inklusion, Diversität
- Quote paper
- Sebastian Voss (Author), 2018, Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund im Grundschulsport anhand einer Unterrichtsreihe zum kooperativen Spielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540720