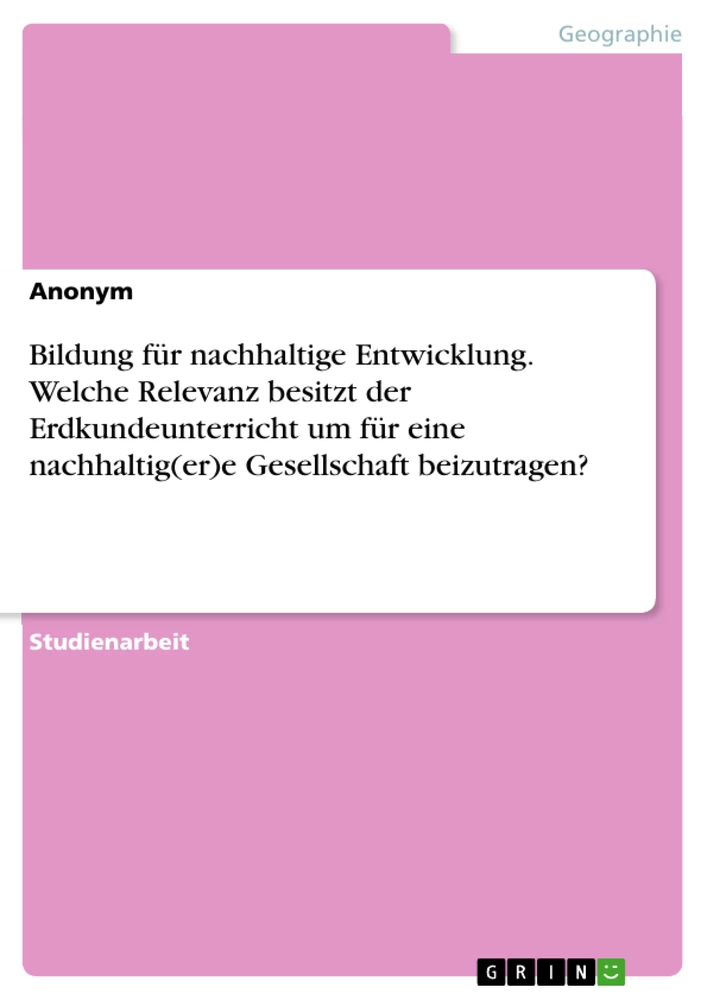Nachhaltige Entwicklung ist ein Thema, welches mittlerweile immer häufiger sowohl im Alltag, als auch in der Schule diskutiert und thematisiert wird. Doch welche Rolle spielt der Erdkundeunterricht und ich als zukünftige Erdkundelehrkraft hinsichtlich der Vermittlung nachhaltiger Aspekte? Und welche Methoden stehen mir dabei zur Verfügung? In diesem Portfolio werde ich mich deshalb mit der Fragestellung „Bildung für nachhaltige Entwicklung – welche Relevanz besitzt der Erdkundeunterricht um für eine nachhaltig(er)e Gesellschaft beizutragen? - Welche Bedeutung nimmt dabei die methodische Vielfalt ein? - “ auseinandersetzen.
Anfänglich beschäftige ich mich mit der Daseinsberechtigung der Geographie. Im Zuge dessen werde ich auf die aktuelle Situation in Deutschland, den Einfluss und die Bedeutung des Geographieunterrichts eingehen.
Darauffolgend werden die Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, anhand einer selbst erstellten Abbildung, veranschaulicht und einige der weltweiten Ziele nachhaltiger Entwicklung genannt. Im weiteren Verlauf beschäftige ich mich mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was ist BNE überhaupt? Und in welche Bereiche nimmt BNE Einfluss? Um dann genauer auf den Aspekt Schule einzugehen, beschäftige ich mit der Frage „Was hat Bildung damit zu tun?“ (vgl. BNE o.J.a). Wieso stellt die Schule einen geeigneten Ort für die Vermittlung nachhaltiger Entwicklung dar und wir, als zukünftige Erdkundelehrer, geeignete Vermittler für das Thema Nachhaltigkeit?
Des Weiteren werden die Kompetenzbereiche kurz erläutert und dargestellt, bevor ich im Anschluss zu der Relevanz der Methodenvielfalt übergehe. Dabei ist vor allem Interesse ein entscheidender und bedeutsamer Faktor. Um die Methodenvielfalt an einem Beispiel erklären und verdeutlichen zu können, beschäftige ich mit möglichen Einstiegen in den Erdkundeunterricht. Dabei gehe ich darauf ein, welche Einstiegsmöglichkeiten bestehen, welche Bedeutung den Einstiegen zugeordnet wird und welche unterschiedlichen Einstiegsformen und Einstiegsebenen existieren. Hinzukommen negative und positive Bespiele von Unterrichtseinstiegen. Da diese Methode ebenfalls eine Möglichkeit des Unterrichtseinstieges darstellt, beschäftige ich mich anschließend mit den Experimenten. Erläutere diese kurz, gehe auf Beispiele ein und wäge sowohl Vor, als auch Nachteile ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Daseinsberechtigung der Geographie
- Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung / Nachhaltigkeit
- Weltweite Ziele nachhaltiger Entwicklung – die SGDS
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
- ,,Was hat Bildung damit zutun?"
- Kompetenzbereiche
- Relevanz der Methodenvielfalt
- Einstiege in den Erdkundeunterricht
- Negativ und Positivbeipsiele von Unterrichtseinstiegen
- Beispiel: Experimente
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio befasst sich mit der Relevanz des Erdkundeunterrichts für die Förderung nachhaltiger Entwicklung. Es untersucht die Bedeutung des Faches Geographie im Kontext der aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft und beleuchtet die vielfältigen Möglichkeiten, die der Erdkundeunterricht bietet, um nachhaltiges Denken und Handeln zu fördern.
- Daseinsberechtigung der Geographie in der heutigen Zeit
- Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung und ihre Bedeutung für den Erdkundeunterricht
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und ihre Rolle in der Schule
- Kompetenzbereiche, die im Erdkundeunterricht im Hinblick auf Nachhaltigkeit gefördert werden können
- Relevanz der Methodenvielfalt im Erdkundeunterricht für die Vermittlung nachhaltiger Inhalte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung des Portfolios vor und erläutert den Fokus auf die Rolle des Erdkundeunterrichts in der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
- Daseinsberechtigung der Geographie: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Geographie im Kontext der aktuellen Herausforderungen wie Globalisierung, Klimawandel und Ressourcenkonflikte. Es diskutiert die Bedeutung des Faches Geographie für das Verständnis dieser Themen und die Förderung eines nachhaltigen Bewusstseins.
- Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung / Nachhaltigkeit: Dieses Kapitel definiert die verschiedenen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, wie Ökologie, Ökonomie, Soziales, Kultur und Politik, und erläutert ihre Verknüpfung mit dem Erdkundeunterricht.
- Kompetenzbereiche: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Kompetenzbereiche, die im Erdkundeunterricht im Hinblick auf Nachhaltigkeit gefördert werden können. Dabei werden die Relevanz der Methodenvielfalt sowie verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in den Unterricht diskutiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die im Portfolio behandelt werden, sind: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Erdkundeunterricht, Geographie, Nachhaltigkeit, Methodenvielfalt, Kompetenzbereiche, Einstiege in den Unterricht, Experimente, globale Herausforderungen, gesellschaftliche Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Erdkundeunterricht bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)?
Der Erdkundeunterricht ist zentral für die Vermittlung nachhaltiger Aspekte, da er globale Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenkonflikte analysiert und ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln fördert.
Was versteht man unter Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)?
BNE ist ein Bildungskonzept, das Lernende befähigt, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt.
Warum ist Methodenvielfalt im Geographieunterricht wichtig?
Methodenvielfalt steigert das Interesse der Schüler und ermöglicht es, komplexe Nachhaltigkeitsthemen aus verschiedenen Perspektiven und auf unterschiedlichen Ebenen zu bearbeiten.
Welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es für den Erdkundeunterricht?
Es existieren verschiedene Einstiegsformen und -ebenen, die von motivierenden Impulsen bis hin zu problemorientierten Fragestellungen reichen, um das Thema Nachhaltigkeit einzuleiten.
Wie können Experimente zur Vermittlung von Nachhaltigkeit beitragen?
Experimente bieten eine praktische Möglichkeit, geographische Prozesse und ökologische Zusammenhänge direkt erfahrbar zu machen, wobei stets Vor- und Nachteile der Methode abgewogen werden müssen.
Welche Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung werden im Unterricht behandelt?
Im Unterricht werden die Dimensionen Ökologie, Ökonomie, Soziales, Kultur und Politik sowie deren wechselseitige Verknüpfungen thematisiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Welche Relevanz besitzt der Erdkundeunterricht um für eine nachhaltig(er)e Gesellschaft beizutragen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542220