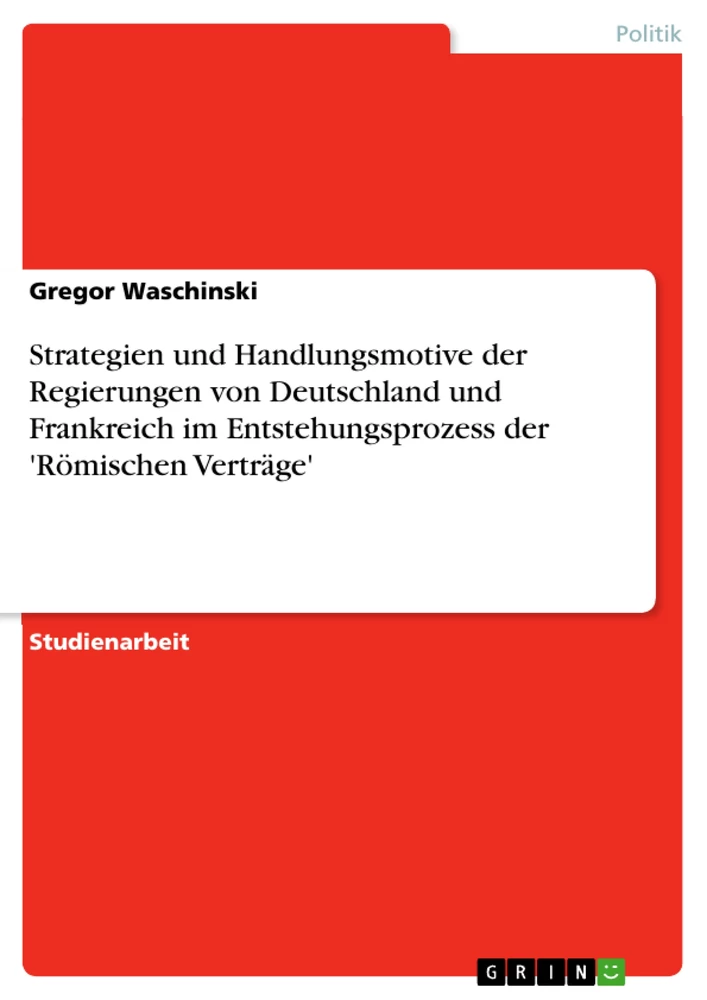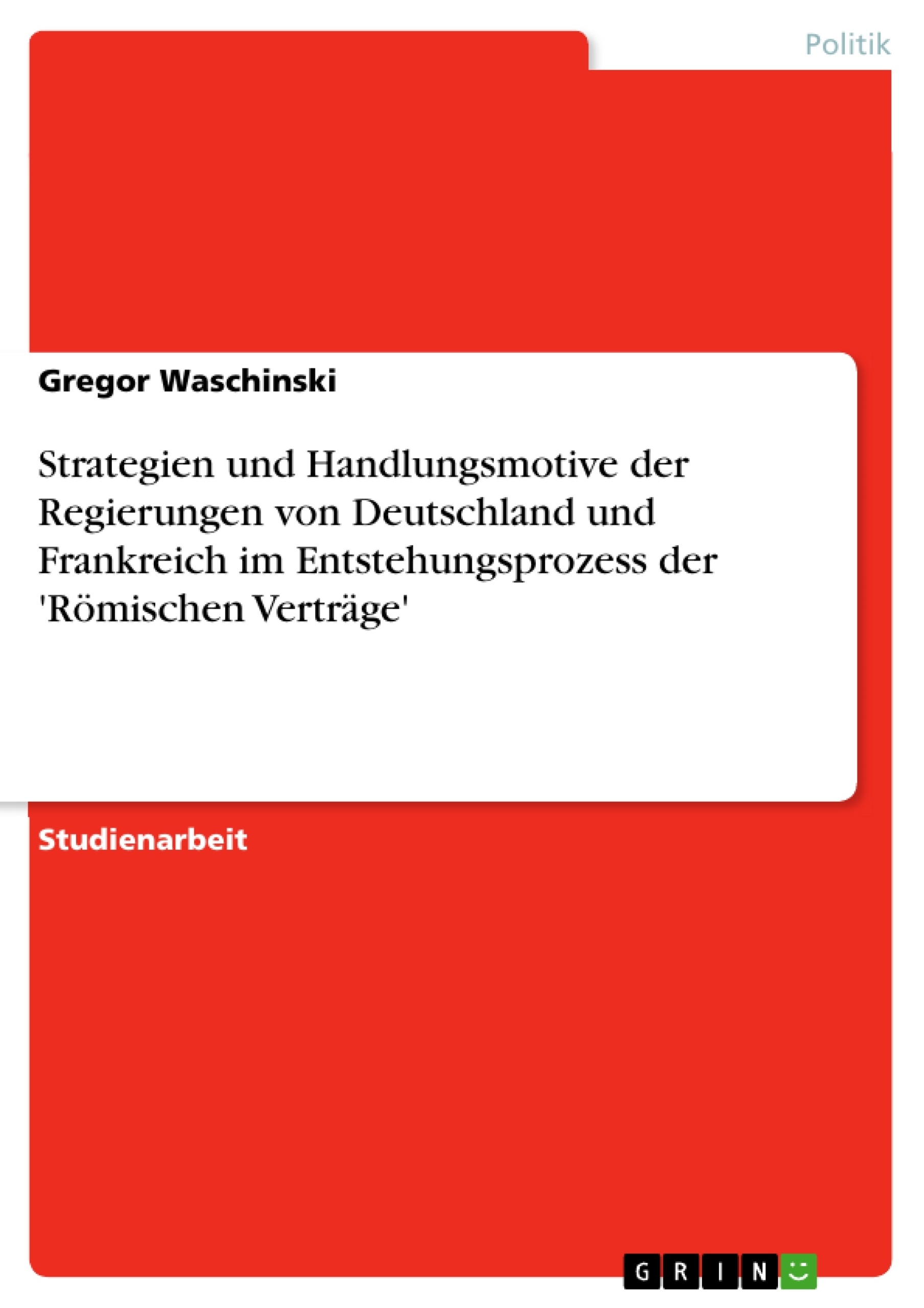Die Unterzeichnung des Euratom-Vertrages und des Vertrages über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), genannt „Römischen Verträge“, am 25. März 1957 in Rom gilt als die Geburtsstunde der späteren Europäischen Union. Während der Euratom-Vertrag an das der 1951 geschaffenen Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zu Grunde liegende Konzept der „sektoralen Integration“ in einem spezifischen Wirtschaftsbereich anknüpfte, erwies sich der EWG-Vertrag mit dem Ziel der Herstellung eines gemeinsamen Marktes als der eigentlich richtungweisende Vertrag für die Fortentwicklung der europäischen Einigung. Der Dualismus zweier Integrationsvorstellungen, der sich an den „Römischen Verträgen“ ablesen lässt, prägte bereits den Entstehungsprozess des Vertragswerks. Der „Methode Monnet“, also einer Addition von Teilintegrationen in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen, stand die Idee einer gesamtwirtschaftlichen „horizontalen Integration“ gegenüber. Die Initiative zu dem Prozess, der in den „Römischen Verträgen“ münden sollte, war von den Benelux-Staaten und den europäischen Institutionen der EGKS ausgegangen. Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Integrationsvorschläge war allerdings die Haltung der beiden bedeutendsten Länder der Sechser-Gemeinschaft, Deutschland und Frankreich, die jeweils für eine der beiden konkurrierenden Integrationsvorstellungen standen. Während Deutschland das Konzept der „horizontalen Integration“ favorisierte, neigte Frankreich zur „Methode Monnet“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Von Paris nach Rom: Der Entstehungsprozess von EWG und Euratom
- 1.1. Die europäische „relance“
- 1.2. Der Spaak-Ausschuss und die Regierungsverhandlungen
- 1.3. Die Römischen Verträge: Inhalt und Bedeutung
- 2. Das „Römische Junktim“: Strategien und Handlungsmotive von Deutschland und Frankreich
- 2.1. Interessenlage und Positionierung
- 2.1.1. Frankreich
- 2.1.2. Deutschland
- 2.2. Deutsche und französische Interessen in Verhandlungsprozess und Verhandlungsergebnis
- 2.1. Interessenlage und Positionierung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Entstehungsprozess der Römischen Verträge mit besonderem Fokus auf die Strategien und Handlungsmotive der deutschen und französischen Regierungen. Sie beleuchtet den Weg von der gescheiterten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft bis zur Unterzeichnung der Verträge und analysiert das deutsch-französische Spannungsverhältnis während der Verhandlungen.
- Der Entstehungsprozess der Römischen Verträge
- Die Strategien Deutschlands und Frankreichs im Verhandlungsprozess
- Das deutsch-französische Spannungsverhältnis als bestimmender Faktor
- Konkurrierende Integrationsvorstellungen: „Methode Monnet“ vs. „horizontale Integration“
- Die Rolle der Interessenlagen beider Länder im Verhandlungsergebnis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Bedeutung der Römischen Verträge als Geburtsstunde der Europäischen Union und den Dualismus zweier Integrationsvorstellungen (sektorale vs. gesamtwirtschaftliche Integration). Sie benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Entstehungsprozesses der Verträge unter Berücksichtigung der Strategien und Handlungsmotive der deutschen und französischen Regierungen, insbesondere die Frage, inwiefern der Verhandlungsprozess und das Ergebnis Ausdruck deutsch-französischer Interessengegensätze sind. Die Einleitung erwähnt auch den theoretischen Rahmen der Arbeit, angelehnt am liberalen Intergouvernementalismus von Moravcsik.
1. Von Paris nach Rom: Der Entstehungsprozess von EWG und Euratom: Dieses Kapitel beschreibt den Entstehungsprozess der Römischen Verträge im Kontext des Scheiterns der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 1954. Es beleuchtet die Krise des europäischen Integrationsprozesses und den Weg von diesem Rückschlag zur Unterzeichnung der Verträge. Es werden die Initiativen der Benelux-Staaten und der europäischen Institutionen der EGKS erwähnt, sowie die entscheidende Rolle Deutschlands und Frankreichs mit ihren gegensätzlichen Integrationsvorstellungen. Der Kapitel skizziert den historischen und politischen Kontext für die spätere Analyse des deutsch-französischen Spannungsverhältnisses.
2. Das „Römische Junktim“: Strategien und Handlungsmotive von Deutschland und Frankreich: Dieses Kapitel untersucht eingehend das deutsch-französische Spannungsverhältnis während der Verhandlungen zu den Römischen Verträgen. Es analysiert die Interessenlagen und Positionierungen beider Länder, die konkurrierenden Integrationsmodelle und wie diese sich im Verhandlungsprozess und im endgültigen Vertragswerk widerspiegelten. Die unterschiedlichen Strategien und Handlungsmotive Deutschlands und Frankreichs und ihr Einfluss auf das Ergebnis werden detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Wechselwirkung der nationalen Interessen und ihrer Auswirkung auf die europäische Integration.
Schlüsselwörter
Römische Verträge, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Euratom, Europäische Integration, Deutschland, Frankreich, deutsch-französisches Verhältnis, Integrationsstrategien, „Methode Monnet“, „horizontale Integration“, Verhandlungsprozess, Interessengegensätze, liberaler Intergouvernementalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Von Paris nach Rom: Der Entstehungsprozess der Römischen Verträge und das deutsch-französische Verhältnis"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Entstehungsprozess der Römischen Verträge (EWG und Euratom) mit besonderem Fokus auf die Strategien und Handlungsmotive der deutschen und französischen Regierungen. Sie analysiert das deutsch-französische Spannungsverhältnis während der Verhandlungen und wie sich dieses im Ergebnis niederschlug.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Entstehungsprozess der Römischen Verträge im Kontext des Scheiterns der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Sie analysiert die Interessenlagen und Positionierungen Deutschlands und Frankreichs, ihre konkurrierenden Integrationsmodelle ("Methode Monnet" vs. "horizontale Integration") und wie diese den Verhandlungsprozess und das Ergebnis beeinflussten. Ein zentraler Aspekt ist die Rolle des deutsch-französischen Spannungsverhältnisses als bestimmender Faktor für den Integrationsverlauf.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Hauptkapitel und eine Zusammenfassung. Kapitel 1 beschreibt den Entstehungsprozess der Römischen Verträge von der gescheiterten EVG bis zur Unterzeichnung. Kapitel 2 analysiert detailliert die Strategien und Handlungsmotive Deutschlands und Frankreichs im Verhandlungsprozess, inklusive ihrer konkurrierenden Integrationsvorstellungen und der Auswirkungen auf das Verhandlungsergebnis.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den liberalen Intergouvernementalismus von Moravcsik als theoretischen Rahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Römische Verträge, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Euratom, Europäische Integration, Deutschland, Frankreich, deutsch-französisches Verhältnis, Integrationsstrategien, „Methode Monnet“, „horizontale Integration“, Verhandlungsprozess, Interessengegensätze, liberaler Intergouvernementalismus.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, den Entstehungsprozess der Römischen Verträge zu untersuchen und aufzuzeigen, inwieweit dieser Prozess und das Ergebnis Ausdruck deutsch-französischer Interessengegensätze sind. Der Fokus liegt auf der Analyse der Strategien und Handlungsmotive beider Länder im Verhandlungsprozess.
Welche Rolle spielten Deutschland und Frankreich im Entstehungsprozess der Römischen Verträge?
Deutschland und Frankreich spielten eine entscheidende Rolle im Entstehungsprozess. Ihre gegensätzlichen Integrationsvorstellungen und Interessen beeinflussten den Verhandlungsprozess maßgeblich und prägten das Ergebnis der Römischen Verträge. Die Arbeit analysiert detailliert die Strategien und Handlungsmotive beider Länder.
Wie wird das deutsch-französische Spannungsverhältnis in der Hausarbeit dargestellt?
Das deutsch-französische Spannungsverhältnis wird als bestimmender Faktor im Entstehungsprozess der Römischen Verträge dargestellt. Die Arbeit analysiert die konkurrierenden Interessen und Strategien beider Länder und wie diese das Verhandlungsergebnis beeinflussten.
- Citation du texte
- Gregor Waschinski (Auteur), 2005, Strategien und Handlungsmotive der Regierungen von Deutschland und Frankreich im Entstehungsprozess der 'Römischen Verträge', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54670