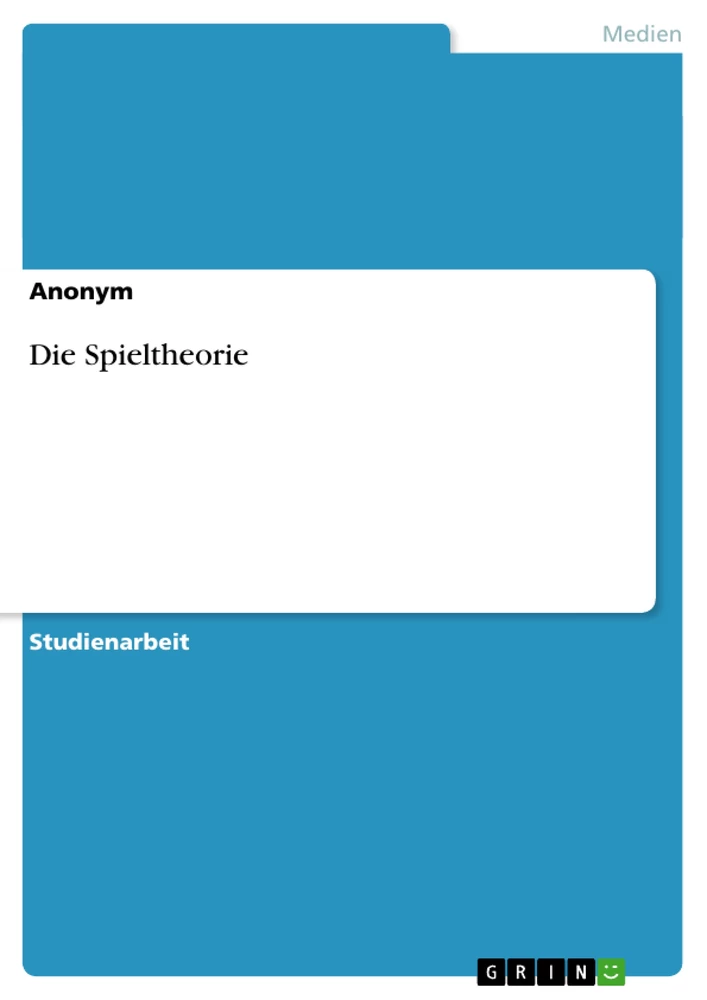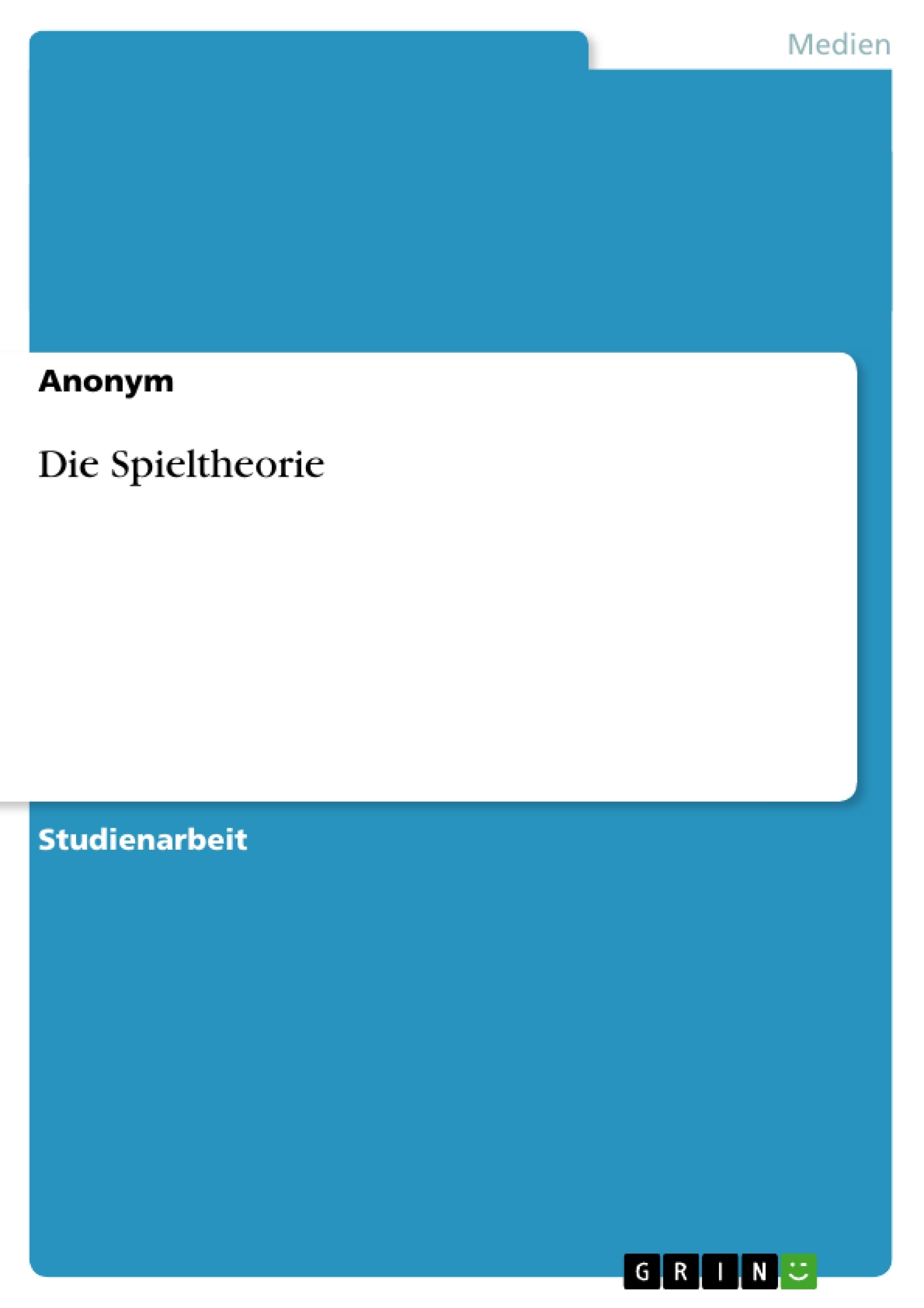Das Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser einen groben Überblick über die relativ neue Wissenschaft der Spieltheorie zu verschaffen. Dazu werde ich zunächst den Gegenstand der Spieltheorie erläutern und einen kurzen Abriss der Geschichte der Spieltheorie geben. Im vierten Kapitel werden vier verschiedene Spielklassen vorgestellt werden, deren Verständnis grundlegend für die folgenden Kapitel sein wird. Nachfolgend werde ich den Unterschied zwischen kooperativen und nicht-kooperativen Spielen verdeutlichen. Das sechste Kapitel stellt den zentralen Punkt der Arbeit dar, in dem ich auf Spiele mit dominanten Strategien und auf Spiele ohne dominante Strategien eingehen werde. Für die Verdeutlichung der Spiele mit dominanten Strategien habe ich das spieltheoretische Modell des Gefangenendilemmas gewählt. Das Modell der Kampf der Geschlechter wird Spiele ohne dominante Strategien erläutern. Kapitel sieben beschäftigt sich mit wiederholten Spielen und dem Versuch des amerikanischen Mathematikers und Politikwissenschaftlers Robert Axelrod, die erfolgreichste Strategie in einem unendlich wiederholten Gefangenendilemma zu ermitteln. Im letzten Kapitel werde ich aufzeigen, welche Rolle Drohungen, Verpflichtungen und Glaubwürdigkeit in der Entstehung von Kooperation spielen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Gegenstand der Spieltheorie
- Geschichte der Spieltheorie
- Spielklassen
- Zwei-Personen-Spiele
- Zwei-Personen-Nullsummenspiele
- Zwei-Personen-Nicht-Nullsummenspiele
- n-Personen-Spiele
- Zwei-Personen-Spiele
- Kooperative vs. Nicht-kooperative Spiele
- Kooperative Spiele
- Nicht-kooperative Spiele
- Spielstrategien
- Spiele mit dominanten Strategien
- Spiele ohne dominante Strategien
- Wiederholte Spiele
- Endlich wiederholte Spiele
- Unendlich wiederholte Spiele
- Verpflichtungen, Drohungen und Glaubwürdigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, dem Leser einen umfassenden Überblick über die Spieltheorie zu vermitteln. Dabei werden zunächst der Gegenstand der Spieltheorie erläutert und die Geschichte der Spieltheorie beleuchtet. Die verschiedenen Spielklassen werden vorgestellt, um ein grundlegendes Verständnis für die folgenden Kapitel zu schaffen. Im Anschluss wird der Unterschied zwischen kooperativen und nicht-kooperativen Spielen verdeutlicht. Ein zentrales Element der Arbeit ist die Darstellung von Spielen mit dominanten Strategien und Spielen ohne dominante Strategien, wobei das Gefangenendilemma und das Modell der Kampf der Geschlechter als Beispiele dienen. Wiederholte Spiele und die Suche nach der erfolgreichsten Strategie im unendlich wiederholten Gefangenendilemma stehen im Fokus von Kapitel sieben. Schließlich werden die Rolle von Drohungen, Verpflichtungen und Glaubwürdigkeit in der Entstehung von Kooperationsspielen beleuchtet.
- Der Gegenstand der Spieltheorie und ihre Anwendung in verschiedenen Disziplinen
- Kooperative und nicht-kooperative Spielformen und ihre Eigenschaften
- Strategien in Spielen mit dominanten und ohne dominante Strategien
- Die Auswirkungen von wiederholten Spielen auf die Entscheidungsfindung
- Die Rolle von Drohungen, Verpflichtungen und Glaubwürdigkeit bei der Kooperation
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Dieses Kapitel führt den Leser in die Thematik der Spieltheorie ein. Es erläutert den Gegenstand der Spieltheorie und gibt einen kurzen Abriss der Geschichte der Spieltheorie. Außerdem werden die wichtigsten Spielklassen vorgestellt, die für das Verständnis der folgenden Kapitel von Bedeutung sind.
Gegenstand der Spieltheorie
Dieses Kapitel beleuchtet den Gegenstand der Spieltheorie und erklärt, wie Entscheidungen von Akteuren in Interaktionssituationen getroffen werden. Es wird erläutert, dass das Ergebnis einer Entscheidung von den Entscheidungen anderer Entscheidungsträger abhängig ist. Die Spieltheorie wird als „Theorie sozialer Interaktion" bezeichnet und soll eine Entscheidungshilfe für komplexe Situationen bieten, in denen nicht nur eigene Präferenzen und Zufall eine Rolle spielen.
Geschichte der Spieltheorie
Dieses Kapitel erzählt die Geschichte der Spieltheorie und stellt die wichtigsten Meilensteine und Persönlichkeiten vor. Es beschreibt die Entwicklung der Spieltheorie von ihren Anfängen im Jahr 1928 bis zur wissenschaftlichen Anerkennung durch den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Die wichtigsten Entwicklungen und deren Einfluss auf verschiedene Disziplinen werden beleuchtet.
Spielklassen
Dieses Kapitel stellt verschiedene Spielklassen vor, die sich durch die Anzahl der Spieler und die Art der Interaktion auszeichnen. Dabei wird zwischen Zwei-Personen-Spielen und n-Personen-Spielen unterschieden. Es werden auch die Unterschiede zwischen Nullsummenspielen und Nicht-Nullsummenspielen erläutert. Das Kapitel bietet somit eine systematische Einordnung verschiedener Spielsituationen.
Kooperative vs. Nicht-kooperative Spiele
Dieses Kapitel behandelt den Unterschied zwischen kooperativen und nicht-kooperativen Spielen. Es werden die Merkmale beider Spielformen erläutert und Beispiele aus dem Alltag angeführt, um die Unterschiede deutlich zu machen. Das Kapitel soll das Verständnis für die verschiedenen Arten von Interaktion zwischen Spielern vertiefen.
Spielstrategien
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Spielstrategien, die Spieler anwenden können. Dabei wird der Fokus auf Spiele mit dominanten Strategien und Spielen ohne dominante Strategien gelegt. Das Gefangenendilemma wird als Beispiel für Spiele mit dominanten Strategien vorgestellt, während das Modell der Kampf der Geschlechter Spiele ohne dominante Strategien veranschaulicht.
Wiederholte Spiele
Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von wiederholten Spielen auf die Entscheidungsfindung. Es werden sowohl endlich wiederholte Spiele als auch unendlich wiederholte Spiele betrachtet. Das Kapitel beschäftigt sich mit der Suche nach der erfolgreichsten Strategie in einem unendlich wiederholten Gefangenendilemma und zeigt, wie sich die wiederholte Interaktion auf das Spielverhalten auswirken kann.
Verpflichtungen, Drohungen und Glaubwürdigkeit
Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Verpflichtungen, Drohungen und Glaubwürdigkeit in der Entstehung von Kooperationsspielen. Es wird untersucht, wie diese Faktoren die Entscheidungen von Spielern beeinflussen und wie sie zur Förderung oder Behinderung von Kooperation beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind Spieltheorie, Entscheidungsfindung, Interaktion, Kooperation, Konflikt, Strategien, dominante Strategien, wiederholte Spiele, Gefangenendilemma, Kampf der Geschlechter, Verpflichtungen, Drohungen, Glaubwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Gegenstand der Spieltheorie?
Die Spieltheorie untersucht soziale Interaktionssituationen, in denen das Ergebnis einer Entscheidung nicht nur von den eigenen Handlungen, sondern auch von den Entscheidungen anderer Akteure abhängt.
Was ist das „Gefangenendilemma“?
Es ist ein klassisches Modell für Spiele mit dominanten Strategien, das zeigt, warum zwei rationale Individuen oft nicht kooperieren, selbst wenn es in ihrem besten Interesse läge.
Was unterscheidet kooperative von nicht-kooperativen Spielen?
In kooperativen Spielen können die Spieler verbindliche Verträge abschließen, während in nicht-kooperativen Spielen jeder Akteur nur auf Basis seiner eigenen Interessen handelt.
Welche Bedeutung hat die Glaubwürdigkeit in der Spieltheorie?
Glaubwürdigkeit ist entscheidend für die Wirksamkeit von Drohungen und Verpflichtungen. Nur wenn ein Mitspieler glaubt, dass eine Drohung auch wahrgenommen wird, beeinflusst sie sein Verhalten.
Was sind Nullsummenspiele?
Nullsummenspiele sind Situationen, in denen der Gewinn des einen Spielers exakt dem Verlust des anderen Spielers entspricht (die Summe der Ergebnisse ist immer Null).
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2006, Die Spieltheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55185