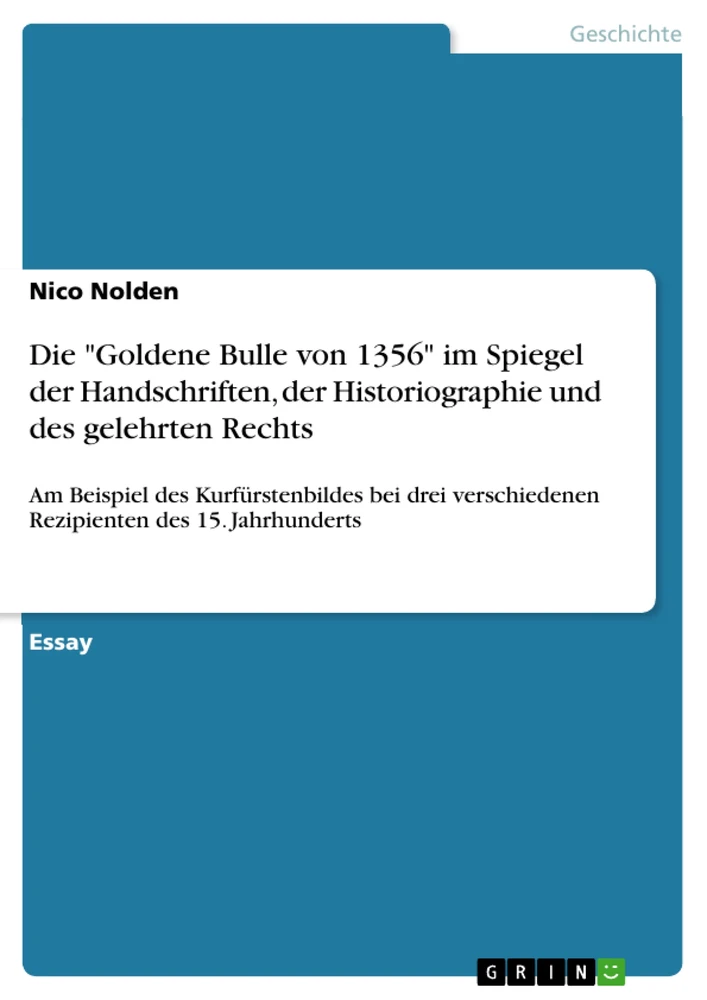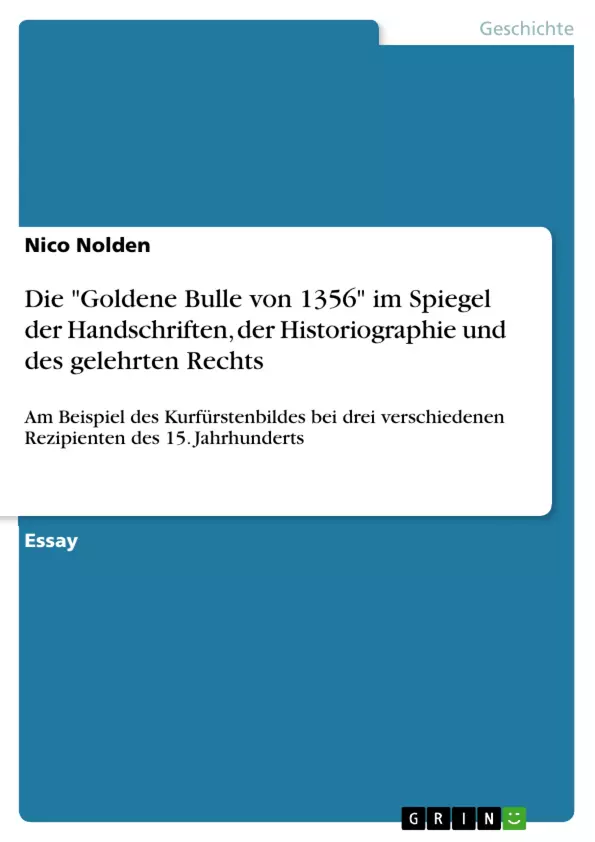Der Untersuchungsgegenstand Nachdem die Zeitgenossen scheinbar die Bedeutung der Goldenen Bulle für die Herrschaft im Reich nicht absahen, stieg das Interesse nach dem Jahr 1400 bedeutend an. Von großem Interesse für die Forschung muss daher sein, in welcher Weise verschiedene soziale Gruppen zu dieser Zeit die Regularien der Goldenen Bulle rezipierten und in welcher Art sie ihren Inhalt verschriftlichten. Als Grundlage der vorliegenden Arbeit dienen die Regularien, wie sie die Goldene Bulle Karls IV. 1356 vorsah. Hierbei soll ein besonderes Augenmerk auf die Rolle der Kurfürsten gelegt werde, um den Inhalt betreffender Passagen im Anschluss mit den vorzustellenden Textabschnitten dreier Quellen des 15. Jahrhunderts zu vergleichen.
Aus der Feder eines Kanonikers des Stiftes St. Theobald von Metz stammt die „Chronique, ou Annales du Doyen de S. Thiébaut de Metz“. Diese Chronik, die nach dem Jahre 1429 entstanden sein muss, gibt einen Einblick in die geistliche Perspektive auf die Goldene Bulle. Für eine stadtbürgerliche, weltliche Perspektive werden „Les coroniques parlans de l’empereur Hanrey cuien de Luxembourg et de sa descendue“ von Jaique Dex und seinem Sohn vorgestellt, die zwischen 1434 und 1438 in Metz entstanden. Zuletzt wird auf die juristische Arbeit von Peter von Andlau hingewiesen, der als Rechtsgelehrter im Jahre 1460 eine erste rechtshistorische Arbeit über das Alte Reich unter dem Titel „Libellus de Cesarea Monarchia“ unter Verwendung der Goldenen Bulle verfasst hat und damit als Begründer des deutschen Staatsrechtes gelten kann. Sein Text soll einen Aspekt der Sicht der juristischen Gelehrtenschaft damaliger Zeit repräsentieren.
Die Frage nach der Perspektive dieser Schriften auf die Goldene Bulle wird auf die Rolle der Kurfürsten in den Schilderungen der Metzer Chroniken über den Besuch Kaiser Karls IV. in der Stadt (1356/57) fokussiert. Daher werden sich die Untersuchungen an der Goldenen Bulle und der rechtshistorischen Schrift an den relevanten Ereignissen orientieren, welche zunächst der Einzug des Kaisers und seines Gefolges in die Stadt Metz, dann die Messe zum Heiligen Abend und schließlich das Festbankett auf dem Champ-à-Sailles der Stadt Metz sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Perspektiven im 15. Jahrhundert: Der Untersuchungsgegenstand
- II. Die Goldene Bulle und das Zeremoniell: Pflichten und Rechte der Kurfürsten
- III. Geistliche Perspektive: Doyen de S. Thiébaut de Metz
- IV. Weltliche Perspektive: Jaique Dex und sein Sohn - Stadtbürger aus Metz
- V. Rechtshistorisch gelehrte Perspektive: Peter von Andlau
- VI. Das Kurfürstenbild: Geistliche, weltliche und gelehrte Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rezeption der Goldenen Bulle von 1356 im 15. Jahrhundert. Sie analysiert, wie verschiedene soziale Gruppen – Geistliche, Stadtbürger und Rechtsgelehrte – die Regularien der Goldenen Bulle rezipierten und in ihren Schriften niederschrieben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Rolle der Kurfürsten, die durch die Goldene Bulle eine besondere Bedeutung im Heiligen Römischen Reich erlangten.
- Die Rezeption der Goldenen Bulle im 15. Jahrhundert
- Die Rolle der Kurfürsten im Kontext der Goldenen Bulle
- Die geistliche, weltliche und juristische Perspektive auf die Goldene Bulle
- Die Darstellung des Kurfürstenbildes in verschiedenen Quellen des 15. Jahrhunderts
- Die Bedeutung der Goldenen Bulle für die Herrschaft im Heiligen Römischen Reich
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I führt in den Untersuchungsgegenstand ein und stellt die verschiedenen Perspektiven der Rezeption der Goldenen Bulle im 15. Jahrhundert vor. Es werden die drei Quellen vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden: „Chronique, ou Annales du Doyen de S. Thiébaut de Metz“, „Les coroniques parlans de l'empereur Hanrey cuien de Luxembourg et de sa descendue“ und „Libellus de Cesarea Monarchia“.
Kapitel II beleuchtet die Bedeutung der Goldenen Bulle für das Zeremoniell und die Pflichten und Rechte der Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich. Es werden verschiedene Kapitel der Goldenen Bulle analysiert, die detaillierte Ordnungen für diverse Anlässe vorschreiben, insbesondere für den Umgang mit den Reichskleinodien, die Rangordnung der Kurfürsten bei festlichen Anlässen und die Sitzordnung bei Gerichtsverhandlungen, Belehnungen und Festmählern.
Kapitel III untersucht die geistliche Perspektive auf die Goldene Bulle anhand der „Chronique, ou Annales du Doyen de S. Thiébaut de Metz“. Dieses Kapitel zeigt, wie die geistliche Sicht auf die Goldene Bulle und die Rolle der Kurfürsten in der Chronik des Kanonikers von St. Thiébaut de Metz dargestellt wird.
Kapitel IV analysiert die weltliche Perspektive auf die Goldene Bulle anhand der „Les coroniques parlans de l'empereur Hanrey cuien de Luxembourg et de sa descendue“ von Jaique Dex und seinem Sohn. Dieses Kapitel untersucht, wie die Stadtbürger von Metz die Goldene Bulle und die Rolle der Kurfürsten in ihrer Chronik rezipierten.
Kapitel V befasst sich mit der rechtshistorisch gelehrten Perspektive auf die Goldene Bulle anhand des „Libellus de Cesarea Monarchia“ von Peter von Andlau. Dieses Kapitel zeigt, wie Peter von Andlau die Goldene Bulle in seiner rechtshistorischen Arbeit nutzt und wie er die Rolle der Kurfürsten in diesem Kontext interpretiert.
Schlüsselwörter
Goldene Bulle, Kurfürsten, Rezeption, Historiographie, Geistliche, Weltliche, Juristische Perspektive, Zeremoniell, Pflichten, Rechte, Reichskleinodien, Rangordnung, Sitzordnung, Metzer Chroniken, Kaiser Karl IV., Peter von Andlau, Jaique Dex, Doyen de S. Thiébaut de Metz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Goldene Bulle von 1356?
Die Goldene Bulle ist eines der wichtigsten Verfassungsdokumente des Heiligen Römischen Reiches. Sie legte die Modalitäten der Königswahl durch die Kurfürsten und deren Vorrechte fest.
Welche Rolle spielten die Kurfürsten laut diesem Dokument?
Die Kurfürsten erhielten durch die Goldene Bulle eine herausragende Stellung, die sowohl ihre Rechte bei der Wahl als auch zeremonielle Pflichten, wie die Sitzordnung und den Umgang mit Reichskleinodien, umfasste.
Welche Perspektiven auf die Goldene Bulle werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert drei Perspektiven des 15. Jahrhunderts: die geistliche Sicht (Doyen de S. Thiébaut), die weltlich-stadtbürgerliche Sicht (Jaique Dex) und die rechtshistorisch-gelehrte Sicht (Peter von Andlau).
Wer war Peter von Andlau?
Peter von Andlau war ein Rechtsgelehrter, der 1460 mit dem "Libellus de Cesarea Monarchia" eine der ersten rechtshistorischen Arbeiten über das Reich verfasste und als Begründer des deutschen Staatsrechts gilt.
Warum stieg das Interesse an der Goldenen Bulle erst nach 1400 an?
Obwohl Zeitgenossen die Tragweite zunächst nicht voll absahen, wurde die Bedeutung der Regularien für die Herrschaftssicherung und das Zeremoniell im Reich im 15. Jahrhundert immer deutlicher erkannt.
Welche Ereignisse in Metz sind für die Untersuchung relevant?
Besonders relevant sind die Schilderungen über den Besuch Kaiser Karls IV. in Metz (1356/57), einschließlich seines Einzugs, der Weihnachtsmesse und des Festbanketts.
- Citar trabajo
- Nico Nolden (Autor), 2006, Die "Goldene Bulle von 1356" im Spiegel der Handschriften, der Historiographie und des gelehrten Rechts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55279